Homepage von
Martin Ebers
"Das halbe Bild"
2.1. Politiker, Medienkritiker und Kulturpessimisten
"Das Universum der ständigen
Fernsehgäste ist eine geschlossene Welt, in der
jeder
jeden kennt und die einer Logik ständiger Selbstbestätigung
folgt."
(Pierre Bourdieu, zit. nach Rötzer 1998)
"Hartnäckige Übellaunigkeit ist
ein allzu klares Symptom dafür, daß ein Mensch gegen
seine Bestimmung lebt."
(Jose Ortega y Gasset)
„Gegen
Eskapismus können auch nur die Gefängniswärter
etwas haben."
(J.R.R. Tolkien)
„Ich möchte den Jüngeren
demonstrativ meine Erschöpfung zeigen, um ihnen zu
zeigen,
was auch sie in Zukunft erwartet. Wären alle so,
wäre es eine bessere Welt.“
(Wilhelm
Genazino, „Das Glück in glücksfernen Zeiten“,
aus dem Gedächtnis nach einer Hörfunklesung)
[...]
Für mich bezeichnend ist dabei, daß die Medienkritiker tatsächlich eine Gruppe sind, deren Arbeitsergebnisse und Schlüsse daraus sich nicht verändern, egal wieviele Studien sie auch durchführen. Einerseits könnte man nun annehmen, daß wenn Replikationsstudien. Andererseits aber finden währenddessen zahlreiche andere Studien, auch Replikationsstudien, teilweise ganz andere Ergebnisse - stellen zumindest aber nicht in Wort und optischer Aufbereitung eine Haltung dar, daß es sich bei dem Medium angeblich um den "Untergang des Abendlandes" handelt.
2.1.1 Vorangegangene Medienkritiken und der Bezug zu heute
"Sie halten ihn [den Roman] für eine
subtile Verteidigung des Selbstmords? Das gemahnt mich, als ob man
Homers Iliade für eine subtile Aufmunterung zu Zorn, Hader
und Feindschaft ausgeben wollte."
(Jakob Michael
Reinhold Lenz über Goethes "Die Leiden des Jungen
Werthers")
Die Medienkritik ist wohl so alt wie die jeweiligen Medien selbst, und nicht einmal die Punkte, die heute kritisiert werden, sind neu. Letztlich in allen Zeiten sind Vorstellungen zu finden, nach denen bestimmte Inhalte als indiskutabel angesehen wurden, in späteren Zeiten wenn vielleicht nicht als "Heilige Grale" betrachtet, so doch als Quellen über die kulturellen Verständnisse und ihre Widersprüche dienen können. Kritiken sind dabei häufig so wortreich wie überzogen. Viele der damaligen Einschätzungen findet man auch heute fast wortgleich wiederholt in der aktuellen Diskussion, diesmal bloß bezogen auf andere Medien.
Die Kritik an einem Medium war damals wie heute tatsächlich die Kritik an der Jugend, die es um so bereitwilliger aufzunehmen und zu konsumieren schien, wodurch sich deren Denken und Lebensgestaltung stärker als bisher gekannt von der bisher gepflegten Lebenshaltung unterschied (vgl. ). Sie hielt häufig solange, bis jene Jugend, für deren vermeintliche moralische Verworfenheit das angegriffene Medium verantwortlich gemacht wurde, selbst das Alter erreicht hatte, in dem sie politischen Einfluß ausüben konnte - oder aber sich selbst in Kritik an der Jugend erging. Eine weitere Konstante dabei scheint zu sein, daß sich die Kritiker, die dermaßen ausgedehnt über die Gefahren von Medien referieren, sich kaum tatsächlich mit diesen auseinandergesetzt hatten (vgl. Buerger 2007, S.643f.). Im Anschluß an einen Kommentar der Autorin Tracy Hickman zur "moral panic" bezüglich "Dungeons and Dragons" mag man weiterhin aus der Kritik von seiten von religiösen Fundamentalisten die These ableiten, daß diese Kritiker glauben, die Spieler könnten ebensowenig zwischen Fantasie und Realität unterscheiden wie sie selbst (vgl. Ethics in Fantasy: Morality and D&D, abgerufen am 16.09.2008).
2.1.1.1 Medienkritik an literarischen Werken
"[Dieses Werk besteht aus] den Einzelheiten
einer Meuterei und eines fürchterlichen Gemetzels
an Bord der amerikanischen Brigg Grampus, auf ihrem Weg in die
Süd-Meere, im Monat Juni des Jahres 1827. Mit einem Bericht
über die Zurückeroberung des Schiffs durch die
Überlebenden; ihren Schiffbruch und nachfolgend
das entsetzliche Leiden durch beinahes Verhungern;
ihre Errettung durch den britischen Schoner Jane Guy; die kurze
Reise dieses letzteren Schiffes im Antarktischen Ozean; seine
Kaperung und das Massakrieren seiner Besatzung
inmitten einer Inselgruppe auf Höhe des vierundachtzigsten
südlichen Breitengrades; zusammen mit den unglaublichen
Abenteuern und Entdeckungen noch weiter im Süden, zu denen
diese betrübliche Katastrophe geführt hat."
(Untertitel
zu Edgar Allen Poe, "Die Geschichte des Arthur Gordon Pym aus
Nantucket" (1838),
zitiert nach "Staubloser
Klassiker", in: "Büchermarkt", DLF,
18.01.2009; Hervorhebungen von mir)
So finden sich bereits 1485, nur wenige Jahrzehnte nach der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, Befürchtungen, daß durch Druckwerke nicht bloß neutral Informationen weitergegeben würden, sondern das Medium selbst selektiv berichten würde (vgl. Nagenborg 2003, S.4). Um das Jahr 1800, als sich das Lesen als Kulturtechnik langsam durchzusetzen begann, wurde der Begriff der "Lesesucht" geprägt. So wurde damals befürchtet, daß der Leser den Bezug zur Realität und zur Arbeit verliere (vgl. Wikipedia: Lesesucht, abgerufen am 20.09.2007).
Und so nimmt es nicht Wunder, daß längst nicht nur "Schund", sondern auch Texte, die heute zum Teil als Höhepunkte von Kunst und Kulturbetrieb gefeiert werden, in vergangenen Zeiten als indiskutable Machwerke angesehen wurden. Nicht selten ergab sich aber das vernichtende Urteil aus der mehr oder weniger bewußten Mißinterpretation des Textes oder deshalb, weil sich die Medienkritiker in der Darstellung selbst entlarvt sahen. Eine generelle Kritik an einem Medium, die auch in alten Zeiten bis hin zu einem Verbot gehen konnte, war jedenfalls selten angebracht, während andererseits Kunstformen, die weiterhin gepflegt wurden, häufig aus anderen Gründen problematisch waren.
1. Niccolo Machiavellis "Der Fürst" wurde vielfach als Verteidigungsschrift für rücksichtslose Potentaten verstanden, indem er etwa konstatierte, der Fürst müsse Gewalt anwenden und sich, da er von Schlechtigkeit umgeben sei, in seinem Handeln von moralischen Grundsätzen lösen. Andererseits aber war Machiavelli durchaus von den Vorzügen einer republikanischen Verfassung angetan und kritisierte etwa das Christentum dafür, daß es den Menschen zwar zur Demut erziehe, ihm aber nicht die Mittel gebe, sich selbst (auch von Tyrannei) zu befreien. Was Machiavellis Buch zahlreiche Verbote einbrachte. Rousseau sah Machiavellis "Der Fürst" letztlich eher als Spiegel der herrschenden Verhältnisse, die natürlich die Machthaber nicht dargestellt sehen wollten und so reagierten (vgl. Wikipedia: Niccolo Machiavelli, abgerufen am 04.01.2008), während eine andere Argumentationslinie immerhin festhält, daß Machiavellis Modell eines Fürsten für die Verhältnisse der Renaissance tatsächlich ein Fortschritt gewesen wäre (vgl. Wikipedia: Der Fürst, abgerufen am 04.01.2008).
2. Während des elisabethanischen Zeitalters war das Theater ein so allgegenwärtiges und neuartiges Medium wie heute das Kino oder vielleicht gar das Fernsehen gewesen, und war selbst extrem blutig, um dem Publikum die Angelegenheiten zu vermitteln, mit denen sich die dargestellten Figuren trugen. Auch - natürlich nicht allein in der elisabethanischen Zeit - konkurrierten Theatermacher mit öffentlichen Hinrichtungen als "Belustigungen" und mußten entsprechend ebenfalls mit drastischen Darstellungen arbeiten (vgl. "Auf der Suche nach Shakespeare", 2.Teil, ZDF Theaterkanal, 15.05.2008).
William Shakespeares Drama "Titus Andronicus", das Ende des 16.Jahrhunderts entstand, arbeitet zum Beispiel mit grausigen Darstellungen von nicht weniger als vierzehn Morden, neun davon auf der Bühne, sechs abgeschlagenen Gliedmaßen, drei Vergewaltigungen und einem Fall von Kannibalismus, durchschnittlich eine Grausamkeit pro 97 Verse, wie der Kritiker Clark Hulse genau auszählte, und T.S.Elliot nannte es "das schlechteste Stück, das je geschrieben wurde". Harold Bloom war allerdings der Meinung, Shakespeare habe mit dem Stück die kaum weniger grausamen und blutigen Stücke seines Konkurrenten Christopher Marlowe parodieren wollen, der allerdings z.B. in "The Massacre at Paris" auch nur wirklich Geschehenes abgebildet hatte (vgl. Wikipedia:Christopher Marlowe, Wikipedia:The Massacre at Paris, abgerufen am 04.01.2008).
Während der viktorianischen Epoche war Shakespeare's Stück andererseits sehr gehaßt (vgl. Wikipedia: "Titus Andronicus", abgerufen am 04.01.2008). Die viktorianische Zeit wird - verkürzend zwar, aber gern genommen - als Zeit einer restriktiven Moral - z.B. der Aufprägung der rigiden Moralvorstellungen der Herrschenden auf die Bevölkerung -, gleichzeitig aber durch deren Heuchelei gekennzeichnet gesehen (vgl. Wikipedia: Victorian morality, abgerufen am 15.05.2008): Zu dieser Zeit, in welcher sich Großbritannien ständig im Krieg befand, um sein Herrschaftsgebiet zu erweitern, war man andererseits bestrebt, die reale Grausamkeit aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen - so wurden Hinrichtungen seit 1868 nicht mehr öffentlich durchgeführt (vgl. Encyclopedia Britannica: Capital Punishment, abgerufen am 15.05.2008) -, und wollte auch die fiktive Grausamkeit nicht sehen, weil sie dann doch zu sehr an die reale Grausamkeit erinnerte, die zur höheren Ehre Großbritanniens ausgeübt wurde. Damit zeigte sich, daß die Gesellschaft letztlich nicht sehen wollte, daß ihre eigene scheinbare "Moral" in der Tat mit moralischer Verworfenheit erkauft war. Dadurch, daß sie erst den Lebensstandard ermöglichte, wurde die Gewalt erst recht zu einem wichtigen Teil der viktorianischen Kultur. Man müßte also die These äußern, daß eine Gesellschaft, die Gewaltdarstellungen verteufelt, dies tut, weil sie die Gewalt, die sie selbst ausübt, nicht wahrhaben oder nicht rechtfertigen will (siehe dazu I.2.1.16.3). Auf die konservativen Medienkritiker übertragen, die recht häufig passionierte Jäger sind, sich also gewissermaßen zum "Freizeitvergnügen" mit dem realen Töten beschäftigen, mag ihre Ablehnung von Gewaltdarstellung daran liegen, daß sie nicht wahrhaben wollen oder können, daß ihre "Ertüchtigung" von Anderen als ebenso verworfen angesehen werden könnte, daß der Lebensstil, für den sie Menschen geißeln, daß sie diesen verinnerlicht haben, bisweilen sogar derjenige ist, den sie selbst als kulturelles Ideal hochgehalten und propagiert bzw. hergestellt hatten (vgl. dazu Fuchs 2007, S.4).
3. So gehaßt wie Shakespeare wurde auch Goethes autobiographisch eingefärbter Briefroman "Die Leiden des Jungen Werthers" nach seiner Veröffentlichung im Jahre 1774. Und vielleicht muß man entsprechend den ganzen "Sturm und Drang", also den jungen Goethe genauso wie Schiller, Lessing und Andere, letztlich auf die Darstellung der (insbesondere sexuellen) Affekte und den Widerstand gegen von gottgewollte Autorität geißeln und in der Luft zerreißen. So geißelte der Theologe Lavater den "Werther" als als "jeglichem Anstand zuwider", eine theologische Fakultät forderte mit der Begründung des Buches, es verleite zum Selbstmord, und Johann Melchior Goeze schließlich sogar, daß man das Buch nicht lesen könne, "ohne ein Pestgeschwür davon in seiner Seele zurück zu behalten, welches gewiss zu seiner Zeit aufbrechen wird". Mit anderen Worten: Wer dieses Buch lese, bringe sich früher oder später zwangsläufig um. Medienkritiker propagieren diese Zwangsläufigkeit heute ebenfalls in Bezug auf Computerspiele: Dave Grossman will - analog zur letztlich tödlichen Immunschwäche AIDS - ein Krankheitsbild namens "AVIDS" geprägt sehen, und auch Elke Ostbomk-Fischer vergleicht Computerspiele mit Landminen.] Viele Kritiker würdigen Autor und Buch nicht einmal derer korrekten Schreibung. Goethe räsonierte später, daß er mit seinem Roman offenbar das Empfinden seiner eigenen Generation und auch die davon abweichenden Werthaltungen der Altvorderen getroffen hatte (vgl. Wikipedia: Die Leiden des Jungen Werthers, abgerufen am 28.11.2007).
4. Auch das Theater wurde zu seiner Zeit nicht wohl gelitten. Dabei wurden verschiedene Beweggründe angeführt. In früher Zeit wurden Schauspieler kritisch beäugt. Bereits die frühchristliche Literatur verdammte mit den nichtchristlichen Philosophen auch die Schauspieler und stellte sie auf eine Stufe mit Verbrechern (vgl. Wikipedia: Bücherverluste in der Spätantike, abgerufen am 27.05.2008). Noch bis zum Ende des Mittelalters wurden sie kritisch beäugt, da sie umherzogen wie Wegelagerer; sie dadurch, daß sie Adlige spielten und dafür ggf. in ihren Kostümen Elemente verwendeten, die Untertanen nicht "anstanden"; und überhaupt Personen darstellten, die sie nicht waren.
Schließlich kann auch eine Kritik an den Inhalten formulieren: So war etwa das elisabethanische Theater ausgesprochen blutig und derb. Dies lag auch daran, daß die Gesellschaft seiner Zeit durch alle Schichten hindurch Vergnügen an extrem blutigen realen Geschehnissen wie Ritterturnieren, Hinrichtungen oder Tierkämpfen fand, und entsprechend blutig auch im Theater unterhalten werden wollte. Überliefert sind etwa die Verwendung von Tierblut und -organen zur Untermauerung des Grusels, wenn im Stück jemand umgebracht wurde, und der Einsatz pyrotechnischer Effekte (vgl. "Rätsel der Vergangenheit: Das elisabethanische Theater", "The History Channel", 26.05.2008). Dennoch stellte das Theater im Vergleich zu den anderen "Vergnügungen" eine "Humanisierung" dar, da die realen Grausamkeiten durch Simulationen ersetzt wurden.
Im Rom der Barockzeit wurde die sogenannte "commedia dell'arte" verboten (vgl. Lattarico 2007, S.8). Zunächst schien diese Form der Unterhaltung nicht besonders hochstehend zu sein, handelte es sich bei der "Berufsschauspielerei" doch primär um Improvisations- und Typenkomödien, die mit einstudierten komödiantischen Nummern aufgefüllt wurden (vgl. auch Gier 2000, S.492). Allerdings wurde dabei auf antike Vorbilder, so etwa die griechisch-lateinischen Komödien von Plautus und Terentius, zurückgegriffen, und lieferte die "commedia dell'arte" andererseits auch Vorbilder für Theaterstücke Shakespeares und Molieres (vgl. Wikipedia: Commedia dell'arte, abgerufen am 06.04.2008), die beide heute doch als Glanzlichter unter den Autoren ihrer jeweiligen Sprachen gelten.
Zur Zeit der Aufklärung wurde im deutschen Sprachraum solches Theaterspiel als "Haupt- und Staatsaktion" bezeichnet. (vgl. ).
Von daher ist nun die kategorische Ablehnung und Verdammung von Formen nicht zielführend. Andererseits hatte jenes päpstliche Verbot auch nicht die Konsequenz, daß hier eine "bessere" Form entstanden wäre;
5. So verlagerte sich mit dem Verbot der "commedia dell'arte" nun der Focus der Entwicklung auf das Musiktheater (vgl. Lattarico 2007, S.8). In der sogenannten "opera buffa" der Barockzeit wurde in der Regel das sogenannte "lieto fine" gepflegt, in welchem sich Verwirrungen und negative Gefühle am Ende auflöste und Schurken am Ende bekehrt wurden. Dies wurde dadurch gerechtfertigt, daß negative Beispiele wegen der "sinnlichen Unmittelbarkeit" des Theaters moralisch weniger gefestige Zuschauer zu problematischen Handlungen verleiten könnten (vgl. Gier 2000, S.117f.). Allerdings ist diese Kritik eine Einstellung, die ab dem 19.Jahrhundert an Bedeutung verliert, da Geschichten nicht mehr als Vorrat moralischer Beispiele gesehen werden, und sie entstammt auch einem eher niedrigen Stilniveau (vgl. ebd., S.117f. und Anmerkungen dazu). John Gay kritisiert im Finale seiner "Beggar's Opera", die doch für die Protagonisten ein negatives Ende haben müßte, den Zwang zur Durchführung eines positiven Endes (vgl. II.3.2.1.2). Daneben steht das Spiel mit moralischen Beispielen in dem Ruch, die bestehende (in dem Falle absolutistische) Ordnung zu verherrlichen, indem etwa der Herrscher als moralisches Beispiel für seine Untertanen dargestellt wurde (vgl. ebd., S.122).
6. Im 19.Jahrhunderts wurden ähnliche Befürchtungen auch über das Lesen geäußert. So wurde die "Lesesucht" als eine echte Gefahr angesehen, die zu einem Realitätsverlust führe (vgl. Wikipedia: Lesesucht, abgerufen am 20.09.2007). Da man davon ausging, daß das Lesen "an sich" eine Vorstellungswelt im Kopf schaffe, "die nicht gut ist und womöglich zu Handlungen führt", wurden damals nicht allein "Schundromane", sondern Bücher an sich problematisiert und ihr Konsum reglementiert (vgl. "Ich knall euch ab", abgerufen am 14.03.2008). Ähnliche Befürchtungen wurden in späteren Jahrhunderten auch zum Beispiel für das "Kientopp" und bezüglich Comics geäußert. Von jenen wurde behauptet, sie verführten ihre Leser zur Homosexualität (vgl. Rhodes 2001, S.4).
2.1.1.2 Kriegsspielzeug
Vermutlich seit Beginn der menschlichen Gesellschaften spielten Kinder mit Kriegsspielzeugen. In einer deutlich kritischen Definition von Gugel werden alle Gegenstände als Kriegsspielzeuge bezeichnet, die militärische Ausrüstung darstellen oder nachbilden, sowie auch "elektronische Kriegs- und Jagdspiele und Strategiespiele", deren Ziel die Zerstörung des Gegners sei. In seiner Vorstellung sind bereits per definitionem diese Gegenstände dazu geeignet, Phantasien über Kampfhandlungen hervorzurufen oder zum Nachspielen anzuregen (vgl. Gugel 1983, S.82; zitiert nach Greim 1994/2004, S.13f.). Insbesondere aber wollen wir uns hier auf nichtelektronische Spielzeuge konzentrieren.
(2.1.1.2.1 Waffenähnliche Gegenstände)
2.1.1.2.2 „Befreien Sie Afrika“ - Brettspiele
[…] Man kann diese Spiele letztlich auf die gleiche Weise beschreiben und als "kompetitiv-elimanatorische Varianten" oder „Killerspiele“ kategorisieren wie Medienkritiker dies tun.
So wäre damit hier sehr die Frage, welche Lehren genau vermittelt werden sollen. Medienkritiker scheinen davon auszugehen, daß Lehren sich grundsätzlich nur direkt auf das Dargestellte beziehen, daß man also zum Beispiel durch das Spielen von „Counterstrike“ nur den Gebrauch von Waffen und die Vornahme von Amokläufen lernen könne, und auch wurden in der Vergangenheit schon brettspielähnliche Strategiespiele wie „Panzer General“ dahingehend problematisiert, dadurch könnten Spieler dazu angeregt werden, Angriffs- und Vernichtungskriege wie den dort dargestellten zweiten Weltkrieg als positiver anzusehen. Wenn man aber Spiele wie Schach, Monopoly et cetera auf die gleiche Weise betrachtet, erkennt man nicht direkt einen „pädagogischen Wert“, sondern eher ebenfalls das Bestreben, den Gegner zu übervorteilen.
a) Schach
Das Ziel des Schachspiels ist es, „das Ich des Gegners zu unterwerfen, sein Ego zu zerbrechen und zu zermalmen, sein Selbstbewusstsein zu zertreten - und es zu verscharren, und seine ganze verachtenswerte, so genannte Persönlichkeit ein für alle Mal zu Tode zu zerhacken..“ (Bobby Fischer, zitiert nach www.heise.de, abgerufen am 15.06.2009)
„Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich sehe, wie
sich mein Gegner im Todeskampf windet.“
(Bobby Fischer,
zitiert nach „Anekdoten
und Sprüche aus dem Schach“, Schachfreunde Korbach,
2003, S.42)
Den meisten Menschen vielleicht eher unbekannt ist, daß Schach im Kern ein Spiel ist, das taktische Fähigkeiten schulen sollte (vgl. etwa das Zitat von Ibn ul Mutazz in Pfleger 2002, S.838). Die einzelnen Figuren stellen Truppen dar, die sich auf dem Schlachtfeld bewegen, und auch der zentrale Begriff „Schachmatt“ bedeutet in der Übersetzung „Der König ist tot“. Nun wurden in Europa keine militärischen Einheiten als „Turm“, „Springer“ oder „Dame“ bezeichnet. Allerdings handelt es sich dabei zum Teil um Falschübersetzungen – so ist die „Dame“ möglicherweise so benannt, weil ein französisch sprechender Reisender, dem man das Spiel vorstellte, das Wort „Vesir“ als „vierge“, Jungfrau verstand (). Andererseits stellt die chinesische Variante diesen militärpädagogischen Ursprung mit Figurennamen wie etwa der „Kanone“ heraus (). Auf einem mittelalterlichen Beichtzettel beklagte ein Mönch bitterlich, daß er sich diesem sinnlosen Zeitvertreib hingegeben habe, daß er dem Spiel gar suchtartig verfallen sei (vgl. „Freistil: Zug um Zug. Schach – eine Geschichte einer Leidenschaft“, DLF, 07.06.2009). Der Arzt Maimonides sah die Aussagen von Schachspielern vor Gericht nicht als glaubhaft an, und der passionierte Schachspieler Papst Innozenz III. sah Schach durchaus als gewaltfördernd an (vgl. Pfleger 2002, S.839). Und auch Bobby Fischer, der im Laufe seines Lebens immer exzentrischer werdende ehemalige Schachweltmeister, der sich auch des öfteren in antisemitischen Anwandlungen erging, hatte schließlich diese differenzierte Haltung zum Schachspiel geäußert.
Diese „Argumente“ waren von Medienkritikern auch gegenüber Computerspielen und -spielern geäußert worden, vergleiche etwa Christian Pfeiffers Einlassung vom „sinnlosen Verdaddeln und Zeit“, oder die Beurteilungen des Charakters von Spielern, die Regine Pfeiffer oder – ganz prägnant – Sabine Schiffer präsentierten, und auch die mannigfaltigen Wiederholungen der These, Computerspiele förderten die Gewaltbereitschaft und führten zur Kriminalität. Letztlich war also alle Spielekritik auch schon vor achthundert Jahren gegeben.
b) „Risiko“
Das Spiel „Risko“ stellt schließlich das Militärische auf der Ebene von Ländern und Armeen dar, die auf einer Landkarte verschoben werden können. Der Spieler kann nur dadurch gewinnen, daß er seine Gegner durch Einnahme von Ländern besiegt. In Form von Ereigniskarten werden ihm Aufgaben zugeschanzt, er solle bestimmte Weltregionen „befreien“, Angriffe werden als "diplomatische Verhandlungen" dargestellt. Das eigene gewalttätige Tun wird also durch eine angeblich „gute Sache“ gerechtfertigt, die dahinterstehende Gewalt aufgrund des hohen Symbolisierungsgrades gar nicht erst dargestellt. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß "Risiko" in Deutschland 1982 von der Indizierung bedroht war, weil in älteren Fassungen eine realistische Sprache verwendet worden war, in der als Auftrag die Eroberung anderer Länder und die Vernichtung des Gegners explizit genannt wurde (vgl. Wikipedia: Risiko (Spiel), abgerufen am 05.07.2009). Im Sinne der "geistig-moralischen Wende" mußte also die Realität letztendlich versteckt werden. Andererseits müßte man vielleicht auch kritisieren, daß damit eine Rückkehr zur Haltung von Clausewitz instrumentiert wird, "Krieg [sei] die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" (). Wenn schließlich Medienkritiker die eine (kaum symbolisierende) wie die andere (euphemistische) Sprachform kritisieren, ist das erst recht nicht glaubwürdig.
c) „Monopoly“
„Monopoly“ schließlich simuliert letztlich in einem extremen Kapitalismus. Der Spieler kann dadurch gewinnen, daß er die anderen Mitspieler ruiniert. Zumindest ein Fall ist dokumentiert, in dem ein Monopolyspieler nach einem verlorenen Spiel seinen Gegner tötete (vgl. Wikipedia: Monopoly, abgerufen am 24.06.2009).
Aus dieser Betrachtung, die zugegebenermaßen mit einem gewissermaßen „pornographischen Blick“ erfolgt, sollte eigentlich klar werden, daß der letztliche „pädagogische Wert“ oder Gewinn, den der Spieler daraus zieht, auf einer anderen Ebene liegen würde, so etwa im Erlernen der Zusammenarbeit im Team oder in sozialer Kommunikation, oder daß eine Aktivität wie das Spielen durchaus auch einmal zweckfrei sein kann. Zum anderen lernt man aus einer solchen Betrachtung, daß eine dermaßen grundsätzliche Pathologisierung ziemlich haltlos zu sein scheint.
d) Das „Taktische Kriegsspiel“ von Georg Leopold von Reiswitz
Der preußische Kriegsrat Georg Leopold von Reiswitz und sein Sohn Georg Heinrich Rudolf entwickelten zur Zeit der „napoleonischen Kriege“ ein sogenanntes „taktisches Kriegsspiel“. 1824 wurde das Spiel zum offiziellen Trainingswerkzeug der preußischen Offiziere. Von Reiswitz hatte explizit die Möglichkeit realisiert, Modelle von Landschaften zu konstruieren und an diesen Strategien und Taktiken zu üben. Hierzu wurden bemalte viereckige Steine, auf die Ausschnitte von Landkarten oder Geländebausteine wie stilisierte Flußläufe aufgebracht waren – wobei durchaus Höhenmerkmale als Erhebungen und Vertiefungen ausmodelliert wurden – aneinander gesetzt. Darauf konnten Spielsteine gesetzt wurden, die beispielsweise militärische Einheiten oder Gebäude darstellten. Für militärische Einheiten wurde bereits eine Vielzahl von Charakteristiken wie Stärke, Einfluß des Terrains auf die Bewegungsfreiheit und -geschwindigkeit, Ermüdung, Sichtkontakt zu anderen Einheiten, Kontakt zum Befehlshaber oder die Wirkung von Geschossen modelliert. Durch Würfel konnten Zufallselemente in die Betrachtung mit eingebracht werden.
Das Spiel wird im entsprechenden „Spiegel“-Artikel als einer der Urahnen heutiger Pen-and-Paper- oder computerisierter Rollenspiele oder Strategiespiele bezeichnet (vgl. "Wie preußische Militärs den Rollenspiel-Ahnen erfanden", abgerufen am 23.06.2009). Dabei sah man allerdings auch nicht die Parallele zwischen damals schon existierenden militärischen Taktikspielen und schließlich dem Schachspiel. Vor der Einführung des „taktischen Kriegsspiels“ hatte das Militär in der Regel rein abstrakte Spielfelder verwendet. Diese konnten aber die Realitäten des Krieges wohl nicht mehr abbilden, weil sich Armeen zu dieser Zeit nicht mehr bloß auf dem Schlachtfeld trafen wie etwa noch im Mittelalter (vgl. Wikipedia: Herald, abgerufen am 23.06.2009), sondern auch ihre Bewegung auf der Landkarte von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer militärischen Kampagne war. Napoleons Truppen hatte zum Beispiel die österreichische Armee ausmanövriert und schließlich in Ulm festgesetzt, so daß diese kapitulieren mußte (vgl. Wikipedia: Ulm Campaign, abgerufen am 23.06.2009), und die Preußen die Truppen des französischen Marschalls Grouchy vom Schlachtfeld von Waterloo fortgelockt und damit den Sieg gegen die Franzosen bei Waterloo ermöglicht (vgl. Wikipedia: Waterloo Campaign, abgerufen am 23.06.2009). Die Möglichkeit, ein abstraktes Feld zu verwenden, bestand bei dem Spiel von Reiswitz aber auch weiterhin. Und schon solche Spiele boten die Möglichkeit, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen (vgl. von Hilgers 2000, S.61). Andererseits wollte der Journalist aber diese Parallele wohl nicht sehen.
2.1.1.2.3 Physische Spiele
So gut wie alles, was heute an „Ertüchtigungen“ hochgepriesen, von den Politikern sogar gefördert und von jeglichem Verdacht freigesprochen, hat, wenn man es genauer untersucht, den Hintergrund der militärischen Ertüchtigung. Dies beginnt bei Kontaktsportarten wie Boxen oder Ringen, aber auch Fechten war ganz offenbar eine militärische Disziplin. Im England des hohen und späten Mittelalters war Bogenschießen für alle wehrfähigen Männer sogar vorgeschrieben, da immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden und für die Engländer der effektive Einsatz des Langbogens häufig die Schlacht entschied. Auch Schützenvereine sind nicht entstanden, weil Menschen sich für grüne Uniformen, Blasmusik und Scheibenschießen begeisterten, sondern wurden zum Beispiel als Bürgerwehren gegen Strauchdiebe gegründet, oder sind aus militärischen Einheiten entstanden, die während der „Befreiungskriege“ gegen Napoleon ausgehoben worden waren – mit „Schützenfesten“ und Ähnlichem feiert man also im Grunde kämpferisches Vorgehen und militärische Traditionen. Während dieser Zeit wurden auch Jäger rekrutiert, um zum Teil mit Guerilla-Taktiken gegen die verhaßten Franzosen und ihre Verbündeten vorzugehen. Eine „Tötungshemmung“ bestand damals jeweils nicht unbedingt, weil entweder der Gegner gehaßt und in den eigenen Augen nichtswürdig war – es eben auch „Sitte“ war, Räuber aufzuhängen; man dies doch „um der guten Sache willen“ tat; oder man die Schußbahn des eigenen Pfeils oder der eigenen Kugel unter den hunderten Pfeilen, die in einer Schlacht durch die Luft flogen, nicht verfolgen und man sich so notfalls einreden konnte, daß diese gerade nicht getroffen hatte. Auch die Erfahrung im Töten von Tieren konnte durchaus helfen.
Der legendäre „Turnvater Jahn“ gründete seine Turnerbewegung ebenfalls mit dem Bestreben der militärischen Ertüchtigung. Junge Männer sollten bei heute noch üblichen Disziplinen wie Laufen, Barrenturnen oder Ringen körperlich und nicht zuletzt auch weltanschaulich auf die Strapazen des Militärischen vorbereitet werden. Schließlich wurde selbst das Fußballspiel um die Wende des 20.Jahrhunderts als „Kampfspiel“ begriffen, das zum Beispiel von der deutschen Armee ganz bewußt eingesetzt wurde, weil man der Meinung war, daß Rekruten dadurch die „nötige Aggressivität“ vermittelt werden könne. Und nicht zuletzt gebrauchte auch die paramilitärische „Gesellschaft für Sport und Technik“ in der DDR eine Version der berüchtigten „Kalaschnikow“ mit Sportwaffenmunition zur „militärischen Ertüchtigung“ (vgl. Wikipedia: AK-47, abgerufen am 20.08.2009), bzw. sind auch andere „Sportwaffen“ von militärischen Waffen kaum zu unterschieden (vgl. Wikipedia: Sturmgewehr 90, abgerufen am 20.08.2009).
Nun könnte man in der Art der rhetorischen Taschenspielertricks, daß man ja kein Baum sein müsse, um den Wald zu schützen, einwenden, daß wir heute nicht in der Zeit der „Befreiungskriege“ leben. Wenn nun aber Spiele wie „Paintball“, „Laserdrome“, aber auch Computerspiele wieder einmal als gefährlich und „entwürdigend“ dargestellt werden und auf dieser Basis geächtet werden sollen, so muß auch der Rhetoriker zugeben, daß diese Zuschreibungen zeitabhängig sind.
Umgekehrt galten noch vor gerade etwas mehr als 140 Jahren öffentliche Hinrichtungen als „Belustigungen“, zu denen man auch seine Kinder mitnahm, und gab es in England Proteste dagegen auch mit diesem Argument, daß seit 1868 Hinrichtungen nicht mehr öffentlich durchgeführt wurden (vgl. Abbott 2006, S.265).
Im Zusammenhang mit dem Fußballspiel gibt es ansonsten die Anekdote von einem „Weihnachtswunder an der Front“, daß nämlich an Weihnachten 1914 Soldaten beider kriegführender Parteien einen Waffenstillstand vereinbarten, sich im Niemandsland trafen und neben dem Austausch kleiner Geschenke auch ein Fußballspiel durchführten. Auch später wurde Fußball, obwohl durchaus auch schon einmal ein Krieg um ein Fußballspiel entbrannt sein soll, eher als Mittel zur „Völkerverständigung“ angesehen. Einige der Charakteristika von Spielen sind ja der „Seitenwechsel“ und die Chance, auch einmal gewinnen zu können. Übertragen wir dies nun vom Fußball auf Spiele, die „im Auftrag“ dafür kritisiert wurden, daß darin „der zweite Weltkrieg fortgesetzt“ werde, so fällt auf, diese sich nicht nennenswert von diesen Bedingungen unterscheiden: Spieler sind dabei nicht auf eine Seite festgelegt, sondern können (oder müssen sogar, weil es die Spielregel erfordert) die Partei wechseln, in der sie spielen, wobei die Zuordnung auch nicht abhängig von der Nationalität des Spielers ist.
2.1.1.3 Pen-and-Paper-Rollenspiele
Auch sog. Pen-and-Paper-Rollenspiele wie das von Gary Gygax erdachte Rollenspiel "Wikipedia: Dungeons and Dragons", in dem Spieler sich in Charaktere hineindenken, die in einer Fantasywelt agieren, wurden in der Vergangenheit angegriffen. Neben Angriffen von Seiten religiöser Fundamentalisten, dadurch werde das Interesse an "schweren Sünden" wie "Teufelsverehrung, Hexerei, [...] Blasphemie, Selbstmord, [...] sexueller Perversion, Homosexualität, [...], Glückspiel" etc. geschürt, gab es auch Vorstellungen, daß Rollenwechsel zum Verlust der Persönlichkeit oder des Realitätssinns führen sollen (siehe dazu auch I.2.2.4), Spieler für Suggestionen empfänglicher seien. Es wurde behauptet, "Dungeons and Dragons" feiere rechtsradikales Gedankengut, weil im sog. "Dungeon Master's Guide" (also der Anleitung für Spielleiter) Adolf Hitler als Beispiel für die Charaktereigenschaft Charisma (Fähigkeit, Andere in seinem Sinne zu beeinflussen) dargestellt wurde (vgl. Wikipedia: "Dungeons and Dragons controversies", abgerufen am 16.09.2008). Damit wurde allerdings nur ausgesagt, daß Hitler unzweifelhaft diese Fähigkeit besaß. Diese kann aber sowohl zum Guten als auch offensichtlich zum Schlechten eingesetzt werden. In zumindest einem Falle wurde "Dungeons and Dragons" schließlich auch für den Selbstmord eines Studenten verantwortlich gemacht. Diese Thesen waren allerdings häfig genug aus der Luft geboren (vgl. Wikipedia: Steam tunnel incident, abgerufen am 16.09.2008).
Um dies darzustellen, wäre es ggf. sinnvoll, ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln, was das Wesen solcher Spiele ist. Die Spieler schreiben in der Auseinandersetzung miteinander die Geschichte ihrer Charaktere weiter. Diese können ganz andere Eigenschaften haben als die Spieler selbst. Die Spieler müssen sich also in ihre Charaktere hineindenken und versuchen herauszufinden, wie diese in dargestellten Situationen handeln würden. Gleichermaßen als Moderator, der das Setting einführt, als "Widersacher", der die Charaktere mit Herausforderungen wie Rätseln und Angriffen konfrontiert, als auch als "Schiedsrichter", der für die Einhaltung der Regeln sorgt, tritt dabei der Spielleiter auf, womit es auch hier keine "Regellosigkeit" gibt. Ein solches System ermöglicht also gleichermaßen die Schulung der Kreativität, der sozialen Interaktion, das Hineinversetzen in das Gegenüber und Fairness.
2.1.1.4 Fernsehen
Bevor Computerspiele in den Focus der Medienkritik gerieten, wurden vorwiegend das Fernsehen für die vermeintlich stark zunehmende Brutalisierung der Jugend verantwortlich gemacht. Dafür bezeichnend ist vielleicht schon der Kommentar eines frühen Zuschauers über die "Qualität" des deutschen Fernsehens, das Ende 1952 seinen Betrieb aufgenommen hatte. Obwohl damals nur wochenschauartige Nachrichten, Kulturfilme, Fußball und unverfängliche Unterhaltung gezeigt wurden, bedauerte einer der damaligen ersten Zuschauer bereits 1953, "dass [die] Technik uns kein Mittel gibt, darauf zu schießen" (vgl. "Wem das Fernsehen dient", abgerufen am 03.01.2008). Insbesondere aber wurden die Zuschauer von Action- und Horrorfilmen in vermeintlichen "Sachberichten" vor ein bis zwei Jahrzehnten ebenfalls als "krank" bezeichnet, und wurde gleichermaßen auf Basis einiger Szenen aus solchen Filmen ein allgemeines Verbot dieses "Schunds" gefordert. Bei genauerer Analyse entpuppten sich allerdings viele der Vorwürfe, daß solche Filme etwa zur allgemeinen Verrohung beitrügen oder spezielle Filme jugendlichen Gewalttätern bestimmte Elemente oder gar komplette Drehbücher spezifischer Gewalttaten geliefert hätten, als Konstruktionen, die weniger von wissenschaftlichen Fakten als vielmehr von Intuitionen getragen waren (vgl. Riepe 2003, S.1f.+5+13). So mag es diese Szenen - als ein "worst of" - tatsächlich geben. Sie sind allerdings a. aus dem Zusammenhang gerissen und stellen b. auch keinen "repräsentativen Querschnitt" dar, sondern entstammen oftmals einer sehr kleinen Auswahl an Materialien (vgl. ebd., S.5), die auch der denkbar schlimmsten Interpretation unterzogen wurden.
2.1.1.4.1 "Mama, Papa, Zombie"
Der im Jahr 1984 im ZDF ausgestrahlte Filmbericht "Mama, Papa, Zombie" von Klaus Bienfait (vgl. ). Von seinem Zuschnitt her war der Beitrag - wenngleich der Autor letztlich räsonierte, daß Verbote von Medien letztlich die angemahnte Problematik nicht lösen können würden, sondern vielmehr Medienerziehung Not tue - deutlich tendentiös und darauf ausgelegt, nicht mehr nur Gewaltvideos, sondern die Videobranche an sich anzuprangern. Er kann damit m.E. durchaus als ein Vorbild für viele Beiträge späterer Medienkritiker angesehen werden. Es seien hier exemplarisch einige Wendungen genannt, um dies aufzuzeigen.
x. In der Schilderung der Historie des Videomarktes wurde bereits darauf hingewiesen, daß Video als ein "Schmuddelkind" im Rotlichtmilieu begonnen habe, und anfänglich vor allem Erotikfilme vermarktet wurden. Die Händler hätten allerdings dadurch versucht, sich ein seriöses Image zuzulegen, daß sie sich - in Anlehnung an die seriöse Bibliothek - "Videothekare" genannt hätten und in die Haupteinkaufsstraßen ihrer Städte gezogen seien. Entsprechend wurde Video als ein Medium und die damit Befaßten als Personen dargestellt, mit denen ein anständiger Mensch sich seriöserweise nicht abgeben dürfe.
x. Einige der Aussagen, die dort von vermeintlich seriösen Zeugen präsentiert wurden, wirken auf viele Zuschauer einstudiert. So berichtete etwa eine angebliche Mitarbeiterin einer Videothek, sie hätte auch schon einmal Kunden gehabt, die offenbar ihren kleinen Kindern wie selbstverständlich Filme vorführen würden, die nur für Erwachsene geeignet seien, so daß diese schwer verhaltensgestört würden. So wurde hier das Schreckensbild eines dreijährigen Kindes gezeichnet, das nur die titelgebenden Worte "Mama, Papa, Zombie" habe sprechen können.
x. .
x. Schließlich begleitete das Kamerateam eine Lehrerin, die während des Unterrichts an ihre Viertklässler die Frage stellte, ob sie denn wüßten, was Zombies seien. Dabei habe sie festgestellt, daß bereits sehr viele der Neun- und Zehnjährigen bescheid wüßten. Dieses für sie bedenkliche Ergebnis nahm die Lehrerin zum Anlaß, um anläßlich eines Elternabends eine Videocassette mit einem Zombiefilm vorzuführen. Mit der Vorführung implizierte sie, daß die Schüler sich ihre "detaillierten Kenntnisse" über Zombies wohl nur aus solchen Machwerken hätten beschaffen können.
Tatsächlich aber muß dies gar nicht der Fall sein. So weiß ich von früher sehr wohl noch, daß auch Kinderzeitschriften wie die "Micky Maus", die keine sonderliche Gewalt enthalten, zum Beispiel in der Zeit vor "Halloween" etwa Geschichten enthalten, in denen durchaus auch Hexen und verschiedene Varianten von Zombies, Geistern etc. vorkommen (vgl. don-mcduck.de, abgerufen am 14.10.2008).
Zum anderen läßt sich aber daraus auch eine Forschungsfrage ableiten. Viele der Eltern im Filmbericht bekundeten nach der Vorführung, sie hätten mit dem präsentierten Material sehr große Probleme gehabt, und bangten auch um ihren Nachtschlaf. Nun habe ich selbst schon festgestellt, daß mir manche Darstellungen in Filmen nahegehen, die deutlich geringere FSK-Einstufungen besitzen (s.u.). Andererseits habe ich mir seinerzeit auch die so im Fernsehen gezeigten Horror- oder Actionfilme eher selten angesehen, so daß man auch nicht recht von einer Abstumpfung sprechen kann. Vielleicht also sind Jugendliche in der Hinsicht generell eine Spur abgehärteter, tendieren andererseits aber Erwachsene dazu anzunehmen, daß jüngere Menschen eigentlich genauso auf das Material reagieren müßten wie sie selbst, und wenn sie dies nicht tun, wohl psychische Probleme haben müßten? Dies ist natürlich auch keine Entschuldigung oder Rechtfertigung dafür, Kindern und Jugendlichen (ggf. im Rahmen der eigenen Reifung) Material vorzuführen, das für sie nicht geeignet ist.
2.1.1.4.2 Kapitalismuskritik oder faschistoides Machwerk? Der Film "Zombie"
[Besprechung des Films "Zombie"].
2.1.1.4.3 Werner Glogauer und der Fall "Jamie Bulger"
Angesichts eines 1993 in Großbritannien geschehenen Mordes, den zwei Zehnjährige an einem Zweijährigen begangen hatten, verkündete etwa der "Spiegel", ein bestimmter Film habe die Jungen so "verwirrt[.] [...], daß sie den [Z]weijährigen [...] umbrachten". Der Medienkritiker Werner Glogauer behauptete aufgrund einer vagen "Ahnung", dieser Film, den er sich vielleicht nicht einmal angesehen hatte, und dessen Handlung und Darstellungen doch recht erheblich von den Umständen der Tatbegehung abweichen, habe den Kindern ein präzises Drehbuch für ihre Tat geliefert (vgl. ebd., S.9+13). Man konnte auch einfach mal etwas behaupten, denn wer sollte aufgrund der allgemeinen Hysterie, die wieder einmal geschürt worden war, zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, daß eine Durchsicht der 200 Videofilme aus den Elternhäusen der Jungen, weder nennenswert gewalthaltige Filme noch Filme erbracht hatte, die in irgendeiner Form als Vorbild für die Tat hätten dienen können (vgl. ebd., S.10).
Insbesondere aber stellt Riepe (2003) fest, daß die Propagandagebäude, die Journalisten und Medienkritiker erschaffen, indem sie Material derart bis zur Unkenntlichkeit sezieren und neu zusammensetzen, eine ausgesprochene Faszination für das Dargestellte zu atmen scheinen (vgl. S.4).
Auch werde mit Zahlenmaterial gearbeitet, das im Einzelfall gar nicht mehr nachvollziehbar ist. So behauptete Jo Groebel etwa, daß der durchschnittliche Zuschauer pro Tag nicht weniger als 70 Bildschirmmorde ansehe. Dabei erging man sich allerdings indiskrimit in "Leichenzählerei" und konstruierte daneben einen "fiktiven" Zuschauer, der 21 Stunden am Tag auf mindestens fünf Kanälen gleichzeitig fernsah (vgl. Riepe 2003, S.13-17). Synthetisch behauptete Manfred Spitzer, daß der Gewaltanteil am Fernsehprogramm heute 80% betrage (vgl. "Wer weniger fernsieht, wird schlauer", abgerufen am 23.11.2007). Schließlich verstiegen er und Glogauer sogar zu Aussagen, daß andererseits mindestens 10% aller Gewaltverbrechen durch Medienkonsum verursacht worden seien (vgl. Riepe 2003, S.13; Frank 2005, S.2).
Allerdings haben auch gewaltdarstellende Filme keine "Kultur der Gewalt" geschaffen. Die Zunahme an Filmen mit Gewaltdarstellungen in den letzten Jahrzehnten ist zunächst eher mit einer Zunahme der pazifistischen Grundstimmung erklärt worden (vgl. Scherz 2003, S.41f.). Es hat also hier im Gegensatz keine Prägung der Kultur durch die Medien stattgefunden, sondern erstens waren die Medien immer Abbildung und Ausfluß der Kultur, und zweitens war der Selektionseffekt dann sogar anders herum ausgeprägt, daß nämlich eher friedliche Menschen sich durchaus für Krimis oder Abenteuerfilme begeistern konnten.
2.1.1.4.4 Neil Postman
Neil Postman ist für viele der Medienkritiker schlechthin, der letztlich eine Universalkritik an der Kommunikationstechnologie formulierte. Exemplarisch will ich hier nur zwei „Argumente“ präsentieren, die Postman in prägnanten Werken wie „Wir amüsieren uns zu Tode“ formuliert hatte.
Schreckliche neue Technologie
So kann eine Technologie es den Kritikern gar nicht recht machen, weil schon die Intention, mit der sie eingeführt wurde, als falsch und das menschliche oder organisatorische Bedürfnis, das dahintersteht, in Abrede gestellt werden. Bei der Kritik geht es damit nicht so sehr um die Konsequenzen, sondern um das Vorhandensein des Mediums. Im Sinne dieser Universalkritik ist es natürlich erforderlich, auch „totale Aussagen“ zu machen, die nicht mehr einzelne Auswüchse, sondern das Medium selbst als Urheber von tatsächlichen oder imaginierten gesellschaftlichen Problemen kritisieren. Da Kritiker in einem Medium ohnehin nur diesen einen Zweck sehen können, ergeben sich dann auch keine Verbesserungsvorschläge, sondern nur die Forderung nach der Abschaffung.
1. Postman hatte bereits die erste „Technologie“, mit der Menschen schneller kommunizieren konnten, als sich einer von ihnen bewegen konnte, die Telegraphie, dafür kritisiert, daß dadurch die Qualität der Kommunikation gelitten, die Menschen sich auf Kurzformen und triviale Belanglosigkeiten verlegt hätten (vgl. "Neil Postman: Was das Böse am Fernsehen ist und wie unsere Gesellschaft verblödet", abgerufen am 23.02.2009).
Allerdings war das Medium „Telegraphie“ von Anfang an gerade für die Kommunikation kurzer Nachrichten gedacht gewesen, die Betriebsabläufe koordinieren sollten. Der erste Hauptzweck war hier die Koordination des Bahnverkehrs gewesen: Um Unfälle zu vermeiden, mußten Verspätungen und Zugläufe weitergemeldet werden. Entsprechend vollzog sich mit der Erschließung durch Bahnstrecken auch die Erschließung durch den Telegraphen (vgl. Steinmann+Schreyögg xxxx, Kap.1). Die zu der Zeit bedingt durch die händische Eingabe noch geringe Übertragungsgeschwindigkeit und die relativ hohen Kosten ließen auch für die private Kommunikation natürlich die Übermittlung von mehr als dem Nötigen nicht zu.
Dem Medium nun aber den Zweck vorzuhalten, für den es geschaffen wurde, erscheint mir abwegig. Schließlich wäre demnach auch das Telefon ein ganz schreckliches Medium, weil es die schriftliche Kommunikation zerstört habe, oder E-Mail, weil die Menschen nun nicht mehr mit der Hand schrieben.
2. Das Argument hört aber hier nicht auf, sondern ergibt erst in einer parallelen Betrachtung der Argumentationen von Medienkritikern einen viel perfideren Sinn: So hatte Neil Postman für die Telegraphie kritisiert, die Menschen hätten sich auf kurze Kommunikation verlegt, für das Fernsehen eine Verflachung und Verkürzung von Inhalten. Andererseits hatte Manfred Spitzer das Internet dafür kritisiert, es stelle eine derartige Informationsflut dar, daß die kein Mensch mehr aufnehmen könne. Spitzers Argument ist eben gerade das Gegenteil von Postmans Argument. Hätte also ein Telegraph lange Mitteilungen schnell kommunizieren können, oder würde das Internet in Zukunft auf alle Fragen, die man haben kann, nur knappe vorgefertigte Antworten liefern, so wäre es ebenfalls dem Kritiker nicht recht. Damit kann das Medium die Forderung, die der Medienkritiker an es hat, gar nicht erfüllen.
3. „Du sollst nichts voraussetzen“.
…
Will man es ganz weitertreiben – wobei ich mir nicht einmal mehr sicher bin, ob dies tatsächlich ein Strohmann wäre -, müßte man andererseits völlig auf überhaupt irgendwelche Darstellungen verzichten, die von irgendeinem Menschen nicht wahrgenommen werden könnten. Visuelle Darstellungen eignen sich nicht für Blinde, akustische nicht für Gehörlose. Entsprechend dürfen sie dann auch nicht für Nicht-Blinde bzw. Nicht-Gehörlose eingesetzt werden.
2.1.1.5 Elektronische Spiele
Als ein weiteres Beispiel für die These, daß Medien indem auch Ausfluß der herrschenden Kultur sind, diene die Historie des Computerspiels. Nach Sabadello (2006) wurde im Jahr 1947 das erste elektronische Spiel patentiert. In diesem hatte der Spieler die Aufgabe, durch Drehung von Knöpfen die Flugbahn einer simulierten Rakete so zu verändern, daß damit bestimmte Zielmarkierungen getroffen wurden. Die Idee, einen Flugkörper mit einer Rakete zu treffen, war hier nicht durch Computerspiele erfunden worden, sondern war der "Kriegswirklichkeit" entlehnt worden (vgl. Sabadello 2006, S.8-10).
Der erste "Game Designer", der sich Gedanken darum machte, wie man ein Spiel interessant gestalten kann, war Steve Russell. Für sein "Spacewar!" aus dem Jahre 1962 hatte Russell eine Thematik aus dem von ihm favorisierten literarischen Genre der Science-Fiction verwendet, nämlich den simulierten Kampf zwischen zwei Raumschiffen (vgl. Sabadello 2006, S.12f.). Auch hier ist damit in dem Sinne kein Inhalt neu "erfunden" worden, sondern wurde lediglich eine schon bekannte Thematik auf eine andere Art abgebildet.
2.1.1.6 Ein kurzer Ausblick auf zentrale Thesen der heutigen Medienkritiker
Aus diesen Kritiken an der Medienkritik hatte man allerdings nicht gelernt, sondern wann immer etwas Neues passiert, das auf den ersten Blick auch nur marginal auf die eigenen Argumentationen zu passen scheint, bringt man sich wieder ins Gespräch. Thesen, die immer wieder wiederholt werden, hämmern sich so ins Gedächtnis, ganz gleich, ob sich dabei um objektiv nachweisbare Sachverhalte handelt. So wurde von "Frontal" und anderen Magazinen schon lange vor etwaigen Amokläufen - man darf nicht vergessen, daß Egoshooter wie "Doom" schon etliche Jahre vor den "school shootings" in Littleton, Erfurt oder Emsdetten aufgetaucht waren und in der Zwischenzeit keine medienwirksamen "school shootings" stattgefunden hatten - behauptet, bei "Doom" handle es sich um ein "Trainingsprogramm für Amokläufer" (). Dave Grossman zog etwa aus einer strukturellen Ähnlichkeit - ein jugendlicher Amokläufer habe stets in dieselbe Richtung gezielt, in die er geblickt habe -, die allerdings insbesondere bei einem unsicheren und ungeübten Schützen, der seine Trefferquote steigern will, vielleicht naheliegend ist, die Behauptung, der Schütze habe zuvor mit "Doom", in dem diese Perspektive eingenommen wird, das Amoklaufen "eingeübt" (). Ein anderer Vertreter der medienkritischen Zunft ist Christian Pfeiffer, der bei Gewaltereignissen, das mit Jugendlichen in Verbindung gebracht wird, schnell mit der Behauptung bei der Hand ist, nur Computerspiele könnten dafür verantwortlich gewesen sein (vgl. "Wie Herr Pfeiffer fast einen Amoklauf verhindert hätte", abgerufen am xx.xx.2008). Er meint, jeder der Amokläfer der letzten Jahre habe seine Tötungsphantasien "exzessiv [...] virtuell geübt" (vgl. Kriminologe: "Muster für Amokläfe ist immer ähnlich", abgerufen am 23.09.2008). Es ist allerdings sehr die Frage, in wieweit dies dem Faktischen entspricht. So hatten die Untersuchungen der "Safe School Initative", die nach dem Amoklauf zweier Jugendlicher in Littleton ins Leben gerufen worden war, im Vergleich mit Befragungen zur Freizeitgestaltung von Jugendlichen im allgemeinen aufgezeigt, daß jugendliche Amokläfer eigentlich besonders wenig spielen (vgl. I.2.2.2). Sinnigerweise hatte Pfeiffer nie zur Kenntnis genommen, daß die jugendlichen Amokläfer vor ihren Taten z.B. intensiv auf Schießständen oder im Wald geübt und diese Übungen zum Teil auch noch auf Video dokumentiert oder auch noch weitere psychopathische Videobotschaften hinterlassen hatten, und entsprechend in keinem Falle eine Verschärfung des Waffenrechtes gefordert (vgl. "Deutschland: Union fordert schärferes Waffenrecht" (Pfeiffer: "Killerspielverbot statt verschärftem Waffenrecht gefordert"), abgerufen am 23.09.2008) -- sinnigerweise ziemlich konsistent mit Personen, die passionierte Jäger sind, und ganz so, als würde man in der realen Welt nicht mit Waffen morden, sondern mit Computerspielen. So hatte Pfeiffer letztlich eine ganze Reihe von Indikatoren oder selbst gefährlichen Verhaltensweisen in Abrede gestellt und eine monokausale Erklärung aufgezogen, daß ein Jugendlicher, egal wieviel Leidensdruck er auch empfinden mag, nur durch Computerspiele zu einem Amokläfer werden könne.
(Nun kann man nicht pauschal alle Jäger und Schützen an den Pranger stellen. Allerdings ist auffällig, daß so gut wie alle jugendlichen Amokläfer Zugang zu legalen Waffen hatten, sei es jetzt dadurch, daß Verwandte ihre Waffen nachlässig aufbewahrt hatten - so hatten sich 68% der jugendlichen Amokläfer die Waffe im Verwandtenkreis besorgt (vgl. Safe School Initiative 2002, S.27) - oder gefährdeten Personen erlaubt hat, sich diese Waffen zu beschaffen. Die Wahrscheinlichkeit von Amokläfen ist also um so geringer, je schwieriger es für die Täter ist, an Waffen heranzukommen. Länder wie die USA (vgl. wikipedia: Eric Harris and Dylan Klebold, Wikipedia: Cho Seung-Hui, abgerufen am 23.09.2008), Kanada ("Amoklauf an kanadischem College", abgerufen am 23.09.2008) oder Finnland (vgl. Finnland: Amokläfer zeichnete Massaker" (2007), "Finnischer Amokläfer stirbt nach Schulmassaker" (2008), abgerufen am 23.09.2008) sind eben Länder mit einem hohen Verbreitungsgrad von Schußwaffen.)
Schließlich sind, wenn man den Meinungen der Kritiker glauben wollte, Computerspieler auch ganz arme Menschen, die mit einer Vielzahl von sozialen, psychischen und emotionellen Problemen beladen sind: Demnach seien Computerspieler jugendliche Einzelgänger ohne kommunikative und soziale Fähigkeiten, die beim Spielen ihre Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren suchten – und immer männlich (Krenzlin 2009). Oder wie Sabine Schiffer „weiß“, seien Erwachsene, die an Computerspielen Interesse finden, ohnehin ganz bedauernswerte und armselige Menschen. Sie seien passiv, besäßen kein adäquates Problemlösungsverhalten, keine Ausdauer, könnten sich keine längerfristigen Ziele setzen (Schiffer 2007, S.58). Was sind doch Millionen Menschen für arme Würstchen. Stetig wird auch die Behauptung wiederholt, daß „[v]iele Armeen“ ihren Soldaten mit Egoshootern Treffsicherheit an- und die hypothetische Tötungshemmung abtrainierten (Schiffer 2007, S.57; Krenzlin 2009, S.7). Letztlich kommt also die sogenannte „Diskussion“ nicht über die Wiederholung der schon sattsam bekannten Klischees, die nicht nur über Computerspiele, sondern in der Historie über alle Medien und ihre Konsumenten zum Teil im gleichen Wortlaut kolportiert wurden, nicht hinaus. Da wird dann zum Beispiel die „Nachdenklosigkeit“ unserer heutigen Zeit beklagt (Schiffer 2008, S.71). Dies eben ja doch ein Wort, das aus Zeiten von Goethe und Schiller stammen könnte.
Auch wird der fromme Wunsch nach einer „differenzierten Auseinandersetzung“ - die der Eine oder Andere womöglich noch als Versuch verstehen könnte, Pro- und Contra-Argumente darzustellen und zu einer einigermaßen integrierten Meinung zu gelangen -, von Medienkritikern typischerweise so verstanden, daß man noch weitere . Als prägnante Beispiele wurden neben der vermeintlichen Gewaltbereitschaft auch das allgemeine Verbrechertum (ein Medienkritiker nannte hier prägnant „Automatenaufbrüche“), schlechte Schulleistungen, Amokläufe von Mitgliedern von Schützenvereinen Computerspielen angelastet. Diese hatten die offensichtlich ganz besonders hervorragende „Wertevermittlung im Schützenverein“ - denn schließlich stammen auch viele der Politiker, die sich Verbote von „Killerspielen“ auf die Fahnen geschrieben zu haben, ohne selbst so ganz genau zu wissen, was das eigentlich ist - ganz einfach konterkariert. Schließlich wurden Computerspiele auch für Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen verantwortlich gemacht. Mit Schiffer ließe sich wohl auch noch folgern, daß in Computerspielen der Grund zu suchen ist, weshalb die deutsche Wirtschaft nicht funktioniert.
Diese Thesen sind mittlerweile so verinnerlicht, daß sie ohne Wissen immer wieder reflexartig wiederholt werden, wenn etwas passiert oder auch nur wenn man wieder einmal zu einer „Diskussionsrunde“ oder als „Experte“ eingeladen wird, in der man einander nur öffentlichkeitswirksam versichert, daß man einhelliger Meinung ist. Anläßlich eines school shootings, das in einer gutbürgerlichen Gegend in Finnland stattfand, auch der Amokläufer von Emsdetten habe ja einen Großteil seiner Zeit mit - Vorverurteilung inklusive - "Killerspielen" zugebracht (vgl. (Titel); (Titel); abgerufen am 07.11.2007). Und dies, obgleich der Täter vor der Tat selbst im Internet geschrieben hatte, daß sein Rechner dafür hardwaremäßig nicht ausgestattet war (vgl. (Titel), abgerufen am 07.11.2007), und obgleich sich auch in anderen Fällen, in denen etwa Christian Pfeiffer verkündet hatte, für diese Taten könnten nur Computerspiele verantwortlich seien, schließlich - was für einen Mann in diesem Alter erst recht absonderlich ist - nicht ein einziges Computerspiel anfand (vgl. Amoklauf in Virginia; abgerufen am 07.11.2007). Computerspiele sind also auch für das Fehlverhalten von Personen verantwortlich, die sie gar nicht spielen. Aber vielleicht stellte ja das Fehlen der Computerspiele einen Beweis für deren Schädlichkeit dar (siehe V.1 zu ähnlichen Argumentationen zur Internetüberwachung). Schließlich waren ja auch die Angriffe gegen Computerspiele(r) von seiten von Personen, die sich ihrer eigenen Aussage nach nicht mit Computerspielen auseinandergesetzt hatten, häufig auch von einer beispielhaften Aggressivität, und bekanntlich kann man nur durch Computerspiele aggressiv werden. Zum anderen wurde in der Historie schon öfter der Gescholtene und Angegriffe als selbst schuld daran gesehen, daß er zum Ziel der Angriffe „besorgter Bürger“ wurde.
Entsprechend ist klar, daß zwar einige von den Kritiken, die seinerzeit angebracht wurden, der Wahrheit entsprechen (so fällt es Magazinen wie "Panorama" sehr schwer, "objektiv" über das Thema Computerspiele zu berichten), während andererseits auch viele dieser Kritiken offensichtlich falsch sind.
2.1.1.7 Zur Genese des Begriffes "Killerspiel"
Die neuesten angegriffenen Medien sind nun Computerspiele und das Internet. Insbesondere scheinen sich sehr viele Personen, die sich in Wirklichkeit nicht mit diesen Medien auseinandergesetzt haben, dazu berufen zu fühlen, Aussagen über die vermeintlichen Auswirkungen dieser Medien zu machen (vgl. Lüke 2005; Buss 2006; Lott 2006).
"Wer die wahre Natur der Dinge kennenlernen
will, der muß oft nur ihre Namen richtig deuten."
(Ehrliche
Meinung(?) eines Kommentators in "Corso - Kultur am
Nachmittag", DLF, 04.11.2008)
Begriffe sind selbst Augenwischereien. Sie bestimmen letztlich das Empfinden gegenüber einem Sachverhalt. Damit ist es allerdings auch möglich, einen falschen Eindruck zu transportieren, indem für einen Sachverhalt ein gefärbter Begriff verwendet wird, der eine bestimmte Sicht auf diesen bereits impliziert. So wurde bereits durch die Begriffsbildung jeweils eine gewissermaßen "überwissenschaftliche" Weltsicht konstruiert, die scheinbar nicht mehr länger bewiesen werden muß. Dabei sind Begriffe besonders beliebt, die eine besonders drastische Bedeutung implizieren.
Der Begriff "Killerspiel", in "Panorama" noch in Anführungszeichen oder mit der Konstruktion "(von Medienkritikern) sogenannt" gebraucht, erscheint dieser Begriff heute ggf. auch ohne Anführungszeichen (vgl. etwa bei Teuthorn 2008, S.6). Der Begriff geht also langsam in den Sprachgebrauch über und setzt sich und damit aber auch die Vorstellung gedanklich fest, daß es sich bei den so bezeichneten Computerspielen um etwas zumindest zutiefst Verwerfliches handeln müsse. Ein älterer noch von Werner Glogauer verwendeter Begriff war der des "Tötungssimulators" (vgl. ), der dies noch einmal deutlicher macht.
Nun sei die Frage erlaubt, ob sich wirklich aus einem erfundenen Begriff die Gefährlichkeit eines Sachverhalts einfach ableiten läßt. Dies wird um so klarer, wenn man zwei andere Beispiele von Begriffsbildungen betrachtet, an denen diese These widerlegt wird:
(i) In dieser Art ähneln die Medienkritiker Kreationisten, die für ihre Vorstellung von der Entstehung der Welt den Anspruch einer Begründetheit oder "Wahrheit" erheben, weil es sich bei dieser ja um eine Schöpfungslehre handelte, während die Evolutionstheorie nur eine Theorie sei. Damit stellen sie auf das landläufige Verständnis ab, eine Theorie sei eine "unbewiesene Behauptung" ( , abgerufen am 05.11.2008) . Tatsächlich aber handelt es sich bei einer wissenschaftlichen Theorie um ein Modell, mit dem versucht wird, in einem Untersuchungsbereich auftretende Phänomene hinreichend gut zu erklären (Wikipedia: Theorie, abgerufen am 05.11.2008).
(ii) Die Abtreibungsgegner in den USA bezeichnen sich selbst als "pro-life"-Bewegung, deutsche Begriffe dafür sind etwa "Lebensschützer", "Lebensrechtsbewegung", "Ja zum Leben" oder "Initiative für Mutter und Kind" (vgl. Wikipedia: Pro-life, abgerufen am 05.11.2008). Die Anwendung solcher Begriffe soll letztlich gedanklich implizieren, daß Menschen, die Frauen die Abtreibung ermöglichen wollen, "anti-life" und damit "gegen das Leben" (oder auch gegen "Werte" wie Familie und elterliche Zuwendung) eingestellt seien. Eine weitere polemische Schöpfung aus dem Umfeld der "pro-life"-Bewegung, der dies aufzeigt, ist der an den "Holocaust" angelehnte Begriff des "Babycausts", der die Abtreibung mit dem Holocaust (Wikipedia: Holocaust#Babycaust, abgerufen am 05.11.2008) und damit Befürworter des Rechts auf Abtreibung indirekt mit Völkermördern oder Verharmlosern vergleicht. Diese Begriffsbildung wurde letztlich dafür kritisiert, damit werde letztlich die in der Geschichte beispiellose Organisiertheit des Holocausts geleugnet (vgl. "Babycaust": "Lebensschützer" verhöhnen NS-Opfer, abgerufen am 05.11.2008). Zweitens werden Menschen, die in emotionaler Not die Entscheidung für eine Abtreibung fällen, mit Menschen gleichgesetzt, die ohne emotionale Beteiligung gehandelt haben. Schließlich kann es zumindest für bestimmte Abtreibungen ethische Rechtfertigungen geben, während dies für den Holocaust nicht der Fall ist.
Dabei ist allerdings die Gewaltdarstellung in Computerspielen nur der Aufhänger für eine universelle Kulturkritik, die das Fernsehen selbst oder gar wesentliche Teile der herrschenden Kultur angreift (vgl. Kunczik 2000, S.5). Zum anderen scheinen Medienkritiker sehr häufig selbst von den Effekten betroffen zu sein, die sie den Medien zuschreiben, da sie widersprüchliche oder groteske Gedankenwelten aufbauen oder sich in aggressiver Rhetorik ergehen, die wenig von "Empathie" zeugen, die angeblich ja doch nur der anderen Seite abgehe. Bezeichnend ist jedenfalls, daß viele der Medienkritiker eine politisch eher konservative Haltung vertreten bzw. wenig dabei finden, im realen Leben "Krieg" zu spielen und reale Lebewesen zu töten.
Im folgenden sollen einige der Akteure und ihre Gedankenwelten kurz vorgestellt werden, die sich damit (häufiger eher nicht) auseinandergesetzt haben, und versucht werden, die Sinnhaftigkeit und auch einen größeren Kontext dieser Angriffe zu erörtern.
2.1.2 Christian Pfeiffer, "Computerspielexperte"
"Die Frage ist ja, was ist überhaupt 'gesund'.
Jemand hat mal gesagt: 'Gesund ist ein Mensch, der nicht
ausreichend untersucht wurde.' Wenn man bei einem Menschen, sagen
wir einmal, zwanzig Untersuchungen macht, sind nur noch 36 Prozent
gesund. Machen Sie fünfzig Untersuchungen, haben alle
irgendeinen pathologischen Wert, das müssen Sie dann weiter
kontrollieren, und dann ist letztlich Jeder irgendwie krank."
(Dr.
Manfred Lütz, Neurologe und Theologe, in: "Hintergrund:
Vorsorge im Wartestand - Die Probleme der Gesundheitsprävention",
DLF, 11.04.2009)
"'World of Warcraft' ist ein Strategiespiel, wo man Rollen spielt, man ist Unteroffizier oder General, Arzt oder Sanitäter." (Christian Pfeiffer in "Hart aber fair" vom xx.xx.2006, zitiert nach Lindemann 2008) Da diese (fälschliche) Aussage anscheinend unwidersprochen blieb, demonstrierte die versammelte Mannschaft wieder einmal, daß sie zwar nicht wußte, worum es sich bei „World of Warcraft“ handelt, aber sich darin einig war, daß es sich dabei um etwas absolut Schreckliches und Gefährliches handelte, das unbedingt verboten werden mußte. Hätten derartige Experten nicht so großen Einfluß und eine derartige Medienpräsenz, hätte man über diese erbärmliche Vorstellung wenigstens lachen können.
Christian Pfeiffer inszeniert sich selbst gerne als "Medienforscher" oder als "Computerspielexperte", so etwa im Rahmen von Vorträgen oder Fernsehberichten, indem er kurze Videoschnipsel aus nicht näher benannten gewalthaltigen Computerspielen vorführt. In seinen Veröffentlichungen ist das KFN bestrebt, diverse tatsächliche und angenommene Gefährdungen, die von Computerspielen ausgehen sollen, zu beweisen. Diese Darstellungen sind durchaus plakativ -- so unterstellt das KFN gerne Computerspielen bestimmte Inhalte, so etwa daß der Nutzer die Rolle von Personen übernehmen könne, die Andere folterten - dabei wiederum ohne explizit den Namen eines Spiels zu benennen, das dies zuließe und in Deutschland nicht schon verboten wäre -, und Wirkungen, insbesondere eine Abstumpfung, die Verschlechterung der Schulleistungen und die Steigerung der Wahrscheinlichkeit, daß die Nutzer selbst gewalttätig werden (vgl. Höynck et al. 2007, S.1). Allerdings sind die Ergebnisse der Studien, auf die hier zurückgegriffen wird, ihrerseits häufig fragwürdig (siehe Anmerkungen zur Habitualisierungsthese). Weiterhin fällt auf, daß Pfeiffer seiner eigenen Aussage nach sich nicht mit Computerspielen beschäftigt hat, sondern sich bei solchen Themen auf Aussagen seines Sohnes verläßt (vgl. http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,450284,00.html, abgerufen am 14.07.2007; Buss 2006).
2.1.2.1. Das Problem verabsolutierter Weltbilder
Man kann durchaus
Argumente für eine Auseinandersetzung mit den Thesen der
Medienkritiker aus literarischen Quellen beziehen. In Christa
Wolfs Roman „Kein Ort. Nirgends“, der letztlich auch
dadurch „multimedial“ wurde, daß es davon
zumindest eine Hörspiel- als auch eine Theater-Version gibt,
findet sich ein interessanter Wortwechsel zwischen den Figuren
(Heinrich von) Kleist und (Friedrich Karl von) Savigny. Während
Savigny festhält, daß Menschen sich eine ganze Menge
ausdenken könnten, ohne diese Ideen jemals in die Tat
umsetzen zu wollen, will Kleist alles, was er denkt, auch in die
Realität umsetzen, wozu sonst sei eine Idee auch da.
Nun
sollte man aber einmal damit beginnen, seine Gedanken auf diese
Weise zu ordnen: Wenn man sich bei einem Gedanken ertappt, der ja
„nur ausgedacht“ ist, um hierbei die Kritik
fiktionaler Werke in Truffauts Version von Ray Bradburys Roman
„Fahrenheit 451“ zu zitieren, oder der der eigenen
Werteordnung widerspricht, sollte man sich dafür schämen
und ihn konsequent und nachhaltig bekämpfen. Wie man vom
christlichen Glauben weiß, wo bekanntlich auch nachgefragt
wird, ob man „unkeusch gedacht“ hat - man beachte
Matthäus
5,28 und die katholische Beichte – führt dies zu
allerlei Neurosen.
Allzumal mag man auch davon
ausgehen, Christian Pfeiffer pflege ein mythisches Denken, in dem
eine Sache und eine Abbildung dieser Sache dasselbe sind (vgl. als
Urheber Wikipedia:
Pherekydes von Syros, abgerufen am 28.04.2008). Anläßlich
einer Predigt mit dem Titel "Du sollst nicht töten"
äußerte er die Forderung, Medien an der "christlich
geprägten Werteordnung" zu messen. Seiner Meinung nach
müßten alle Spiele verboten werden, in denen der
Spieler für die Begehung von Taten belohnt werde, die nach
dem deutschen Strafgesetzbuch als Verbrechen gelten, d.h. mit
einem Jahr Gefängnis oder mehr bestraft werden (vgl. Pfeiffer
2006, S.4).
Jugendschützer propagieren recht häufig, daß gewalthaltige Computerspiele, insbesondere Ego-Shooter, "in extremer Weise das Wertesystem unserer Gesellschaft [negierten]" (vgl. Gasser et al. 2004, S.343f.). Nun liefert Pfeiffer auf Basis seiner Predigt ein Argument, das das Konstrukteur eines Strohmannes nicht besser hätte liefern können: Wieder einmal soll ein Medium, diesmal die Computerspiele, die gesellschaftliche Ordnung zerstören, oder genauer: die Gesellschaft werde dadurch zerstört, daß christliche Normen und Werte nicht respektiert werden.
Allerdings ist diese Forderung aus verschiedenen Gründen problematisch oder wirft nachgerade Paradoxien auf:
a) So wäre das Bewertungskriterium doch ausgesprochen inkonsistent:
(i) So versetzen diese Spiele den Spieler häufig in Situationen, in denen es nach genau diesen Kriterien erlaubt ist, Gewalt anzuwenden: In "Counterstrike" kann der Spieler die Rolle eines Polizisten übernehmen, der gegen Terroristen kämpft. Polizisten sind ohnehin dazu berechtigt, Gewalt anzuwenden, um Bedrohungen für sich oder andere abzuwenden.
[Nun erlaubt "Counterstrike" dem Spieler auch, die Rolle eines Terroristen zu übernehmen. Pfeiffer müßte demnach den Shooter "America's Army", in dem der Spieler, egal auf welcher Seite der spielt, stets als US-Soldat, seine Gegner aber als Terroristen auftreten, als "moralisch besser" bewerten (vgl. Gieselmann 2003, S.37). Allerdings kann auch für die Seite, die man nicht verkörpern kann, keine Empathie aufgebaut werden. Ansonsten ist Empathie dort auch nicht nötig, da sich besiegte Gegner ohne Anzeichen von Verletzungen oder Schmerz zu zeigen, einfach hinsetzen (vgl. ebd., S.36).]
Viele Spiele wie etwa "Dxxm" (in Deutschland indiziert) setzen den Spieler auch in die Situation, in der er ohne Hoffnung auf äußere Hilfe auf sich selbst gestellt ist. Nun ist nach deutschem Recht auch niemand verpflichtet, in solchen Situationen auszuharren oder sich von einem - auch menschlichen - Angreifer umbringen zu lassen. Um sich selbst zu schützen, darf man im Sinne des Notwehrparagraphen im gegebenen Fall diesen kampfunfähig machen und - wenn dies dazu notwendig ist - töten. Ist man selbst schwächer als der Angreifer, darf man dazu auch ggf. eine stärkere Waffe benutzen.
Spiele wie "Call of Duty" oder "Operation Flashpoint" versetzen den Spieler in eine Kriegssituation. Was die Handlungen des Soldaten angeht, wird davon ausgegangen, daß seine Gewaltausübung in dem Moment gerechtfertigt ist. In solchen Situationen bekämpfen häufig Menschen einander, die eigentlich nicht den Wunsch haben, Anderen zu schaden, wohl aber unter militärischem Befehl dazu gezwungen werden, also allein dadurch legitimiert, daß viel weiter oben ein Entscheider beschlossen hatte, diese Menschen als Verfügungsmasse für seine politischen Handlungen zu gebrauchen.
Für die minimalistische Rahmengeschichte von "Quake 3", das den Spieler in die Situation eines futuristischen Gladiatorenkampfes setzt, wäre schließlich die "Planke des Karneades" anwendbar: Geraten zwei Personen in eine Situation, die nur Eine der Beiden überleben kann, und tötet darin eine Person die andere, so liegt nach juristischer Interpretation zwar ein Totschlag, für den Täter aber ein "entschuldigender Notstand" vor, so daß dieser nicht im rechtlichen Sinne schuldig ist (vgl. Wikipedia: Brett des Karneades, abgerufen am 19.11.2007).
Und schließlich stellen Ego-Shooter, die klassischerweise „Alien-Invasions-Geschichten“ erklären, ja auch nichts Anderes als Variationen des klassischen Romans „Krieg der Welten“ von H.G.Wells dar. Jemand, der den Roman liest oder sich zum Beispiel die erste Verfilmung „Kampf der Welten“ von 1953 ansieht, wird feststellen, daß darin – nach der damaligen Tricktechnik - schließlich auch ganze Armeen im Kampf gegen die Außerirdischen verheizt werden. Es ist nicht ganz einzusehen - auch wissenschaftlich nicht -, warum hier eine Fiktion schlechter oder gefährlicher sein sollte als eine andere.
(ii) Stattdessen könnten nach dieser Definition allerdings Spiele verboten werden, bei denen dies - selbst wenn man gewalthaltige Medien grundsätzlich ablehnt - als haltlos erschiene. So dürften Kinder und Jugendliche zum Beispiel keine Autorennspiele spielen, da nach dem Strafgesetzbuch das Fahren ohne Fahrerlaubnis im Wiederholungsfalle auch mit mehr als einem Jahr Haft bestraft werden kann.
(iii) Wenn Medienkritiker nun behaupten, der Staat habe ein Interesse an der Brutalisierung der Kinder und lasse deshalb gewalthaltige Computerspiele zu (vgl. ) oder lanciere sie sogar noch selbst, könnte man dann nicht behaupten, umgekehrt hätte der Staat ein Interesse daran, durch Zensur der Medien bestimmte Legenden zu unterdrücken? Immerhin machte sich der legendäre "Robin Hood" in den verschiedenen Spielen, in denen der Spieler in seine Rolle schlüpft, verschiedener Delikte schuldig, die nach dem damals geltenden Recht bestraft wurden: In "Conquest of the Longbow" aus dem Jahr 1991 begeht der Spieler immerhin solche Delikte wie Wegelagerei, Widerstand gegen die Staatsgewalt oder Gefangenenbefreiung.
b) Daneben wird Robin Hood ja gerade wegen seines Widerstandes, auch wenn er unter der vermeintlich besseren Herrschaft von Richard "Löwenherz" genauso dafür bestraft worden wäre wie während der vermeintlichen Willkürherrschaft des Königs Johann "ohne Land", als positiv bewertet. Nun kann allerdings ebenso ein Interesse daran bestehen, eine Glorifizierung Robin Hoods zu verhindern, weil durch diesen Mythos die Autorität und das "Vertrauen" der Bürger in die Gerechtigkeit der staatlichen Organe untergraben würde.
Nun ist von Christian Pfeiffer auch nicht unbedingt zu erwarten, daß er - scheinheilig - "kriminelle" Personen in "strafbaren Dreck" und in schützenswerte Legenden unterteilt würde. So wurden und werden in der Praxis Mythen wie reale Geschichte durchaus häfig einer Uminterpretation im Sinne der herrschenden Moralvorstellungen unterzogen. So gab es aus Griechenland Proteste gegen Oliver Stones "Alexander", in dem Episoden aus dem Leben Alexanders des Großen erzählt werden, weil der Ruf des griechischen Nationalhelden durch Darstellungen, die homosexuelle Neigungen Alexanders nahelegen, beschädigt werden könne (vgl. Wikipedia: Alexander (Film), abgerufen am 15.09.2008). Die moralische Abwertung der Homosexualität entspringt hier allerdings primär den Moralvorstellungen der griechisch-orthodoxen Kirche, in deren Verständnis homosexuelle Handlungen und Beziehungen sündhaft und unmoralisch sind (vgl. Harakas 2005), nicht aber den Moralvorstellungen der Griechen in der vorchristlichen Antike (vgl. dazu Wikipedia: Homosexualität im antiken Griechenland, abgerufen am 15.09.2008).
Man kann allerdings die historischen Tatsachen oder die Inhalte der Legende nicht ausblenden. Man kann zwar aus heutiger Sicht die Inquisition beurteilen. Aber man darf sie nicht bloß deshalb verschweigen, weil deren Vorgehen nicht den heutigen moralischen Überzeugungen entspricht.
Ansonsten dürfte es überhaupt schwerfallen, noch so etwas wie "Idole" im Pfeifferschen Sinne zu finden, die stets auf dem Boden der herrschenden Gesetze gehandelt haben. So hatte auch "Mahatma" Gandhi mehrfach Gesetze der britischen Kolonialherren gebrochen (vgl. Wikipedia: Mahatma Gandhi, abgerufen am 16.09.2008), hatte Nelson Mandela zwischenzeitlich auch den gewaltsamen Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika gutgeheißen, das seinerseits mit Waffengewalt auch gegen friedliche Proteste vorging (vgl. Wikipedia: Nelson Mandela, abgerufen am 16.09.2008).
.
[Gerade die Religionen, die aus dem Dunstkreis der Bibel entstanden, hatten ja ein "kreatives Verhältnis" zu dem Begriff des "Tötens", der im Alten Testament zunächst einmal mit dem kategorischen "Du sollst nicht" verknüpft zu sein schien. Allerdings wird immer wieder angeführt, daß im hebräischen Urtext ein Unterschied zwischen "morden" und "töten" besteht. Dies ermöglichte nicht zuletzt den gläubigen Institutionen, Menschen wegen allerlei vermeintlicher Verfehlungen und natürlich aus "Nächstenliebe" zu töten. Denn sie hatten damit ja keine Morde begangen. In sofern erscheint die Kategorizität der gemachten Aussage zumindest im Hinblick auf die Historie süffisant.]
Zudem zeugt dies auch von einem Realitätsverlust auf Seiten des Medienkritikers. Da er selbst nicht zwischen realer und virtueller Welt unterscheiden kann, muß er davon ausgehen, daß dies prinzipiell nicht möglich sei. Pfeiffer verlangt mit seiner Argumentation die Übernahme einer einheitlichen Vorstellung von Moral, Recht und Gesetz auch für alle Phantasiewelten.
Diese Vorstellung wird bereits durch die Vielzahl an Büchern ad absurdum geführt, die unter darunter verboten würden. Auch aus Sicht der kulturvergleichenden Forschung stellt diese Herangehensweise ein Unding dar. Kulturen sind durch unterschiedliche Werthaltungen und Motive gekennzeichnet, die ggf. nicht einmal miteinander vergleichbar sind. Deshalb können sie kaum durch übergreifende Maßstäbe beschrieben werden, sondern sie erfordern eine interpretative Herangehensweise anhand von Dimensionen, die von einer Kultur selbst geschaffen werden und möglicherweise auch nur auf diese allein anwendbar sind (vgl. Welge und Holtbrügge 2003, S.35f.). Diese Argumentation ist sowohl auf real existierende als auch auf künstlich geschaffene Kulturen anwendbar (vgl. ebd., S.215).
Zur kulturellen Untersuchung ist insbesondere ein ethnographisches Vorgehen notwendig, das sich auf die Inhalte genauso wie auf die Konsumenten bzw. Partizipanten einläßt und hinterfragt, welche Funktion Darstellungselemente wie die Gewalt überhaupt haben und die Spieler diese wahrnehmen. Dadurch gelangt der Forscher unter Umständen zu ganz anderen Ansichten als dies bei einer Perspektive von außerhalb der Konsumentengruppe möglich ist.
Mertens (2004) argumentiert entsprechend, daß man sich mit Gewalt in Computerspielen nicht im Hinblick auf die Moral beschäftigen sollte. Die Gewaltdarstellung sei nicht grundsätzlich gut oder schlecht, kann allerdings in gewissen Fällen unangemessen oder ohne sinnfälligen Zusammenhang zur Handlung sein (vgl. Schindler 2005, S.58). Tatsächlich finden sich in Studien ja Hinweise darauf, daß Gewalt einen geringeren Effekt hat, wenn sie vom Konsumenten erwartet wird, und bewerten Konsumenten Gewaltdarstellungen durchaus auch nach solchen Kriterien.
Es ist entsprechend fragwürdig, die in Medien dargestellten Welten anhand eines allgemeinen Standards pauschal bewerten zu wollen. Es muß sowohl erörtert werden, wie die Konsumenten Darstellungen wahrnehmen, als auch welche Aufgabe Handlungen und Darstellungen in der Spielwelt genau haben sollen. Man kann anderseits von einer virtuellen Welt auch nur insoweit Rechenschaft verlangen wie es Menschen gibt, die Regeln dieser virtuellen Welt in das reale Leben übertragen wollen. Fordert etwa ein Politiker, die Menschen sollten die Lehren der Bibel wieder leben, so stellt sich die unwillkürliche Frage, welchen hochstehenden moralischen Wert diese Lehren denn haben sollen.
c) Bei den Gestalten, die dort abgebildet sind, handelt es sich zumal auch nicht um echte Menschen. Müller (2006c) bemerkt, daß sich Spieler ja gerade deshalb nicht bewußt sind, daß sie da "jemanden" getötet haben sollen, eben weil sie niemanden getötet hatten.
d) Daneben entwickelt sich die Kultur und damit die Empfindung, was "adäquat" ist, mit einer anderen Geschwindigkeit als das "Moralempfinden" oder das Strafgesetzbuch. Im Kernbereich des Strafrechts, was etwa Delikte gegen Leib und Leben oder das Eigentum angeht, gibt es nur geringe Veränderungen. Allerdings führen Veränderungen in den Werthaltungen der Gesellschaft, technische Entwicklungen etc. zu Verschiebungen in Vorstellungen außerhalb dieses Kernbereichs (vgl. Heinz 2004, S.4).
Die Gesetzgebung und die Beurteilung von Medien hinken diesen Entwicklungen teilweise um Jahrzehnte hinterher. So hat sich etwa die Interpretation gewandelt, welche Inhalte dem Konsumenten zuzumuten sind und welche nicht. Diese Werthaltungen sind heute häufig nicht mehr nachzuvollziehen, da in vielen Fällen, in denen Reglementierungen erfolgten, auf willkürlich gesetzte "Geschmacks- und Moralgrenzen" zurückgegriffen. So zensierte der Bayerische Rundfunk zum Beispiel noch im Jahr 1990 die Ausstrahlung einer Folge der ARD-Serie "Lindenstraße", weil darin zwei Darsteller, die ein homosexuelles Paar darstellten, einander küßten (vgl. Wikipedia: Lindenstraße; abgerufen am 18.06.2007). Die BPjS indizierte im Jahr 1984 ein Computerspiel namens "River Raid" mit der Begründung, der Spieler werde damit in die Rolle eines "kompromißlosen Kämpfers und Vernichters" gesetzt und einer "paramilitärischen Ausbildung" unterzogen. Bei Jugendlichen führe das Spielen beispielsweise zu "Aggressivität [und] Fahrigkeit im Denken". Das Spiel wurde erst im Jahr 2002 auf Antrag der Herstellerfirma von der USK ohne Altersbeschränkung freigegeben (vgl. Wikipedia:River_Raid), weil heute niemand mehr nachvollziehen kann, welche Gefahr denn von Klötzchengraphik ausgehen kann.
e) Das Wesen des Spiels.
Einer der wesentlichen Aspekte des menschlichen Charakters scheint der Spieltrieb zu sein. Das Spiel selbst kann nun verschiedene Funktionen haben bzw. gibt es unterschiedliche Dimensionen dessen, was ein Spiel ist:
(i) Aus der Vergangenheit ist bekannt, daß Spielzeuge und Spiele dazu eingesetzt wurden, um Kinder auf ihre spätere Rolle vorzubereiten. Geschlechtsspezifisches Spielzeug sollte entsprechend Mädchen auf ihr Dasein als Hausfrau und Mutter vorbereiten, während Jungen auf das Soldatsein vorbereitet wurden. Tierkinder spielen ebenfalls, um sich für das Leben vorzubereiten, indem sie etwa Jagd auf Beute üben oder sich noch fiktiv mit ihren Geschwistern balgen. Auch dies sind "Spielinhalte", die auf das spätere Leben als Erwachsene vorbereiten sollen. Ein weiteres Merkmal des Spiels ist allerdings die Zweckfreiheit, so daß aus dieser Sicht diese rollenbildende Funktion in diesem Kontext eine eher untergeordnete Bedeutung hat.
(ii) Eine andere Definition des Spiels dreht sich darum, daß im Rahmen des Spiels eine abgegrenzte Welt geschaffen wird, die in ihren Regeln nicht mit den Regeln der realen Welt übereinstimmt (). .
Im virtuellen Raum müssen entsprechend auch Möglichkeiten existieren, Handlungen zu vollziehen, die man im realen Raum nicht durchführen würde. Gäbe es diese Möglichkeit nicht, wäre das Spielen an sich völlig sinnlos. Dies mag zwar in der Forderung der Medienkritiker ("Weg mit dem Virtuellen", Dr.Michael Heilemann in "Hart aber fair", Zitat siehe Buß 2006) wünschenswert sein. Allerdings wäre die Abschaffung eines Mediums - damit durchaus auch die Abschaffung einer Art der Auseinandersetzung mit der Welt - seit dem Beginn des Mittelalters, als so etwas wie Bildung für über ein Jahrtausend für die meisten Menschen nicht mehr erreichbar war, auch ein absolut singulärer Vorgang. Ein Medium wurde außer in solchen katastrophalen Zeiten, die noch dazu von rigidem Fanatismus und Dogmatismus geprägt waren, nicht abgeschafft, sondern höchstens durch ein höherwertiges Medium in seiner Wichtigkeit begrenzt bzw. ihm eine neue Rolle zugeordnet.
f) Bereits aus Untersuchungen zu den Effekten des Fernsehens
ist allerdings bekannt, daß die Wirkung von
Gewaltdarstellungen um so stärker ist, je mehr die Gewalt mit
der Lebensumgebung der Konsumenten zu tun hat (vgl. Ledingham et
al. 1993, S.4+8). So wirkt die Darstellung eines elterlichen
Streits erregender als etwa eine Schießerei in einem
Cowboyfilm. In anderen Situationen wird Gewaltdarstellung auch
erwartet, etwa die Leiche in einem Krimi. Tatsächlich gibt es
Positionen und zum Teil auch empirische Befunde, daß Spiele,
deren Inhalte leichter in der Realität umsetzbar sind, bzw.
deren Darstellungen "entschärft" sind und sich eher
an der Realität orientieren, auch "gefährlicher"
seien als etwa Ego-Shooter (vgl. Grimm 1999 nach Kimm 2005, S.310;
Ladas 2002 nach Kimm 2005, S.22; Oppl 2006, S.39f.).
g)
Schließlich das Christentum.
Die schiere Sachlichkeit der „Auseinandersetzung“ um den „Krankheitswert“ von Medien, die Gewaltdarstellungen enthalten, läßt Einen schon manchmal nicht umhin kommen, selbst zynisch zu werden.
Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß es auch von der Bibel ganz verschiedene Interpretationen gibt: Wenn man sie, so präsentieren sich zum Beispiel dem Atheisten auf Hunderten Seiten ausgebreitet schier endlose Aufstellungen göttlicher Strafen, die den Menschen widerfahren sollen, die nicht dem biblischen Gott folgen und all seine Gebete befolgen, werden „Sünder“, Andersgläubige oder Fremde auf übelste Weise beschimpft, werden immer wieder oder ihnen ein schreckliches Schicksal prophezeit. Darin finden sich zahlreiche Textstellen, die unrühmliche Geschichte gemacht haben.
So war der Vers „Die Zauberin sollst Du nicht leben lassen“ (2. Mose 22,17) eine Rechtfertigung für den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hexenwahn, dem je nach Schätzung Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen waren (vgl. Wikipedia: Hexenverfolgung, abgerufen am 12.03.2009).
So war das Zitat „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ (Matthäus 27,25), das „den Juden“ in den Mund gelegt wurde, das vermeintliche „Geständnis“, mit dem auch die Strafe gerechtfertigt werden sollte, die „den Juden“ zugemessen wurde. In (1. Thessalonicher 2,14f.) wird noch einmal explizit in der „göttlichen Wahrheit“ behauptet, die Juden hätten „den Herrn Jesus umgebracht […] und sind aller Menschen“ je nach Übersetzung beispielsweise „Feind“ oder „zuwider“, seit der Machterlangung der christlichen Kirche eine Rechtfertigung für Benachteiligung, Diskriminierung und schließlich sogar für Gewaltakte gegen Juden und Andersgläubige. Hier lieferte die Bibel dafür sogar konkrete Handlungsanweisungen: So wird beispielsweise ausgeführt, daß „den Juden“ „das Maul gestopft“ werden müsse (Titus 1,10f.), und daß Gläubige – zumal in der „letzten Zeit“ - das Recht hätten, „die Ungläubigen mit eisernem Stabe zu weiden und sie zu zerschlagen wie irdene Töpfe“ (Offenbarung des Johannes 2, 26f.). Die Christen wähnten sich bezeichnenderweise natürlich während großer Teile ihrer Geschichte in dieser „Endzeit“ und nahmen entsprechend an, die Wiederkunft Christi stehe unmittelbar bevor (vgl. Böcher 2000; 2002, S.2). Eben auch dadurch mögen sie sich als gerechtfertigt angesehen haben, diese Dinge zu tun.
Einige von diesen „Argumentationen“ oder Handlungsanweisungen entsprechen in frappierender Weise dem Handeln der Nationalsozialisten, die sich schließlich auch in religiöser Weise dafür gerechtfertigt sahen, einen Vernichtungskrieg gegen Menschen aufgrund irrationaler Kriterien zu beginnen. So hatte, als vor Beginn der „Endlösung“, als die Nazis zunächst mit massiven Repressionen Juden aus ihrem Machtbereich zu vertreiben versuchten, Naziführer zynisch kommentiert, daß Viele große Schwierigkeiten damit hatten, aufnahmebereite Länder für sich zu finden, auch diese hätten sie also nicht gewollt (vgl. Paris - Erster Zufluchtsort für Künstler und Intellektuelle, abgerufen am 12.03.2009). Martin Luther hatte nach seinen Bekehrungsversuchen, die allerdings ungehört verhallten, in einem Pamphlet namens „Von den Juden und ihren Lügen“ gefordert, man müsse den Juden ihre Häuser und Synagogen, all ihre Besitz- und Heiligtümer nehmen und sie Zwangsarbeit leisten lassen. Adolf Hitler berief sich sogar explizit auf Luther, er habe dessen Pamphlet sogar als explizite Handlungsanweisung genommen (vgl. Martin Luther und sein Kampf gegen die Juden, abgerufen am 12.03.2009). Zumindest hatten sie damit die Vorurteile dankbar aufgenommen, die damals in einem großen Teil der Bevölkerung als „Glaubenswahrheiten“ noch präsent oder zumindest abrufbar waren.
Christian Pfeiffer sieht sich aber anscheinend weiterhin als Christen, trotzdem die schon im christlichen Basistext betriebene Volksverhetzung ein Verbrechen ist und darin Gewalt gegen Andere verherrlicht wird. Dies ist nicht ganz konsistent mit seiner eigenen Forderung.
h) Waren es am Ende denn nur die gewalthaltigen Computerspiele?
Im Vergleich zu Neil Postman, Manfred Spitzer oder auch schon den Machern von „Panorama“, für die das gesamte Medium eine zerstörerische Wirkung hatte, wäre Christian Pfeiffer allerdings nur ein „läßlicher“ Medienkritiker, wenn er nicht das ganze Medium an sich, sondern nur eine kleine Teilmenge davon kritisierte. Tatsächlich aber vermittelte Pfeiffer in verschiedenen Einlassungen den Eindruck, daß er eigentlich alle Computerspiele, jede „sinnfreie“ Beschäftigung und schließlich sogar die Benutzung von „Bildschirmgeräten“ durch Kinder und Jugendliche ablehnt. So seien für ihn allerhöchstens Lernspiele sinnvoll, während es „niemandem was“ nutze, seine Zeit mit sonstigen Computerspielen zu verbringen. Andererseits könnten aber männliche Jugendliche durch Spiele, in denen sie ihre Männlichkeit beweisen könnten, etwa Rugby, beweisen. Einmal mehr wurde hier also die reale Gewaltausübung als positiv, die virtuelle Gewaltausübung als negativ beurteilt. Zum anderen regte Pfeiffer eine Kampagne an, in der dazu aufgerufen werden sollte, Kinderzimmer komplett frei von „Bildschirmgeräten“ zu machen, ihnen allerhöchstens „im Alter von 10, 12, 15 Jahren in der Schule oder im Elternhaus“ die Benutzung von Computern schrittweise beizubringen (vgl. "Computernutzung erst am 13", abgerufen am 13.03.2009).
Vergleiche hierzu auch die Besprechung der Argumentationen des „Kölner Aufrufs“.
2.1.2.2. Geschichte der Äußerungen
Vielleicht interessant ist auch eine Bemerkung zu dem Stellenwert, den Pfeiffer den Computerspielen in früheren und in aktuellen Publikationen einräumt. So wurden in früheren Veröffentlichungen Computerspiele als "Gewaltfaktor" nicht einmal erwähnt, oder in einen größeren Kontext eingebettet, der der "double dose"-These entspricht. So waren Pfeiffer et al. (1999) noch mit anderen Wissenschaftlern im Einklang (vgl. Kimm 2005, S.310; Williams 2006a, S.80) der Meinung gewesen, daß das Selbstbild, das letztlich Grundlage aggressiven Verhaltens ist, und auch grundlegende Verhaltensmuster durch den Konsum nicht verändert werden und entsprechend Medien nur dann eine Wirkung haben, wenn gewisse Anknüpfungsmöglichkeiten zu Erfahrungen im eigenen Leben bestehen (vgl. S.2 Anm.3).
Andererseits stellten Baier und Pfeiffer (2007) für 2005 im Vergleich zu 1999 sogar eine Abnahme der Gewalttätigkeit von Jugendlichen fest (vgl. S.25). Dies ist insbesondere interessant in dem Zusammenhang, daß verschiedene Statistiken für Deutschland eine erhebliche Steigerung des allgemeinen Medien- und des Internetkonsums (vgl. Lukesch 2006, S.14) bzw. auch des Computerspielekonsums aufzeigen (vgl. Bauer 2006, S.51f.). Interessant wäre entsprechend eine dahingehende Aufschlüsselung von seiten des KFN, welche Faktoren sich innerhalb derselben Zeit denn derartig positiv verändert haben sollen, daß eine "gewaltsteigernde Wirkung" des Computerspielens dadurch überkompensiert werden könnte.
Im "Frontal 21"-Bericht am 21.08.2007 behauptete Pfeiffer ansonsten, daß es erst einmal Computerspiele brauche, damit ein von den Eltern oder im allgemeinen sozialen Umfeld drangsaliertes Kind, dem also permanent Gewalt vorgelebt wurde, zu der Konsequenz komme, selbst Gewalt anzuwenden. Dies entspricht allerdings nicht einmal der Argumentation der KFN, wo es heißt, daß in Erziehung bzw. sozialem Umfeld erfahrene Gewalt ausreicht, um die Gewalttätigkeit zu steigern, da damit Verhaltensvorbilder geliefert werden und Gewaltverhalten legitimiert wird (vgl. Baier und Pfeiffer 2007, S.26,35-37).
2.1.2.3. Angriffe auf die USK
In einer weiteren Studie untersuchte das KFN seiner eigenen Angabe nach 72 gewalthaltige Computerspiele, die von der USK mit Altersabstufungen zwischen "ab 12" und "Keine Jugendfreigabe" (ab 18) eingestuft bzw. von der BPjM indiziert worden waren, auf ihre Übereinstimmung mit gewissen selbst entwickelten Testkriterien. Dabei wurde nur in 35.5% der Spiele eine solche Überstimmung gefunden, während das KFN mit mindestens 37.1% der Einstufungen nicht einverstanden war. Nach der Interpretation des KFN würden bereits viele Spiele, die "ab 16" eingestuft wurden, als "Grenzfälle zur Indizierung" betrachtet. Insbesondere alle "Kriegsshooter" müßten daraufhin geprüft werden, ob sie nicht Kriege verherrlichten. Als Gründe für diese vermeintlich "falschen Einstufungen" wurde unter anderem genannt, daß Gutachtern viele Aspekte von Inhalt oder Darstellung nicht bekannt gewesen seien; bestimmte Handlungsmöglichkeiten (wie Unbeteiligte zu töten) als nicht problematisch empfunden wurden, wenn diese nicht spielentscheidend seien; man offenbar bei der USK der Meinung sei, daß vorhandene Gewaltinhalte durch (Einbettung in) andere Inhalte relativiert würden; und insbesondere die USK-Gutachten sich an spielerfahrenen, medienkompetenten Jugendlichen orientierten, aber nicht an dem jüngsten und am wenigsten medienerfahrenen, die doch am meisten schützenswert seien (vgl. Höynck et al. 2007, S.1-3). So forderte Pfeiffer etwa, zukünftig im Fernsehen keine Filme mehr auszustrahlen, die nach Einschätzung der Selbstkontrolleinrichtungen "ab 18" eingestuft wurden (vgl. Pfeiffer 2004, S.7), im Prinzip also eine erheblich ausgedehnte Indizierungspraxis von als "jugendgefährdend" eingestuften Medien. Auch Thomas Feibel, der Autor eines Buches mit dem Titel "Killerspiele im Kinderzimmer", fordert ein Verbot aller Inhalte, die nichts in den Händen von Kindern zu suchen haben (vgl. "Expertenstreit über Auswirkungen von 'Killerspielen' auf Jugendliche", abgerufen am 08.05.2008).
(1) Allerdings führt gerade diese Einschätzung dazu, daß der Jugendschutz als solcher ad absurdum geführt wird: Argumentiert man so, wäre die letzte Konsequenz ja die, folglich alle Medieninhalte, die von Kindern nicht verstanden oder "adäquat angewendet" werden können, zum Beispiel Computerspiele, die heute in eine Kategorie "ab 12" oder höher fallen, zu indizieren oder zu verbieten. Der Gebrauch literarischer Stilmittel wie Satire oder Ironie wäre mit der gleichen Begründung nicht mehr erlaubt (vgl. Gugel 2007, Kap. 4.3.5, S.20). In eine solche "ab 18"-Kategorie "nach Anspruch" fallen nun nicht mehr blutige Action- und Erotikfilme, sondern auch eigentlich tief reflektierte Werke wie "Der Reigen" von Max Ophüls (vgl. Stadtkind-Kino: "Der Reigen" (1950), abgerufen am 04.09.2008) oder "The Kiss" (Wikipedia: "The Kiss" (2003), abgerufen am 16.09.2008). Aber die Medienkritiker hatten ja nicht nach Ausnahmen gefragt, sondern haben generelle Regelungen angemahnt. Es kann ja nicht im Sinne des Medienkritikers sein, die Ansprüche zu reduzieren. Denn damit würde eigentlich eine größere Verbreitung der vordergründig als grundsätzlich schädlich dargestellten Medien erreicht (vgl. Wurm 2006, S.42).
(2) Die Alterseinstufung war ansonsten gerade darauf ausgerichtet, Personenkreise vor Inhalten zu schützen, die für diese noch nicht geeignet sind, wohl diese aber Personenkreisen zugänglich zu machen, bei denen diese gemutmaßte Gefährdung nicht mehr besteht. Eine Einschränkung über eine verantwortliche Alterseinstufung hinaus läßt sich angesichts der immer noch mehr durch intuitive Einschätzungen (vgl. Beckstein 2007, S.7: "Ich bin fest davon überzeugt...") denn durch widerspruchsfreie oder eindeutige wissenschaftliche Ergebnisse gestützten Aussagen über die Gefährlichkeit von Computerspielen als ein Versuch bewerten, weniger vor tatsächlichen Gefahren zu schützen als vielmehr eine bestimmte moralische Auffassung zu transportieren (vgl. TP: "Soll in der Virtualität erlaubt sein, was gefällt?", abgerufen am 08.05.2008).
a. Allerdings ist doch die Frage, ob eine Einschränkung, die Millionen potentieller Konsumenten betrifft, legitim ist, obwohl die Gruppe der jugendlichen Amokläufer, für deren Handeln das Computerspiel in der Argumentation z.B. von Uwe Schünemann als ursächlich gesehen wird, doch an einer Hand abzuzählen ist. Zum Beispiel wurde diese Einschränkung bei den "ungefährlichen Ertüchtigungen" Jagen und Schießen nicht gemacht, sondern wollte z.B. Beckstein in der Vergangenheit sogar eine Aufweichung bestehender Reglementierungen erreichen (), und viele Menschen haben Waffen zuhause, mit denen man nicht nur auf Scheiben oder auf Tiere schießen kann, sondern auch auf Menschen. Diese wurden nicht verboten, obwohl diese erstens gefährlicher sind als Computerspiele, bei denen m.W. keine Waffen mitgelifert werden, und zweitens doch einige Menschen auch mit diesen legalen Schußwaffen umgebracht werden.
b. Eine paradoxerweise auch damit verschränkte Bewegung ist, Jugendliche hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeit für eigene Taten immer mehr Erwachsenen anzunähern, etwa das Jugendstrafrecht zu verschärfen oder gleich ganz auszuhebeln. Eine z.B. in den USA häufig gehörte Argumentation gegen die Verwendung des Jugendstrafrechts oder gegen ein Jugendstrafrecht an sich ist, daß ein Jugendlicher, der eine Straftat begehe, über die Konsequenzen - nämlich die strafrechtliche Belangung - bescheid wissen müsse (vgl. "Teen may be tried as adult in fatality", [13/14 year old] "Teen charged with murder will be tried as an adult", abgerufen am 21.06.2008; dazu eine Google-Suche mit den Begriffen teen will be tried as an adult). Dies führte zu teilweise absonderlichen Fällen, wie etwa den des kleinen Raoul, der im Alter von zehn Jahren unter dem Verdacht des Mißbrauchs seiner kleinen Schwester mehrere Monate in einem Jugendgefängnis mit jugendlichen Verbrechern eingesperrt wurde (vgl. ). Dies ist tatsächlich aber nicht der Fall, Jugendliche können weitreichende Konsequenzen noch nicht absehen (vgl. ). Dabei bezeichnend ist, daß es eine Schnittmenge zwischen jenen, die Jugendliche als Konsumenten wie Kinder, die noch keine Einsicht in Gegebenheiten des Lebens haben, und jenen gibt, die sie als Straftäter aber zunehmend als Erwachsene behandelt sehen möchten, die eine Ahnung davon hätten, welche Konsequenzen ihr Handeln hätte (vgl. Cziesche und Freiburg 2002; "Stoiber fordert Verschärfung des Jugendstrafrechts", abgerufen am 21.06.2008).
(3) Auch kommt man nicht ohne Fehldeutungen aus. So wird zum Beispiel propagiert, daß die USK Werbetrailer für Spiele niedriger einstufe als die Spiele selbst. Dadurch könnten Jugendliche "verführt werden, sich solche Spiele illegal zu kaufen" (vgl. Höynck et al. 2007, S.3). Allerdings begehen die Jugendlichen damit keine illegale Handlung, sondern lediglich der Händler, der das Alter der Jugendlichen nicht kontrolliert und ihnen ein Spiel verkauft, das nicht für ihre Altersklasse geeignet angesehen wird. Ansonsten ist dies wohl auch für Kino- und Fernsehfilme üblich. So enthalten die "ab 12" freigegebenen Kinofilme "Der neunte Tag" und "Der Pianist", die beide zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen und auch noch die "ab 12" freigegebene um 47 Minuten (!) gekürzte Fassung des Films "Königreich der Himmel", teilweise noch für Erwachsene drastische und schockierende Szenen, die in Computerspielen vermutlich generell als indiskutabel angesehen würden. Zur Vergabepraxis fällt eben auch auf, daß eine gewisse historische Entwicklung stattgefunden hat. Filme, die doch wohl von Gewalt oder Sexualität gänzlich frei sind, z.B. deutlich rigider bewertet -- als mir auffälliges Beispiel sei etwa die Romanze "Der Traum meines Lebens" von 1955 genannt, die erst "ab 16" freigegeben ist (vgl. "Der Traum meines Lebens - Filmklassiker", abgerufen am 08.05.2008). Also geht man doch davon aus, daß heutige Kinder und Jugendliche im gleichen Alter mehr Erfahrungen mit Medien haben.
Die Argumentation, daß zugunsten des Schutzes von psychisch Kranken etc. auch niemand anders Computerspiele konsumieren dürfe, die diese Risikogruppen zu einer Gewalttat "verleiten" oder "provozieren" mögen, wird nun von verschiedenen Autoren wiederholt (vgl. auch Beckstein 2007, S.7). Allerdings ist im Nachklang der Bewertung (vgl. Punkt (7)) gar nicht klar, welche Tätigkeiten das denn überhaupt sein müssen. Schließlich kann ja auch kein vermeintlich durch Computerspiele gewalttätig Gemachter "nun vielleicht zur Waffe greifen" (vgl. Paulus 2008, S.71), dem keine Waffen verfügbar sind. Gerade vehemente Medienkritiker wie Beckstein und Schünemann ergehen sich allerdings heftig in der Brauchtumspflege, indem sie Jugendliche an vermeintlich "harmlose Ertüchtigungen" wie Schießen oder Jagen heranführen wollen (s.u.). Jugendlichen, die darauf anspringen, werden damit zum einen detaillierte Kenntnisse an realen Waffen, zum zweiten die Möglichkeit eröffnet, sich solche Waffen leicht zu beschaffen. Es ist davon auszugehen, daß die Fähigkeit und Motivation zur Benutzung von Waffen hier viel stärker vermittelt wird. Auch ist die Vorstellung illusorisch, daß "Problem"-Jugendliche, die sich jetzt im Schießen ergehen, durch Schießinstruktoren erkannt werden könnten: So konnte z.B. der spätere Amokläufer Robert Steinhäuser ohne Probleme im Schützenverein trainieren und Waffen erwerben. Wenn man nun aber ansetzen will, so erscheint es wiederum nicht logisch, etwas zu verbieten, das offenbar Millionen Menschen nicht zu Amokläufen "anstiftet", während etwas weiterhin erhalten bleiben soll, das im Sinne der Statistik tatsächlich für einen Großteil der dokumentierten Amokläufe notwendig war - nämlich die Verfügbarkeit von Waffen (s.u.; vgl. Bott 2002).
(4) Weiterhin unterstellten die Untersuchungen auch den Gutachtern der USK, sie seien möglicherweise selbst abgestumpft (vgl. Höynck et al. 2007, S.3). Allerdings entspricht diese Spitze mehr oder weniger einer "Hexenjagd", wobei in bester Tradition auch das Fehlen eines solchen Abstumpfungseffektes als Nachweis für einen solchen Effekt gewertet wird (vgl. dazu Kunczik und Zipfel 2006, S.).
(5) Das KFN kritisierte die USK dafür, daß sie Spielehersteller berate, wie Spiele gestaltet werden müßten, um eine bestimmte Bewertung zu erhalten (vgl. Höynck et al. 2007, S.3). Allerdings ist dies auch nicht unbedingt "problematisch". Schließlich ist die Entwicklung von Spielen ein aufwendiger und teurer Prozeß, und spätere Veränderungen von Spielen, so daß diese den deutschen Jugendschutzbestimmungen entsprechen, sind unter Umständen so tiefgreifend, daß die "deutsche" Version schließlich nicht mehr kompatibel zur internationalen Version ist. Will man den deutschen Markt erschließen, muß man entsprechend früh in der Entwicklung diese Anforderungen berücksichtigen (vgl. ). [Allerdings muß entsprechend berücksichtigt werden, daß eine "deutsche" Version auf dem internationalen Parkett nicht unbedingt absetzbar wäre. Entsprechend bleibt es dann auch bei der speziell deutschen Version.]
(6) Jedoch ist nicht klar, in wieweit es einem System des "Jugendschutzes" nutzen könne, diesem das Vertrauen zu entziehen. Bereits heute besitzt Deutschland die schärfsten Bestimmungen aller westlichen Industrieländer (vgl. "USK verwundert über Innenminister von Niedersachsen, Level 2", abgerufen am 28.11.2007). Andererseits wurde für Deutschland im Jahr 2009 die zweithöchste Rate von Amokläufen pro Bevölkerung weltweit reklamiert (). Wenn nun Deutschland härtere Bestimmungen hat als alle anderen westlichen Länder, in Ländern mit weniger harschen Bestimmungen aber niedrigere Raten von Amokläufen auftreten, liegt es nicht ganz nahe, wie weitere Verschärfungen in Bezug auf Computerspiele, etwa ein komplettes Verbot von Computerspielen mit Gewaltdarstellungen oder eine deutliche Hochstufung, z.B. die von Christian Pfeiffer geforderte Hochstufung von „World of Warcraft“ von „ab 12“ auf „ab 18“ (Q?) zu einer Verringerung von Amokläufen führen sollen.
(7) An der Studie fällt auf, daß das KFN das Bewertungsschema selbst entworfen und die Tester selbst geschult hatte und auch die Gutachten der USK von Mitarbeitern der KFN mit diesen Testberichten verglichen wurden (vgl. Höynck et al. 2007, S.1f.; Berthold+Holling 2007).
Auch ist beim Design des Bewertungsschemas natürlich das grundsätzliche Problem zu benennen, daß es überhaupt nicht möglich ist, "objektiv" zu bewerten. Dies zeigen eben auch gesetzliche Formulierungen wie in Ursula von der Leyens "Sofortprogramm" (s.u.), worin etwa "besonders" "realistische" Darstellungen als Indizierungskriterium angesehen werden. Man könnte zwar erst recht anfangen, so etwas wie "virtuelle Morde pro Stunde" zu zählen, aber es gibt in dem Sinne auch keinen objektiven Bewertungsmaßstab, welche Zahl denn nun für welche Altersgruppe "gefährlich" oder "ungefährlich" sei. Womöglich war man hier dem Glauben aufgesessen, daß man Alles und Jedes operationalisieren und damit zu vermeintlich „objektiven“ Bewertungen gelangen könne (vgl. dazu auch Berthold+Holling 2007).
(8) Schließlich stehen für Studien grundsätzlich eine Reihe von Manipulationstechiken zur Verfügung, mit denen ihre Aussage beeinflußt werden kann:
a. Die Bewertungskriterien hatte das KFN selbst entwickelt (vgl. Berthold+Holling 2007). Entsprechend bestand durchaus die Möglichkeit, die selbst entwickelten Bewertungskriterien solange anzupassen, bis das Ergebnis der Studie wie gewünscht aussah. Ein Beispiel für ein solches Vorgehen ist etwa der sogenannte „Religionsmonitor“ der Bertelsmann-Stiftung, der schließlich das für die religiösen Gemeinschaften sensationelle Ergebnis lieferte, 70 Prozent der Deutschen seien religiös, 28 Prozent sogar „hochreligiös“. Tatsächlich waren diese Punktwerte aber ein Resultat der letztlichen Aggregation der einzelnen Fragen: Demnach wurde bereits als „religiös“ beurteilt, wer oft über religiöse Themen nachdachte oder in seiner Kindheit religiös erzogen wurde – gleich als wie religionsfern er sich selbst einschätzte. Allein durch Verschieben der Grenzwerte für die einzelnen Kategorien „nicht religiös“, „religiös“ und „hochreligiös“ konnte hier praktisch eine beliebige Erwartung generiert werden (vgl. "70% der Bundesbürger religiös"? Nein., abgerufen am 26.06.2009).
b. Andere Methoden betreffen die Fragentechnik: So ist es letztlich möglich, durch die Stellung der Fragen oder die Menge der zur Verfügung gestellten Alternativen letztlich die erwünschte Antwort bereits zu suggerieren. Ein Beispiel hierfür sind zwei Studien, die von ein und demselben Institut durchgeführt worden waren, einmal im Auftrag des Bundesinnenministeriums und einmal im Auftrag der Gegner einer Zensurinfrastruktur für das Internet. Diese lieferten diametral entgegengesetzte Antworten, waren im ersteren Falle über 90% der Bürger „für“ Internetsperren, im letzteren Falle aber über 90% dagegen (vgl. ).
(9) Berthold+Holling (2007) fanden aber zumindest, daß die letztliche Alterseinstufung eines Spiels hauptsächlich vom Urteil eines einzelnen Testers abhänge. Zwar werde dessen Testbericht . Andererseits bestand bei der Beurteilung durch das KFN in jeder Stufe das Risiko einer verminderten Objektivität dadurch, daß an der Durchführung der Studie im Personen mit einem relativ homogenen Mindset beteiligt gewesen seien: So seien sowohl die Mitarbeiter, die als „Filter“ für den Bericht des Testers dienten, als auch das Beurteilungsteam Mitglieder des KFN gewesen.
Dementsprechend kann man hier gerade nicht sagen, daß die eigene Meßmethode "besser" oder "richtiger" sei als eine andere. .
(10) Schließlich forderte Pfeiffer, zukünftig eine Abgabe von fünfzig Cent pro verkauftem Computerspiel zu erheben, die dann für Therapien gegen Computerspielsucht und für Medienwirkungsforschung eingesetzt werden solle. Er rechnet mit einem Betrag von circa 20 Millionen Euro pro Jahr. Und "Medienwirkungsforschung" betreibt (vermeintlich, so hatte man sich nicht explizit mit den Medien selbst beschäftigt) das KFN. So schließt sich einer der Kreise, die mit der Diskussion aufgeworfen wurden. Entsprechend wird das KFN von einigen Personen, die sich mit der Medienkritik auseinandergesetzt haben, auch eher an den Geldmitteln interessiert gesehen, die sich aus der Übernahme der Bewertungsaufgabe für Computerspiele ergäben, als am "Wohl der Jugend" (vgl. Müller 2006d, S.4).
(11) Im Zusammenhang damit ist allerdings interessant, daß selbst die Mitarbeiter des KFN das so vielgescholtene "Counterstrike" nicht als besonders gefährlich einstufen, weil dort der "Wettbewerbscharakter" dominiere (vgl. Opielka 2007), und auch unter den Mitarbeitern des KFN Christian Pfeiffer der einzige ist, der zusätzliche Gesetze fordert, die zum Beispiel gewalthaltige Computerspiele als grundsätzlich "gewaltverherrlichend" verbieten (vgl. Höynck et al. 2007, S.4).
[(12) Wohlgemerkt dreht es sich bei den von Pfeiffer geforderten Hochstufungen nicht um die Frage, wieviele in irgendeinem Qualitätsmaßstab „gute“ Filme oder Computerspiele es gibt, die „ab 16“ oder „ab 18“ freigegeben sind. Zuerst ist „Geschmack“ ein höchst subjektives Kriterium. Zweitens erhalte ich auch Feedback von Menschen, die sich durch die Vorstellung von Regulierungsbehörden, Medienwissenschaftlern usw. beschnitten fühlen, sie wüßten besser als die Menschen selbst, was für diese sich anzusehen „moralisch“ sei. Die Gesetzgebung hat z.B. auf durchaus subjektive Kriterien wie „gewaltverherrlichend“ (für Medienkritiker scheint bereits die Darstellung von Gewalt, die Möglichkeit, selbst Gewalt auszuüben oder daß man im Spiel für Gewaltausübung Punkte bekommen könne, dieses Kriterium zu erfüllen) oder „besonders realistische Darstellung“ (vermutlich will sich auch keiner der Beurteiler manche Dinge in der Realität ansehen, um zu vergleichen, wie wirklichkeitsnah eine virtuelle Figur auf einen Schlag auf den Kopf reagiert) nicht verzichten können, weil „objektive“ Kriterien wie das Auszählen der „Toten pro Stunde“, das einige Medienkritiker schon einmal durchgeführt hatten, eben für eine Bewertung auch nicht tauglich sind. Ganz außenvor bleiben sollte sie aber auch nicht, . Letztlich ist eine Bewertung also immer ein Kompromiß.]
2.1.2.4. Angriffe auf Medienwissenschaftler
Nachdem die KFN-Gutachter angesichts der ihrer Meinung nach nicht ausreichend rigiden Bewertungspraxis den USK-Gutachtern eine eigene Abstumpfung und finanzielle Interessen unterstellt hatten, durfte weiterhin auch kein gutes Haar an Einlassungen anderer Medienwissenschaftler gelassen werden. Jürgen Fritz, der seiner Aussage nach selbst spielt und auch Spieler nach ihren Beweggründen zum und Empfindungen beim Spielen befragt, hatte im Jahr 2008 einen Sammelband mit dem Titel "Computerspiele(r) verstehen - Zugänge zu virtuellen Spielwelten für Eltern und Pädagogen" veröffentlicht. Diesen hatte das KFN unter dem Titel "Verharmlosung und Beschwichtigung" rezensiert (vgl. Kleimann et al. 2008). Nun mögen einige Kritiken daran durchaus gerechtfertigt sein. Andere Kritiken aber erscheinen tatsächlich darauf ausgerichtet, daß man sich gar nicht mit dem als gefährlich angesehenen Medium auseinandersetzen dürfte, weil man sich dadurch als "seriöser Gesprächspartner" diskredierte, oder man zu dem Eindruck gekommen wäre, daß es sich bei den Spielern nicht um rechtsradikale Psychopathen handelt.
- Fritz äußerte bereits in der Einleitung des Buches, daß man eine virtuelle Welt nicht den gleichen Werturteilen unterwerfen könne wie die reale Welt, und daß unbeteiligte Beobachter auch einen anderen Blick auf das Spiel einnehmen als die Spieler und damit zu anderen Werten kommen können (vgl. ebd., S.3).
- In dem genannten Sammelband habe man sich nicht dezidiert mit der Problematik der Computerspielsucht auseinandergesetzt (vgl. ebd., S.3f.). Tatsächlich ist es aber so gar nicht klar, ob es wirklich eine Computerspielsucht als ein eigenständiges Krankheitsbild gibt. So ist etwa der von "Panorama" oder ähnlichen Magazinen auch schon einmal bemühte Bert te Wildt (vgl. hier eine einfache - und sachlich falsche - Ursache-Wirkung-Aussage aus einem Interview von 2007, abgerufen am 23.09.2008) eher der Meinung, daß es sich bei der vermeintlichen Sucht eher um ein Symptom anderer Krankheitsbilder handelt (vgl. ).
- Die Darstellung einer qualitativen Befragung von jeweils drei Müttern und Vätern, die keine eigenen Spielerfahrungen hatten, die erbracht hatte, daß diese das Spielen ihrer Kinder rigide reglementierten, weil sie andere Tätigkeiten als "sinnvoller[.]" ansahen oder um Auswirkungen auf den Schulerfolg oder der enthaltenen Gewalt fürchteten, kommentierten die KFN-Autoren damit, daß die Sicht dieser Eltern auf Computerspiele "durchaus realistisch[.]" sei (vgl. ebd., S.4). Nun kann es allerdings nicht wirklich wünschenswert oder positiv zu beurteilen sein, sich durch keinerlei oder nur wenig Wissen getrübte Urteile über Sachverhalte zu bilden. All zu leicht ergeben sich darüber Fehlschlüsse. Betrachtet man allerdings die Medienpr„senz der Medienkritiker, so kommt man kaum umhin, daß es gerade das Bestreben sei, einen bestimmten Eindruck über das Wesen von Computerspielen zu schaffen.
- Andererseits kritisierten die KFN-Autoren, daß die Fritz-Autoren beklagt hätten, daß Eltern ihre Informationen über mutmaßliche Auswirkungen des Spielens vor allem aus der nicht eben neutralen Berichterstattung in den Medien bezögen (vgl. ebd., S.4).
Weiterhin läßt sich an vielerlei Beiträgen von Medienkritikern feststellen, daß darin auch viel Wert auf eine in Wort und ggf. auch im Bild möglichst plakative Darstellung gelegt wurde, um insbesondere Computerspiele als gefährlich darzustellen (vgl. etwa die Beiträge von Anderson und Bushman, von Steckel und Trudewind, von Hopf, Weiß oder Häckel und Häckel). Solche Beitragskonstruktionen - indessen auch von dem höchst medienwirksamen Christian Pfeiffer - kommen natürlich in den Medien am häufigsten vor, während Untersuchungen, die sich hier zurücknehmen, kaum oder nur thematisiert werden, um sie zu verlachen (vgl. etwa bei "Frontal 21").
"Die
Wissenschaft leidet darunter, wenn sie durch Sachkenntnis
verschmutzt wird."
(Klaus Peter Jantke in Replik auf
Vorträge von Medienkritikern, zitiert nach "Ein
Erfahrungsbericht vom Symposium 'Spielewelten der Zukunft'")
In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, daß das Personal, das auf groß beworbenen "internationale(n) Kongress(en)" erscheint, sich dann auch weitgehend aus diesem Personenkreis (hier: Lukesch, Gentile, Hopf, Huber, Weiß, Mößle vom KFN und Rainer Fromm (siehe I.2.2.8 und I.2.2.10)) rekrutiert, die sich jeweils im Vorfeld durch nicht eben objektiv, teilweise nicht einmal rational erscheinende Äußerungen gegenüber Computerspielen oder Medien als solchen hervorgetan hatten und sich weitgehend über die Konsequenzen einig sind (vgl. Internationaler Kongress: "Computerspiele und Gewalt"; o.V. 2008). Auch auf diesem Kongreß wurden entsprechend heftige Worte wie "Schweinefirma" für Hersteller von gewalthaltigen Computerspielen gefunden und argumentativ Strategiespiele in die Nähe des Holocausts gerückt wurden ("Münchner Spielekongress: Gipfeltreffen der Spielekiller", abgerufen am 24.11.2008). (In diesem Zusammenhang wurde auch bei Rainer Fromm schon einmal festgestellt, daß es ihm nicht darum ging, konstruktiv zu argumentieren. Bei Strategiespielen bemängelte er bereits sowohl das Vorhandensein von Darstellungen von Kriegsgreueln als auch deren Fehlen.) Man kann hier also schon eine bestimmte Intention unterstellen. Erwartungsgemäß erhielt der "Kongress" denn auch politische Unterstützung ("Neue Studien bestätigen Innenminister Joachim Herrmann: 'Killerspiele verbieten - Gewaltspiele am Computer stumpfen ab und machen aggressiv'") und auch eine breitere Medienpräsenz (vgl. etwa Nordwig 2008). Denn wenn Journalisten von solchen "Kongressen" hören, werden sie weder die Neutralität der Akteure oder deren Methoden beurteilen, sondern die dort aufgestellten Behauptungen einfach einmal ungeprüft wiederholen und sich danach für ihre "gute journalistische Arbeit" loben. Da diese Berichterstattung i.a. als "seriös" gilt und entsprechend einen gewissen Vertrauensvorschuß genießt, werden dadurch viele Menschen, diesich bisher noch keine Meinung dazu gebildet haben, entsprechend negativ beeinflußt. Gegenpositionen oder selbst noch die Einschränkungen, die Autoren der dort angeführten Studien machen, etwa Weber et al. (2006) (siehe II.2.3), erscheinen erfahrungsgemäß nur in Spielezeitschriften erscheinen, die sich ohnehin primär an Personen richten, die Computerspiele nun nicht in Bausch und Bogen ablehnen, und von "Frontal 21", "Panorama" und Medienkritikern als "nicht neutral" dargestellt, verlacht oder selbst als höchst gefährliche kommerziell motivierte Verführer dargestellt werden.
"Sehr geehrter Volksvertreter, bist du
wirklich unser Mann.
Wenn du loslegst vom Katheder, ist es, als
legst du auf uns an."
(Gerulf Pannach, Texter der „Klaus
Renft Combo“, zitiert nach "Radio
Glasnost", abgerufen am 15.08.2009)
Nicht nur werden Computerspieler ja als nicht altersgemäß entwickelte (siehe Regine Pfeiffer), dumme oder geistesschwache Menschen (siehe Sabine Scheffer) dargestellt. Auch beliebt sind indessen auch Vergleiche mit Kriminellen. Im Hinblick darauf noch schwach war es, daß Heiko Maas, der SPD-Spitzenkandidat im Saarland, Computerspieler mit Ladendieben verglich (vgl. "Paintballcheck", abgerufen am 15.08.2009). Für seinen Vergleich von gewalthaltigen Spielen mit Kinderpornographie wurde Joachim Herrmann sehr gescholten, und viele Menschen mögen sich dadurch beleidigt gefühlt haben, als Konsumenten von gewalthaltigen Spielen mit Personen gleichgesetzt zu werden, die Kindesmißbrauch unterstützen. Womit ja auch die Intention einer gesellschaftlichen Ächtung verbunden ist. Anstatt diesen Vergleich allerdings zurückzunehmen und dafür um Entschuldigung zu bitten – nicht allein der Computerspieler wegen, sondern auch und gerade wegen der Mißbrauchsopfer, deren Leid real und damit in keinster Weise mit dem von Polygonfiguren zu vergleichen ist -, legte Herrmann noch nach, und behauptete, „dass Menschen, die auf ihren Computern aktiv reihenweise Leute umbringen, die am Boden liegende angeschossene Opfern (sic!) 'regelrecht hinrichten', so dass das Blut spritzt – […] sich“ wohl kaum „durch [s]eine Worte verletzt fühlen könn[t]en“. So versuchte Herrmann, seine Angriffe gegen Computerspieler mit seiner eigenen Weltanschauung zu rechtfertigen: Sie dürften sich nicht gegen seine beleidigenden Angriffe wehren, weil er eben der Meinung sei, diese seien moralisch auf eine Stufe mit den Unterstützern des Kindesmißbrauchs zu stellen – und dies ist im Sinne der „Knasthierarchie“ die unterste Stufe an Wertigkeit, die ein Mensch haben kann (vgl. hierzu Wikipedia: Ad hominem, abgerufen am 25.07.2009).
Mit diesem Zirkelschluß – oder genauer „Beweis durch eigenes Vorurteil“ - liefert Herrmann einerseits die Erlaubnis, Menschen allein aufgrund seiner eigenen Vorurteile zu diffamieren, und andererseits auch einen erschreckenden Einblick in seine eigene Geistesverfassung. So war es in der Vergangenheit ungute Tradition, gegen Menschen aggressiv vorzugehen, wenn nur das Vorurteil es erlaubt: Anekdotisch gibt es die Geschichte des sogenannten „Simon von Trient“. Dabei handelte es sich um ein Kleinkind, das im Jahr 1475 aus der Stadt Trient verschwunden war und das wenig später tot aufgefunden wurde. Da nun „allgemein bekannt“ war, daß Juden für ihre Rituale das Blut von christlichen Kleinkindern gebrauchten, wie ein bekannter Haßprediger glaubhaft behauptet hatte, verhaftete man etliche jüdische Bewohner der Stadt. Dies endete mit dem Tod von mehreren von ihnen, der Rest der Juden von Trient wurde vertrieben. In der Folge führte die Kunde von dem vermeintlich von Juden begangenen Kindermord europaweit zu Pogromen gegen die Juden. Noch bis 1965 wurde „Simon von Trient“ von der katholischen Kirche als Märtyrer verehrt, erst dann setzte sich die Auffassung durch, daß derartige „Märtyrerberichte“ ihren Teil zu dem Haß beigetragen hatten, der zum Massenmord an Millionen von Juden geführt hatte. Diese Todesurteile waren „Resultat eines einwandfreien rechtsstaatlichen Verfahrens“ gewesen, bei dem man sich damals üblicher „Ermittlungsmethoden“ wie der Folter bedient hatte (vgl. Wikipedia: "Simon of Trent", abgerufen am 15.08.2009). Die Beschuldigten hatten also gegen die haltlosen Beschuldigungen keine Hilfe zu erwarten. Und tatsächlich erhielt Herrmann für seine Argumentation auch Rückdeckung durch die „Rechtspfleger“, setzten sich damit in diese unheilige Tradition:
Da andererseits aber die Gruppe der Computerspieler als solche viel zu heterogen ist, als daß sie sich der Anschauung der Staatsanwalt Darmstadt nach durch äußere Merkmale abgrenzen ließe, wurde hier von staatlicher Seite bestätigt, daß die Computerspieler nicht als „Teil(.) der Bevölkerung“ gelten können, geschweige denn sich dadurch beleidigt fühlen dürfen (vgl. "Staatsanwaltschaft: Kinderpornographievergleich ist gerechtfertigt", abgerufen am 15.05.2009). Schließlich legte Herrmann auf Kritik der eigenen Parteijugend „Junge Union“ und des „Bundes der katholischen Jugend“ noch weiter nach, daß diese ja nicht wüßten, „wie brutal und gewaltverherrlichend solche Killerspiele [seien]“ (vgl. "Herrmann legt sich mit BDKJ an", abgerufen am 23.05.2009). Damit bekräftigte er noch einmal seine Position, daß „ordentliche“ Menschen (die Gleichsetzung zwischen konservativ oder katholisch und „ordentlich“ ist einigermaßen typisch) sich mit solchen Inhalten ja nicht auseinandersetzten, versuchte also, die Computerspieler auszugrenzen und als kleine Minderheit darzustellen. Zusammen mit dem Kinderpornographie-Vergleich sollte hier also ein Szenario geschaffen werden, unter dem es legitim erscheinen sollte, gegen diese vorzugehen.
(Zur Anmerkung: Der Holocaust ist eine bittere „Argumentationskeule“, gegen die ein Mensch, dem gegenüber sie angewandt wird, kaum mehr wechseln kann. Und es wird auch von vielen Juden als beleidigend empfunden, wenn der Begriff, wie in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel im Hinblick auf die Lebensverhältnisse der Palästinenser oder auf die Abtreibung geschehen, verwendet und die massenhafte Tötung der Juden durch die deutschen Faschisten und ihre Verbündeten im zweiten Weltkrieg dadurch auf gewisse Weise relativiert wird. Allerdings ist auch die industrialisierte Tötung von Menschen nicht aus einer spontanen Laune oder aus der singulären Geisteshaltung Adolf Hitlers entstanden, sondern sind das Produkt von Jahrhunderten bewußter oder unbewußter Erziehung. Derartige Muster oder die Empfänglichkeit für Haßbotschaften waren den Menschen anerzogen worden und entsprechend leicht abrufbar. Und auch die Nationalsozialisten begannen ihr Vorgehen gegen die Juden mit kleinen Aktionen wie Plakataktionen und Boykottaufrufen, auch mit der Intention, zu überprüfen, in wieweit die Bevölkerung dies tolerieren würde. Damals waren allerdings viele Menschen „unpolitisch“ oder sahen die Handlungen der Nazis zunächst als „Spuk“ an, der sich bald legen würde, und nachher hieß es, man habe sich nicht vorstellen können, daß sich derartige Mordaktionen anschließen würden. Argumentationen, die Politiker hier gegen Computerspieler gebrauchen, folgen denselben Mustern, wie in der Vorvergangenheit gegen die Juden angewendet wurden und schlagen damit in die Grundlagen dieses Massenmordes hinein. Wenigstens die Konsequenzen, die dies im geschichtlichen Präzedenzfall hatte, hätten sie eigentlich darüber belehren sollen, von derartigen Diffamierungen und Versuchen zur gesellschaftlichen Ausgrenzung abzusehen. Daß dies nicht geschah, wirft meiner Auffassung nach die Frage auf, in wieweit diese Politiker für eine demokratische Gesellschaft noch tragbar sind.)
Seine Aussagen zeugten allerdings auch nicht von Sachkenntnis: Es bleibt absolut offen, auf welches Spiel sich Herrmann bezog, ein solches ist mir nicht bekannt bzw. waren zum Beispiel die einzigen Aufnahmen, die suggerierten, man könne „am Boden liegende angeschossene Opfern (sic!) 'regelrecht hinrichten'“, gestellte Aufnahmen aus einem „Panorama“-Bericht, in dem ein absolut spieleruntypisches Verhalten dargestellt wurde. Nicht zuletzt beklagten auch die USK-Tester, die sich gegen die Vorwürfe von Christian Pfeiffer wehrten, daß dadurch bewußt ein falscher Eindruck über Spiele vermittelt werde (vgl. ). Schließlich sehen die weitaus meisten Spieler „Counterstrike“ oder die nachträglich ebenfalls auf die Liste der „Killerspiele“ gesetzten „World of Warcraft“ oder „Warcraft III“ nicht anders an als die „Killerspiele“ Schach, Risiko oder Monopoly. Weiterhin wurde er zitiert, daß derartige Spiele zu verbieten seien, obwohl dies überhaupt keine Verschärfung gegenüber der aktuellen Rechtslage darstellt (vgl. "Herrmann legt sich mit BDKJ an", abgerufen am 23.05.2009). Herrmann definierte lediglich eine andere „Geschmacksgrenze“ als beispielsweise die USK, und wollte diesen seinen mutmaßlich persönlichen Geschmack zum Maßstab für die Beurteilung machen.
Und nicht einmal die „schädlichen Wirkungen von Kinderpornographie“, die Herrmann und die Staatsanwaltschaft behauptet hatten, sind m.W. so empirisch belegt. Natürlich ist es ethisch nicht zu rechtfertigen, dies auch mit Kinderpornographie zu untersuchen. Nach allen mir bekannten Studien vergrößert allerdings der Konsum von Pornographie alles in allem aber nicht die Wahrscheinlichkeit, selbst danach eine Sexualstraftat zu begehen. Letztlich hatte Herrmann damit die Haltung vermittelt, das eigene Weltbild und die eigene verfälschte Anschauung sei Rechtfertigung genug, selbst nachgewiesen falsche Behauptungen wiederholen und Menschen ihre Rechte absprechen zu können. Somit war es für die nichtchristlichen Römer auch allgemein bewiesen und offenkundig, daß Christen Menschenfleisch aßen und Blut tranken, wenn sie im Abendmahl davon sprachen, und auch der christliche Hexenwahn an der Wende zur Neuzeit war gerechtfertigt, weil damit eine gefährliche internationale Verschwörung bekämpft wurde... Vermutlich können Innenminister auch gar nicht anders, als sich rhetorischer Formen zu bedienen, mit denen totalitäre Regimes weltweit und immer wieder auch der Mob gegen „innere“ und „äußere Feinde“ angehen.
Schließlich ist diese Aussage auch beleidigend gegenüber den Opfern realen Mißbrauchs, die diesen ganz und gar nicht nur in einer virtuellen Darstellung erfahren haben.
"Ich wette, [Robert Steinhäuser] hat
sich am Tag seines Schützenausflugs wirklich gewundert, warum
kein Fadenkreuz in der Luft schwebt, wieso er nicht mit 'R'
nachladen kann und weshalb [...] es einen Rückstoß
gibt."
(Schmidt 2007b)
- Daß auch Autoren, die Computerspielen vielleicht eher positiv betrachten, teilweise merkwürdige Vorstellungen haben mögen, zeigt ein Beitrag von Tanja Witting im Fritz-Sammelband. Darin heißt es, daß ein Autorennspiel dazu führen könne, daß Spieler "nach längeren Spielsitzungen unreflektiert mit automatisierten Handlungen" auf die reale Welt reagierten, indem sie etwa im Auto nach einer Taste suchten, um in den Rückspiegel blicken zu können (vgl. S.12). Ähnlich hatte der Medienkritiker Manfred Spitzer behauptet, nachdem ein Jugendlicher ein Spiel gespielt habe, in dem man den Gegner mit Tritten bearbeiten könne, sei er losgegangen und habe einen anderen, ihm Wildfremden totgetreten (vgl. Miehling „Gewaltmusik-Nachrichtenbrief“ Nr.63 vom 02.05.2009). Das kann man u.U. aber auch als bösen Witz ansehen: Die hier aufgestellte These von einem Realitätstransfer bzw. Realitätsverlust des vermeintlichen "Counterstrike"-Spielers Robert Steinhäuser hatte einmal ein Spieler genauso kommentiert (s.o.).
2.1.2.5. Pfeiffer und die Computerspielsucht
Eine weitere Möglichkeit, gegen Computerspiele vorzugehen, läßt Christian Pfeiffer auch nicht aus. Als neueste Inkarnation will Pfeiffer natürlich auch das Suchtpotential von Spielen untersucht sehen. So hatte die KFN im Rahmen eines Projektes zur "Computerspielsucht" im Oktober 2007 zwei Diplomarbeiten ausgeschrieben, wobei es unter anderem darum ging, Determinanten des Suchtpotentials von Computerspielen herauszuarbeiten. Insbesondere wurde dabei natürlich hypothetisch der Zeitbedarf genannt, der für den Spielerfolg notwendig ist. Nun sollte im Rahmen dieses Projektes auch erörtert werden, ob nicht ggf. die Computerspielsucht ein Symptom anderer Erkrankungen ist (vgl. http://www.kfn.de/.../Computerspielsucht.htm; abgerufen am 31.10.2007). Allerdings würde Pfeiffer, wenn zum Beispiel ein starker statistischer Zusammenhang zu Depressionen oder sozialen Phobien aufträte - wer Angst vor seiner Umgebung hat, würde sich mehr abkapseln und mehr am Computer spielen -, sich vielleicht gleich wieder zu der Behauptung hinreißen lassen, daß Computerspiele Depressionen oder soziale Phobien auslösten. Und auch die Größe der Spielkomplexität wäre für den Medienkritiker dann auch in doppelter Hinsicht interessant: Nachdem er zum Beispiel durchgedrückt hätte, daß Jugendlichen Spiele nicht mehr zugänglich gemacht werden dürfen, deren Beendigung oder allzumal auch deren Beherrschung länger dauert als ein beispielsweise von ihm willkürlich festgesetzter Schwellwert oder die einen gewissen Wiederspielwert haben, könnte er sich danach hinstellen und zu den Jugendlichen sagen: "Warum spielt Ihr Dinge, die dermaßen anspruchslos sind?"
Tatsächlich wurde sogar „zeitgerecht“ nach einem Amoklauf im baden-württembergischen Winnenden, bei dem ein 17jähriger in seiner ehemaligen Schule und auf einer anschließenden Irrfahrt 15 Menschen getötet hatte, für die nächste Ausgabe des „Spiegel“ einmal wieder „alarmierende Ergebnisse(.)“ des KFN aus seiner Schülerbefragung angekündigt, nach denen nun endlich „bewiesen“ werden sollte, daß unter den deutschen Neuntklässlern Zehntausende seien, die nach medizinischen Kriterien „computer(spiel)“- bzw. „internetsüchtig“ seien (vgl. "Jugendstudie: Zehntausende Schüler sind computerspielsüchtig", abgerufen am 14.03.2009). Tatsächlich aber hatte es bereits im Vorfeld verschiedene solcher Veröffentlichungen gegeben (vgl. Pfeiffer et al. 2007; KFN 2008; Rehbein+Borchers 2009), die allerdings damals mangels eines Amoklaufs nicht genügend kolportiert worden waren.
Als Untersuchungsgrundlage waren allgemeine Kriterien zugrundegelegt worden, die gemäß ICD-10 als Kennzeichen einer Abhängigkeit gelten. Daneben wurden Kriterien betrachtet, die nicht Bestandteil dieser Standarddefinition sind, wie etwa eine „dysfunktionale Stressregulation“ oder die Spielzeit (vgl. Rehbein+Borchers 2009, S.43). Allerdings existiert bis heute keine medizinische Definition eines Krankheitsbildes „Computer(spiel)sucht“. Darüber hinaus wird es als kritisch angesehen, einfach Kriterien zu übernehmen, um sie auf ein neues mutmaßliches Krankheitsbild anzuwenden (vgl. Blaszczynski 2007). Ansonsten kann eine Untersuchung zunächst einmal nur aussagen, daß exzessive Spieler gewisse Eigenschaften mit Süchtigen gemein haben, nicht aber, daß Computerspiele selbst Suchtmittel darstellen (vgl. Clark 2006, S.70). Rehbein+Borchers (2009) bemerken selbst, daß aufgrund solcher Kriteriensetzungen möglicherweise engagierte Spieler als fälschlicherweise als süchtig oder nicht-süchtig eingestuft werden könnten (vgl. dort, S.45f.).
Daneben konnte sich die Untersuchung auf bestimmte Faktoren nicht beziehen, die hier ausgeblendet wurden: Vermutlich wurden Faktoren wie psychische Erkrankungen im Rahmen der Studie überhaupt nicht erfaßt. So bemerken Psychologen wie auch der eigentlich eher medienkritische Bert te Wildt, daß die vermeintliche „Computer(spiel)“- oder „Internetsucht“ eher wie ein Symptom anderer psychischer Probleme erscheine (). Ein Beispiel hierfür mögen soziale Phobien sein. Andererseits fühlen sich viele Jugendliche von ihrer Umwelt ausgegrenzt und einsam. Internetkontakte und auch Spiele wie „World of Warcraft“ können in dieser Hinsicht eher als – wenn auch inadäquate und beschränkte – Versuche sein, wieder mit der Umwelt in Kontakt zu treten. So ersetzen die Spiele verstärkt die üblichen Umweltkontakte, so daß das Spielen „exzessiv“ erscheint.
Schließlich sollte man Studien, die aufgrund von selbst gewählten Kriterien Menschen in bestimmte Kategorien einordnen, mit Vorsicht genießen. So hatte das KFN in seinen Untersuchungen bereits Spieler, die mindestens einmal pro Woche gewalthaltige Spiele konsumierten, als „häufige“ Spieler eingestuft (vgl. Baier et al. 2009, S.68). Nun hatte man auch hier verschiedene Merkmale zugrundegelegt, um ein Spielen, das einfach lange dauerte, von einem „suchtartige[n]“ zu unterscheiden, so daß – bei einem Anteil von 25.7% der männlichen Neuntklässler, die laut (KFN 2008) im Schnitt pro Tag vier Stunden oder mehr mit Computerspielen verbracht hätten -, ungefähr 9% „suchtartige(.)“ Spieler oder zumindest suchtgefährdet seien. Allerdings wurden auch hier als „Schätzgrenze“ etwa vier Stunden pro Tag angegeben (vgl. KFN 2008, S.3). Die Dauer schien also hier eine sehr hohe Gewichtung zu haben. Tatsächlich wurden die 9% von Rehbein+Borchers (2009) dann wieder auf „exzessive“, d.h. einfach langfristig spielende Jungen bezogen, während sie die Anzahl der Jungen, die nach den eigenen Diagnosekriterien als „abhängig“ eingestuft wurden, mit 2.7% angaben (für Mädchen betragen diese Anteile 2.3% bzw. 0.3%) (vgl. dort, S.46).
Für die Untersuchung der „Suchtstatistik“ hatte man im Rahmen der KFN-Schülerbefragung 2005 den Schülern einen Katalog von Fragen gestellt, der sich etwa darauf bezog, daß die Jugendlichen weiterspielten, trotzdem ihre Schulleistungen oder privaten Kontakte darunter litten; sie sich dabei ertappt hätten, länger zu spielen als gewollt; oder ihre Gedanken auch außerhalb der Spielzeit um das Spielen kreisten (vgl. Rehbein+Borchers 2009, S.44). Hier ist zum einen zu bemerken, daß die Fragen in jeder Kategorie allesamt sehr gleichlautend waren – wir wollen hoffen, daß sie dann auch i.w. nur einfach gezählt wurden –, und zum anderen, daß - auf einer vierwertigen Skala – die Mittelwerte doch alle recht niedrig, unterhalb von „stimmt kaum“ lagen (so bezogen auf die Frage „Wenn ich längere Zeit nicht spiele, werde ich unruhig und nervös“ mit 1.21 und „[Ich] ertappe […] mich häufig dabei, dass ich sage: 'Nur noch ein paar Minuten', und dann kann ich doch nicht aufhören“ mit 1.84). Als Grundlage für die Unterschiedung zwischen „häufigen“ und „exzessiven“ Spielern wurde hier wieder auf einen anderen Aufsatz zurückgegriffen, der sich allerdings mit der Internetsucht beschäftigte (Hahn+Jerusalem 2001; vgl. Rehbein+Borchers 2009, S.44).
Allein der Umstand, daß 21.9% der befragten Jugendlichen (in der Regel befragte das KFN Neuntklässler, vgl. KFN 2008, S.3; Baier et al. (2009) befragten 11-19jährige, vgl. dort, S.7) angaben, mindestens einmal in den letzten zwölf Monaten ein „ab 16“ und 16.2%, ein „ab 18“ freigegebenes Spiel gespielt zu haben (vgl. ebd., S.67), wurde dann die Forderung abgeleitet, Kindern und Jugendlichen keine „Bildschirmgeräte“ (also Fernsehapparate, Spielkonsolen oder Computer) zur Verfügung zu stellen und ihren Medienkonsum zu kontrollieren (vgl. ebd., S.69). Allerdings ist eine Altersgrenze eben keine „absolute Grenze“, kann ein bestimmter 15jähriger mit Inhalten „ab 16“ möglicherweise besser umgehen als ein bestimmter 17jähriger. Vermutlich sind aber auch mehr als 21.9% der Gruppe zwischen 11 und 19 älter als 16 Jahre alt.
Auch ist die Verbotsforderung von Pfeiffer, der sich u.a. Christina Haderthauser (CSU) angeschlossen und mit Pfeiffers Befunden zur Computerspielsucht begründet hatte (vgl. "WoW ein 'Killerspiel'", abgerufen am 01.05.2009), nicht sachlich gerechtfertigt. So gibt es in den Einstellungen des Spiels „World of Warcraft“ einen expliziten Punkt „Elterliche Freigabe“, in dem Eltern – oder für als suchtgefährdet Angesehene ggf. auch deren Angehörige oder Betreuer - festlegen können, wann den jeweiligen Spielern die Benutzung erlaubt ist (vgl. World of Warcraft Europe: "Elterliche Freigabe", abgerufen am 03.05.2009). Weil also die Eltern nicht in der Lage seien, dem Spielekonsum ihrer Kinder Grenzen zu setzen, und man andererseits (in Anlehnung an Manfred Spitzer) ihnen auch nicht so etwas wie Medienkompetenz oder Interesse für die Freizeitbeschäftigungen ihrer Kinder vermitteln darf, sieht sich einfach wieder die Politik genötigt, die Rolle des Vormundes zu spielen.
2.1.2.6. Die "Hit-and-Run"-Strategie
Nicht nur hat Christian Pfeiffer in Wirklichkeit keine Ahnung von den Inhalten der Spiele, die er als Verursacher von Jugendgewalt kritisiert (vgl. Lindemann 2008). Sondern es scheint in den Auftritten des selbsternannten Experten mehr oder weniger ein durchgängiges Muster zu geben. So suche sich Pfeiffer anscheinend seine Forschungsthemen nach dem Medieninteresse aus, das an diesen bestehe, und sei bestrebt, mit möglichst medienwirksamen - und dies heißt kontroversen - Thesen aufzutreten. So hatte er in der Vergangenheit bereits die hohe Ausländerfeindlichkeit in den neuen Bundesländern auf die Erziehung in der DDR zurückgeführt und auch bekundet, mit Sicherheit handle es sich bei dem Ertrinkenstod eines kleinen Jungen in einem Freibad in Sachsen um einen Mord, der durch Rechtsradikale begangen worden sei. Stets formulierte er Thesen als "Steilvorlagen" gegen Menschen, seien es zum Beispiel auch Ostdeutsche, die aufgrund ihrer vermeintlich problematischen Sozialisation unfähig seien, in der neuen Gesellschaft zu funktionieren (vgl. Krause 2008). Pfeiffer hat indessen nie die in diesem Falle letztlich doch Unschuldigen öffentlich um Entschuldigung gebeten oder auch nur eine seiner Thesen zurückgenommen.
2.1.2.7. "Zielführende" Initiativen
Pfeiffer möchte indessen nicht nur kritisieren, sondern Kinder wahlweise davon abhalten, Computerspiele zu spielen, indem halt die Schulzeiten ausgedehnt werden, bzw. ihnen dort die Möglichkeit geben, Sport zu treiben, Musikinstrumente zu erlernen oder Theaterstücke einzustudieren. Ob eben nun Ganztagsbeschulungen der Weisheit letzter Schluß sind, ist aber zumindest fraglich (siehe XX). In diesem Zusammenhang am lustigsten war allerdings, daß, als Schulkinder, die Shakespeares "Hamlet" einstudiert hatten, danach befragt wurden, was denn am Theaterspielen am besten sei, dann antworten: "Das Töten" (vgl. den Fernsehbericht "Gewalt spielen - Jugendliche und ihre Computerspiele", rbb, 30.06.2007)...
2.1.2.8 Allgemeinplätze, Historie
Die Medienkritik, die sich aktuell gegen Computerspiele wendet, ist ganz und gar nicht neu, sondern greift auf Argumente und Argumentationsmuster zurück, die bereits seit Jahrhunderten und gegenüber vielen Medien erprobt sind. Eine beliebte Technik besteht darin, sehr allgemeine Aussagen zu machen, die als solche auch kaum zu bestreiten sind, und diese aber dann auf das Medium zu beziehen, so als handelte es sich um eine neue Problematik, die es zuvor nicht gegeben hätte (vgl. Vitouich 2007, S.104f.). Christian Pfeiffer gebrauchte diese Technik zum Beispiel bei seiner Aussage, er und seine Mitarbeiter „könn[t]en klar belegen, dass die Leistungskrise der Jungen in einem beachtlichen Ausmaß damit zusammenhäng[e], dass sie zu viel Zeit verdaddeln und zu wenig Zeit aufs Mathe- und Vokabelnlernen verwenden“ (vgl. „Die Spiele beeinflussen die Psyche“, abgerufen am 17.07.2009)..
Nun ist es allerdings eine logische Erkenntnis, daß wer mehr Zeit auf nichtschulische Aktivitäten verwendet, auch weniger Zeit für schulische Aktivitäten zur Verfügung hat. Allerdings ist es bedenklich, daß hier versucht wird, diese Allgemeinaussage auf die Ebene einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu heben. Zum anderen gibt es auch Studien, nach denen die einfache Arithmetik, die Pfeiffer hier aufstellt, nicht ganz zutreffend ist. Nach N.N. üben statistisch gesehen Personen, die mehr Medien konsumieren, auch mehr andere Aktivitäten wie Sport aus und verwenden sogar etwas mehr Zeit auf schulische Aktivitäten (vgl. ).
Nicht zuletzt ist diese Kritik damit auch auf alle anderen „nichtschulischen“ Aktivitäten anwendbar. So tauchte bereits in einem mittelalterlichen Text die Klage auf, wer Schach spiele, werde gewalttätig, spielsüchtig, verschwende aber zumindest seine Zeit, war dies nicht einmal die erste, aber offensichtlich auch nicht die letzte Medien- und Spielekritik, die ganz gleich war. Pfeiffer bleibt natürlich nicht bei der einfachen Arithmetik, die wie gesagt ja auf alle anderen Aktivitäten genauso anwendbar ist.
Um daher die „Neuaritigkeit“ oder „Besonderheit“ der Kritik gegen Computerspiele herauszustellen, wird nun weiter auf einer Schiene argumentiert, daß Lerninhalte, um vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis überzugehen, mindestens 12 bis 24 Stunden bräuchten. Streß, der in der Zwischenzeit auftrete, behindere diesen Übergang. In besonderer Weise werde dieser Streß durch Computerspiele ausgelöst – und zwar je mehr, je höher die Altersfreigabe sei. Sinnigerweise berufen sich die Autoren des KFN bei dieser These auf Versuche mit Nachrichtenbildern und gewalthaltigen Filmen, in deren Kontext Werbung oder andere Informationen schlechter erinnert werden könnten (vgl. etwa Bushman 2005, S.705). Und sie halten selbst fest, daß die Ergebnisse solcher Versuche nicht unbedingt auf schulische Lerninhalte übertragbar sind, weil diese in anderer Form präsentiert würden (vgl. Rehbein et al. 2006, S.40f.). In Pfeiffers Äußerungen und der journalistischen Darstellung kommt diese Qualifikation allerdings nicht vor, sondern die These wird einfach als zweifelsfrei belegt dargestellt. Nun trifft das Gehirn bei der Abspeicherung immer eine Auswahl, welche Informationen relevant sind, und werden zum Beispiel Angstreize schneller und stärker als neutrale Reize wahrgenommen, so daß diese möglicherweise bevorzugt werden (vgl. Brand+Markowitsch 2004, S.3). Allerdings wird das doch sehr einfache Modell des Gedächtnisses, das Pfeiffer und seine Miatarbeiter aufstellen, in der Praxis als falsch angesehen (vgl. Nieding+Ohler 2006, S.50).
Letztlich macht Pfeiffer damit klar, daß es auch gar nicht so sehr – oder zumindest nicht ausschließlich – um irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse ging, sondern Computerspiele auch bereits „intuitiv“ abgelehnt werden. Nun mag man diese Haltung und Meinung ja haben. Man sollte sie dann allerdings auch kommunizieren und nicht versuchen, den Eindruck zu erwecken, sie sei Resultat „wissenschaftlicher Erkentnnisse“, oder am Ende gar versuchen, „Erkenntnisse“ seriell zu produzieren, die diese Haltung stützen, und beständig seine vermeintliche Expertise vorzuschützen.
2.1.3 Regine Pfeiffer
1. Zu Regine Pfeiffer stehen im Vergleich nur wenige Informationen zur Verfügung. Sie beteiligt sich i.a. nicht an Publikationen des KFN, tritt wohl aber öffentlich in ihrer selbstgewählten Rolle öffentlich auf. Diese Darstellung erfolgt auf Grundlage eines Interviews mit dem Online-Magazin „Cynamite“ (vgl. Cynamite: "Im Gespräch mit Spielekritikerin Regine Pfeiffer", abgerufen am 24.04.2009).
So meint sie einerseits, daß Menschen, die sich mit Computerspielen beschäftigen, nicht „(f)est im Leben“ stünden. Mit anderen Worten seien erwachsene Computerspieler entweder infantil und nicht altersadäquat entwickelt, oder sie existieren ihrer Meinung nach schlicht nicht. Dies entspricht zum einen nicht der Realität. Zum anderen widerspricht diese Behauptung auch Pfeiffers Forderung nach einer Abschaffung der Alterseinstufung. Denn wenn dann tatsächlich die Hersteller nur noch Computerspiele produzieren würden, die „für alle Konsumenten geeignet“ sind, wären Computerspiele erst recht nur für „infantile Menschen“ und Kinder interessant.
2. Pfeiffer sieht Alterseinstufungen von Computerspielen nicht als den richtigen Weg. Vielmehr hätten sich durch unterschiedliche Alterseinstufungen die Spielehersteller nur eine Möglichkeit geschaffen, Inhalte zu produzieren, die nicht für alle Konsumenten geeignet seien. Dieses "Argument" geht auf den Medienkritiker Craig Anderson zurück. Dieses Argument scheint nun auch wieder von der Einschätzung getragen, daß Computerspiele primär auf Kinder und Jugendliche gerichtet und für erwachsen handelnde Menschen nicht interessant zu sein hätten. Ansonsten führt es aber auch den "Jugendschutz" ad absurdum (s.o.). Weiterhin gab es bereits in der Anfangszeit der Computerspiele eben auch Inhalte, die als ungeeignet angesehen wurden (vgl. Gagne 2001; Wikipedia: River Raid, abgerufen am 27.06.2009). Und nicht zuletzt sollte man auch berücksichtigen, daß es für Bücher keine Altersbeschränkungen in dem Sinne gibt. Trotzdem käme man aber nicht auf die Idee zu denken, daß bestimmte Inhalte für Leser aller Altersgruppen geeignet seien.
Umgekehrt würde dies auch eine Ungleichbehandlung von Computerspielen gegenüber allen anderen Medien bedeuten. Selbst zwischen Regine Pfeiffer und ihrem Bruder besteht da eine Inkonsistenz. So hatte Christian Pfeiffer bemerkt, daß es sehr wohl Erwachsenen freistehe, sich „ab 18“ freigegebene Filme anzusehen, erkannte er also für Filme an, daß es Inhalte gibt, die eben nicht „für alle Konsumenten geeignet“ sind (vgl. Pfeiffer 2004, S.7). Während gleichzeitig Regine Pfeiffer für Computerspiele forderte, hier dürfe es keine Unterschiede für verschiedene Altersgruppen geben. Warum sie der Meinung ist, daß diese Ungleichbehandlung sein solle, erklärt sie freilich nicht.
3. An einer anderen Stelle im Interview beklagte Pfieffer, daß Spiele wie „Anno 1602“, die vorgeben, den Spieler in ein Szenario zu versetzen, das in der frühen Neuzeit spielt, daß darin eine Welt dargestellt werde, in der es keine religiösen Eiferer, keine Armut oder Hungersnöte gebe, und daß Menschen womöglich dazu hingerissen sein könnten, die dargestellte Welt als „authentisch“ zu empfinden.
Wenn man auch hier noch einmal die Anforderungen betrachtet, die die Medienkritikerin an Computerspiele stellt, sieht man auch hier, daß dieser Anspruch unmöglich zu erfüllen wäre: Denn einerseits wird auch hier wieder „Authentizität“ gefordert, gleichzeitig würden aber solche Darstellungen wieder verurteilt, denn: Hexenverbrennungen sind einfach zu grausam.
Letztlich bleibt also die Frage: Sollen sich Computerspiele – oder Medien überhaupt – nun überhaupt nicht mehr mit Themen befassen dürfen, bei denen es gleichermaßen „von Übel“ ist, etwas darzustellen wie es wegzulassen? Versuchen Medienkritiker nicht damit, uns die Welt zu erklären und ein Welt- und Geschichtsbild zu vermitteln, in dem es so etwas wie eine „Kontroverse“ nicht gibt?
4. Pfeiffer war dann ja auch der Meinung, daß „(f)est im Leben stehende“ Personen mit Gewaltdarstellungen in Computerspielen umgehen könnten, diese aber nicht die Mehrheit der Spieler stellten. Man sollte vielleicht einmal fragen, was sie damit meint: Ganz häufig findet sich ja die Position, daß Computerspiele nicht für Erwachsene seien (auf die Spitze getrieben in einer Zeitungsmeldung, in der von Forderungen nach einem „Verbot von 'Killerspielen' für Jugendliche“ geschrieben wurde), daß also die Mehrheit der Spieler Kinder und Jugendliche seien. Wer als Erwachsener noch spiele, sei also infantil/nicht altersgemäß entwickelt.
Beziehungsweise, und tatsächlich waren im Jahr 2006 75% aller Computerspieler erwachsen und „standen“, wie es so heißt, „im Leben“ (vgl. Maas+Neuninger 2006, S.36). Letztlich zeigt das also, daß sie Erwachsene, die sich mit Computerspielen beschäftigen, nicht für voll nimmt. Dies übrigens im Anschluß an zum Beispiel Weiß, der die Konsumenten in verschiedene Gruppen einteilte, die entweder nicht moralisch gefestigt und damit anfällig für die vielfältig beschiedenen negativen Auswirkungen der Medien seien. Wer andererseits „moralisch gefestigt“ sei, erlebe zwar keine negativen Auswirkungen, würde aber auf „so etwas“ nur mit Ablehnung reagieren, also nicht spielen. So hat man letztlich eine Welt konstruiert, in der nur die Medienkritiker als ernstzunehmende Diskussionspartner dargestellt werden. Andererseits hat man damit aber auch die vermeintliche Begründung präsentiert, warum es im Rahmen des „Jugendschutzes“ in vielen Fällen auch gerechtfertigt sei, Erwachsene vor derartigen Inhalten zu „schützen“.
2.1.4 Die bayerische Bundesratsinitiative - Die Junktim-Taktik
Das Bundesland Bayern brachte Anfang 2007 eine Initiative in den Bundesrat ein, die auf der Basis "wissenschaftlicher Erkenntnisse" eine Kausalität des Spielens von den Autoren des Gesetzesantrags so getaufter "Killerspiele" für Amoktaten unterstellte, indem diese "die Akzeptanz von Gewalt legitimierenden Verhaltensmustern" (o.V. 2007a, S.12) förderten und die Spieler (mittels Karteneditor) Umgebungen für diese Spiele erstellen könnten, mit denen sie etwaige Amoktaten simulieren könnten (vgl. o.V. 2007a, S.14), und entsprechend ein Verbot derartiger Spiele forderte. Dieser Vorstoß wurde bereits quer durch alle politischen Parteien heftig kritisiert (vgl. (Titel); abgerufen am 12.08.2007).
Bereits der Begriff „Killerspiele“ ist erstens von den Medienkritikern geprägt worden, um einen möglichst griffigen, prägnanten und bereits bevor irgendwelche Belege für die ungeheuerlichen Behauptungen präsentiert werden, emotionale Ablehnung produzierenden Terminus zur Hand zu haben. Dabei ist es nicht mehr so, daß noch „nur“ diese Spiele kritisiert wurden, indem sie etwa in die Möglichkeit gesetzt würden, „Killer“ zu spielen. Sondern es wird schließlich damit auch der Spieler angegriffen, wer in seiner Freizeit Ritter, Soldat oder Krieger spiele, letztlich ein eben solcher „Killer“ sei (dazu passen auch Statements von Bayerns neuem Innenminister Joachim Herrmann im Jahr 2009, der Computerspieler auf eine Stufe mit Menschen stellte, die einen Lustgewinn aus Mißbrauchshandlungen an Kindern ziehen; vgl. "Bayerns Innenminister vergleicht Spiele mit Kinderpornos", abgerufen am 01.05.2009). Hier wird die Betrachtung durch wissenschaftliche Studien also bereits im Vorfeld durch moralische Abscheu ersetzt, und man demonstriert, daß man an einer objektiven oder fundierten Betrachtung nicht interessiert war. Er ist zweitens aber so offen, daß bereits „ab 12 Jahren“ freigegebene Spiele wie „World of Warcraft“ (vgl. "WoW ein 'Killerspiel'", abgerufen am 01.05.2009) oder das Strategiespiel „Warcraft III“ (vgl. "Rech fordert weitere Turnierverbote", abgerufen am 03.05.2009) nach eigenem Belieben in diese Kategorie hineingefaßt werden konnte.
Damit verbunden wurde auch ein Verbot "reale[r] Gewaltspiele" wie "Paintball", die vermeintlich "Mitspieler in ihrer Menschenwürde" herabsetzten, und aller "offensichtlich schwer jugendgefährdende[n] Trägermedien" gefordert (o.V. 2007a, S.if.). Unter die Kategorie der Gewaltspiele sollen dabei alle Spiele fallen, in denen die Begehung von Verbrechen nicht bestraft wird (vgl. o.V. 2007a, S.7).
Dieser Gesetzesvorschlag ist eine vom stets konservativen Bayern schon bekannte Extremadresse. Seine Umsetzung hätte zum Beispiel zur Folge, daß Jugendliche unter 16 ohne elterliche Begleitung keinen Videospielautomaten mehr bedienen dürften (vgl. o.V. 2007a, S.3), selbst wenn es sich dabei um ein gewaltfreies Spiel handelt.
Daneben wäre damit auch ein Verbot (insbesondere des gewerblichen Verleihs) von Pornographie zur Folge (vgl. Wikipedia: Killerspiel, abgerufen am 11.06.2007). Es dürften auch Volljährige derartige Medien ("Porno-, Horror- und Gewaltdarstellungen" (o.V. 2007a, S.19) nicht mehr kaufen oder ausleihen, da die Möglichkeit bestehe, Kinder und Jugendliche könnten durch Weitergabe selbst an diese gelangen (vgl. o.V. 2007a, S.19). Als Argument hierfür wurde gebracht, daß es für Eltern keinen legitimierenden Grund geben könne, ihren Kindern solche Spiele zu präsentieren (vgl. o.V. 2007a, S.).
Die bayerische Landesregierung hatte bereits ein Verbot von Spielen wie „Paintball“ oder „Laserdrome“ gefordert, bevor in Deutschland überhaupt irgendein Amoklauf eines Jugendlichen stattgefunden hatte, und diese Forderung war bisher in vierfacher Auflage nicht durchgekommen. Im Rahmen einer geplanten „Verschärfung des Waffenrechts“, die von ihren Kritikern als vorgeschobenen Aktionismus bzw. allein auf die Lobby der Schützen und Jäger gemünzt sah, die man nicht mit Verboten von Großkaliberwaffen verprellen wollte (), konnte sie schließlich diese Forderung mit einbringen (vgl. ). Neben der Begründung mit der Menschenwürde wurde hier die Befürchtung angeführt, das Spielen von „Paintball“ oder „Laserdrome“ könne Hemmschwellen zur Gewaltausübung senken (). Spieler und ihre Vertretung zeigten sich darüber entsetzt, zumal dies nicht recht plausibel erschien (s.u.) bzw. auch der Verweis auf Amokläufe nicht funktionierte. Tatsächlich hatte keiner der jugendlichen Amokläufer „Paintball“ oder ähnliche Spiele gespielt ().
1. Allerdings ist diese Logik auch nicht recht plausibel. So könnte man ebenso etwa ein Totalverbot von Alkoholika fordern, da Erwachsene wohl kaum ihr Bier ständig in einem verschlossenen Schrank aufbewahren und die Anzahl der Dosen täglich kontrollieren werden, um zu verhindern, daß ihre Kinder an Bier gelangen können.
2. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zum Thema sind zum Teil gar nicht schlüssig (siehe II.2). Qualifikationen wie "offensichtlich", die im Rahmen der Argumentation verwendet werden, machen vielmehr klar, daß hier im Grunde aufgrund von intuitiven Überzeugungen argumentiert wird (vgl. Lüke 2005).
3. "Gesellschaftliche Akzeptanz"
Um das Vorhaben vermeintlich plausibel zu machen, wird im Text zwischen vermeintlich "gesellschaftlich akzeptierten" und damit "guten" und "der Ertüchtigung dienenden" mit Gewalt und Kampf assoziierten Sportarten und vermeintlich "gesellschaftlich nicht akzeptierten" und daher "gewaltverherrlichenden" und "entwürdigenden" Sportarten unterschieden. In die erste Kategorie werden "Sportarten" wie Boxen oder Schießen gezählt, in die zweite Kategorie zum Beispiel Paintball oder Laserdrome.
Allerdings ist diese Differenzierung fehlerhaft.
a)
"Guns don't kill people. Teenagers playing
computer games do."
(Aufdruck auf einem T-Shirt)
Schießen und Jagen haben im Unterschied zu körperlichen Sportarten wie Boxen, Fechten oder "Paintball" keinen ausgeprägten Ertüchtigungscharakter. Andererseits müßte man auch fragen, warum die von Beckstein propagierte "Ächtung von Gewalt" sich nicht auch auf das Jagen und Schießen erstrecken müßte. Immerhin sind soll es in Deutschland 10 Millionen legale Schußwaffen geben (Wikipedia: Waffenregister, abgerufen am 26.06.2008; die Anzahl der illegalen Waffen soll doppelt so hoch liegen, ist aber für die Argumentation nicht einmal erheblich), die ja irgendeinen Zweck haben müssen. Eine Schußwaffe besitzt keinen anderen Zweck als jemanden zu verletzen oder zu töten. Nun werden in Deutschland fast alle Straftaten, in denen Schußwaffen eine Rolle spielen, mit illegalen Exemplaren begangen (). Jedoch hatten alle jugendlichen Amokläfer die Möglichkeit, sich legale Schußwaffen zu beschaffen. Das ändert nun nichts daran, daß die meisten Menschen, die eine Schußwaffe besitzen, damit nie auf einen Menschen schießen werden. Dies hält freilich die "Ächter" auch nicht davon ab, wie wir ja an den Computerspielen gesehen haben. Daß nun aber nicht Schußwaffen in Becksteins Plan von der "Ächtung der Gewalt" hineinfallen, dürfte entsprechend eher dem Umstand zu verdanken sein, daß die Besitzer von Schußwaffen sich durch starke Lobbies vertreten sehen: Zum Beispiel die Jäger können erheblichen Druck auf die Politik ausüben. Und schließlich möchte man sich auch das eigene Hobby nicht verderben lassen. Auf diese Weise machen sich die "Ächter" letztlich selbst unglaubwürdig. Auch ist zu fragen, ob nicht sogar Shakespeares Theaterstücke, in denen zum Teil doch ausgiebig gemordet wird (s.o.), ebenfalls verboten werden müßten.
b) Auch ist die Jagd nicht weitgehend "gesellschaftlich akzeptiert". So forderten etwa in einer im Jahr 2002 durchgeführten repräsentativen Umfrage 68% der Befragten ein Verbot der Jagd als Freizeitsport, weitere 12% ein generelles Verbot (vgl. "Jagd: Das sagen Kleingeister und große Geister", abgerufen am 25.05.2008). Sieht man sich diese Zahlen an, könnte man meinen, daß auch die Schützen und Jäger unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck stehen und nach anderen vermeintlich plausiblen Schuldigen suchen. Damit kommen einem natürlich Zweifel daran, ob es sich bei einer Gesetzesinitiative, die passionierte Jäger einbringen, nicht um Lobbyarbeit handelt, die auch von der Unbeliebtheit des eigenen "Freizeitvergnügens" ablenken soll.
c) Daneben handelt es sich beim Jagen auch deshalb nicht um eine "harmlose" Sportart oder "Ertüchtigung", da zum einen dabei Tiere getötet und damit dies ist die einzige "Sportart" ist, bei der die Tötungshemmung in der Realität überwunden wird. Auch gibt es durchaus Berichte darüber, welche ökologischen Flurschäden die Jagd anrichtet (vgl. "Jagd: Das sagen Kleingeister und große Geister", abgerufen am 25.05.2008). In der Vergangenheit gingen Jäger auch durchaus gegen Menschen vor: In den sog. "Befreiungskriegen" kämpften Jäger und Forstleute mit ihren Jagdwaffen und im Wald und im Gebirge erlernten militärischen Taktiken gegen die Franzosen bzw. waren noch bis zum ersten Weltkrieg wichtiger Teil des militärischen Aufgebotes (vgl. Wikipedia: Jäger(Militär); Wikipedia: Tiroler Schützen; Standschützen, abgerufen am 03.01.2008).
Im Gegensatz dazu kann durch Computerspiele im Gegenteil zu immer wieder von verschiedener Seite wiederholten Behauptungen (vgl. Grossman 2001, S.; Hopf 2002, S.254; "Killerspiele: Psychotherapeuten fordern Verbot", abgerufen am 30.11.2007) die Tötungshemmung nicht abtrainiert werden (vgl. "Gottseidank ein Sündenbock", abgerufen am 07.11.2007).
Nun gibt es tatsächlich den Begriff des "mentalen Trainings". Bezieht es sich auf körperliche Aktivitäten, ist damit ein Bewegungslernen durch Vorstellung gemeint, d.h. eine Person stellt sich einen Bewegungsablauf vor, ohne diesen tatsächlich auszuführen. Das "mentale Training" dient der Verbesserung kognitiver Fähigkeiten, die notwendig sind, um effektiv handeln zu können, und wird zu diesem Zweck von Sportlern und Musikern gepflegt. Allerdings kann ein "mentales Training" ein reales Training nicht ersetzen (vgl. Scheler 2004, S.21-23). Der anfallende zusätzliche "Übungseffekt" ist dabei auch nur auf Teilbereiche beschränkt. So führt das Computerspielen nur dann zu einer Verbesserung der Zielgenauigkeit eines trainierenden Schützen, wenn parallel dazu auf dem Schießplatz mit der realen Waffe geübt wird (vgl. Gieselmann 2000; Bösche und Geserich 2007, S.51f.). Zum anderen ist Schießen eine dreidimensionale Aktivität, bei der auch die Handhabung der Waffe eingeübt werden muß, und damit für Menschen wie Robert Steinhäuser viel nützlicher und damit "gewaltnäher" als ein gewalthaltiges Computerspiel (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.). Im allgemeinen hat eine Kombination eines körperlichen/realweltlichen mit einem mentalen Training sogar eine schwächere Wirkung als ein rein körperliches Training (vgl. Feltz und Landers 1983, nach Scheler 2004, S.22f.). Das würde auf den speziellen Fall übertragen bedeuten, daß eine Person, die allein auf dem Schießplatz mit ihrer Waffe übt, dadurch ihre Fähigkeiten stärker verbessern würde als eine Person, die sowohl auf einen Schießplatz geht als auch mit einem Computerspiel Schießen übt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, daß die Bewegungsabläufe mit der realen Waffe und der Maus, die Sicht aus der Schußposition bei der realen Waffe und die optische Darstellung im Computerspiel, und auch die physikalischen Eigenschaften der realen und der simulierten Waffe nicht in Einklang zu bringen sind (vgl. Bösche und Geserich 2007).
Nun stehen Sportarten wie „Paintball“ oder „Laserdrome“ in etwa dazwischen. Bevor man allerdings Paintball als „Gewaltsportart“ anprangert, sollte man versuchen, auch die Unterschiede zwischen Schießtraining, militärischen Drills et cetera aufzuzeigen. So müßte man etwa fragen, in wieweit überhaupt eine Tötungshemmung abgebaut werden könnte, wenn gar keine Situation vorliegt, in der getötet wird (vgl. Müller ). Tatsächlich sind die schlimmsten Verletzungen, die beim „Paintball“-Spielen auftreten können, blaue Flecken. Zum anderen verhalten sich „Paintball-Markierer“ nicht wie reale Schußwaffen, etwa eine Pistole oder ein Gewehr. Die Leistung eines „Paintball-Markierers“ ist deutlich geringer . So gibt bei der Benutzung keinen Rückstoß und auch die Physik einer kleinen Kugel aus Gelatine unterscheidet sich von der einer Pistolen- oder Gewehrkugel (). Dies ist bei Markierern, wie sie beim „Laserdrome“ eingesetzt werden, noch stärker der Fall, da man ja damit nur auf Personen zeigen wird, ähnlich wie bei einem Laserpointer. Tatsächlich wurde aber von Seiten der bayerischen Landesregierung nicht gefordert, das Schießen mit einer Wasserpistole oder die Benutzung eines Laserpointers zu verbieten, obwohl es sich dabei um ein vermeintlich ebenso aggressives Bild handeln müßte. Schließlich läßt sich auch feststellen, daß Spieler es nicht darauf anlegen, militärische Taktiken zu gebrauchen, sondern vielmehr Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die in einer realen Kampfsituation sehr schnell zum Tod führen würden. (). Zuletzt handelt es sich um eine Mannschaftssportart, in der Personen, die sich wie Amokläufer, also zum Beispiel einzelgängerisch, verhalten, keinen Stand hätten.
Dies ist beim „Schießsport“ scheinbar anders, hatten etwa alle jugendlichen Amokläufer, bevor sie ihre Taten begingen, in Schützenvereinen trainiert (). Die „Wertevermittlung im Schützenverein“, die z.B. Uwe Schünemann als positives Argument angeführt hatte (), hatte dort also nicht funktioniert.
Beispielsweise stellt auch der Sportphilosoph Arturo Hotz es in Abrede, daß der Sport überhaupt Werte vermittle. Demnach sei es immer noch vom Einzelnen und seinen Vorstellungen abhängig, welchen Sinn und welchen Gewinn er durch seine sportliche Tätigkeit erfahre (vgl. „Stirb und werde – Der Sport in der Sackgasse“: „Das Sportgespräch“, DLF, 09.08.2009).
d) Schließlich wird auch die "gesellschaftliche Akzeptanz" von den Bayern falsch ausgedeutet, nämlich bestenfalls noch in Bezug auf eine konservative Wählerklientel, die nicht verstehen kann, warum Menschen gegen "Kulturtraditionen" wie Jagden sein können, während andererseits versucht wird, Computerspieler zu marginalisieren. In Deutschland sind etwa 1.6 Millionen Menschen Mitglieder in Schützenvereinen oder Jagdclubs. Hingegen betreiben aber nicht nur ein paar Jugendliche "E-Sport", sondern mehrere Millionen Menschen, die durchaus auch im Erwachsenenalter stehen. Wenn auch nur etwa eine Million Computerspieler in Vereinen wie dem Deutschen eSport-Bund organisiert sind (vgl. Gemeinsame Presseerklärung der E-Sport-Vereine in Deutschland (21.11.2006), abgerufen am 16.11.2007).
e) Es erscheint nun zynisch, "Ertüchtigungen", in denen reales Töten eingeübt und moralisch gerechtfertigt wird (etwa damit, daß das "Ausdünnen von Beständen" dem Naturschutz diene), oder Vorbereitungen zum effektiven Funktionieren in realen Kriegen - denn eine Waffe hat keinen anderen Zweck als damit jemanden zu verletzen oder zu töten, selbst wenn man es höflich mit "Hilflose beschützen" oder entmenschlichend mit "Weichziele fixieren" umschreibt - auf die gleiche Stufe mit virtuellen Tätigkeiten zu stellen. Entsprechend bleibt fraglich, in wieweit Menschen, die so offenbar nichts Schlimmes dabei empfinden, lebende Tiere zu töten oder Kriegseinsätze befürworten, geeignet sind und die die Tragweite ihrer Äußerungen anscheinend schon lange nicht mehr ermessen können, Computerspieler über moralische Kategorien aufzuklären. So forderte Uwe Schünemann bei verschiedener Gelegenheit, die Verkäufer solcher bösen Spiele bis zu zwei Jahre, die Spieler immer noch für bis zu ein Jahr ins Gefängnis zu sperren (vgl. "Niedersachsen will bis zu zwei Jahre Haft für 'Killerspiel'-Verkäufer", abgerufen am 21.08.2009), während Günther Beckstein nicht einmal wahrzunehmen schien, daß er mit einer Aussage, mit der er die Abschiebung straffällig gewordener "ausländischer" Jugendlicher rechtfertigen wollte, zugab, daß deren Lebensumfeld in Deutschland sie kriminell machen kann (). Eine Parteifreundin Uwe Schünemanns forderte andererseits die Einführung eines Schulfaches "Schießen", damit möglichst viele Jugendliche Freude an dieser friedfertigen Ertüchtigung finden könnten ().
Zusammenfassend, scheint es, wenn passionierte Jäger damit kokettieren, besonders hart gegen Computerspiele(r) vorgehen zu wollen, doch als eine Art der Vorwärtsverteidigung, mit der versucht werden sollte, eine Gruppe als Schuldigen "festzumachen", noch bevor überhaupt Stimmen aufkommen konnten, die seine eigene Gruppe als "verantwortlich" brandmarken könnten. Tatsächlich wird man auch nicht durch Jagen oder Schießen zum Soziopathen. Allerdings ist es perfide, dies bei anderen Aktivitäten zu suggerieren.
4. Sinnigerweise wird im Rahmen der bayerischen Bundesratsinitiative gefordert, alle Medien nach den gleichen Kriterien zu behandeln (vgl. o.V. 2007a, S.20). Dies ist selbstverständlich nachvollziehbar und auch wünschenswert. Andererseits wird Computerspielen im Gegensatz zu diesem Gleichbehandlungspostulat eine im Vergleich zu anderen Medien wie Büchern oder Filmen besondere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen unterstellt, daß der Spieler darin eine aktive und nicht mehr rezipierende Rolle einnehme (vgl. ebd., S.12), paradoxerweise also gerade eine Ungleichbehandlung betrieben.
Diese geschieht ebenfalls mehr auf intuitiver denn auf wissenschaftlicher Grundlage. Zwar wird von verschiedener Seite argumentiert, daß Computerspiele eine im Vergleich zu anderen Medien besonders große Wirkung haben müßten, (vgl. ). Allerdings liefern Studien eher gegenteilige Belege. Im Rahmen der experimentellen Studie von Kimm (2005) fanden sich keine Anhaltspunkte für Unterschiede zwischen Fernsehen und Computerspielen (vgl. ), und nach der Metaanalyse von Sherry (2001) ist der Effekt von Computerspielen sogar deutlich geringer ausgeprägt als etwa der des Fernsehens (vgl. ).
Zum anderen werden Computerspiele bereits deutlich stärker reglementiert als andere Medien. So enthalten Filme häufig erheblich drastischere Darstellungen als Computerspiele, die für die gleiche Altersgruppe freigegeben sind. Persönlich haben mich, der ich schon länger über 18 Jahre alt bin, Szenen in den ab 12 Jahren freigegebenen Filmen "Der neunte Tag", in dem ein KZ-Aufseher einem Häftling mit einem eisernen Haken den Kopf blutig schlägt, oder in "Der Pianist", in dem eine Hinrichtung von jüdischen Zwangsarbeitern durch Genickschüsse dargestellt wird, ausgesprochen schockiert. Eine derartige Darstellung in einem für diese Altersklasse freigegebenen Computerspiel würde von den Computerspielern selbst als unakzeptabel empfunden (vgl. BBFC 2007, S.75f.). Tatsächlich werden also Computerspiele eigentlich bereits strenger behandelt als andere Medien.
5. Eine Junktim-Taktik dient dazu, in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber Vorhaben zu realisieren, die unterhalb dessen Wahrnehmungsschwelle liegen bzw. durch andere Themen überlagert werden, ihrerseits aber eine ebenso große oder noch größere Tragweite haben können. Das "Junktim" des ebenfalls geforderten Verbots von Pornographie läßt sich auch aus dem Interesse heraus motivieren, konservative Moral und Gesellschaftsvorstellungen für ganz Deutschland verbindlich zu machen. In der bayerischen Verfassung wird zum Beispiel die "Ehrfurcht vor Gott" als höchstes Erziehungsziel angesehen.
Da andererseits Paintball und ähnliche Betätigungen selbst zum Junktim wurden, das nicht einmal mehr durch vermeintliche Zahlen und Statistiken gerechtfertigt wurde – es sei denn dadurch, daß es bedeutend weniger Paintball-Spieler als Mitglieder von Schützen- oder Jagdvereinen gibt -, wird diese Vorstellung nur mehr genährt, daß es nämlich um einen Plan handelte, den man – Empirie hin oder her - aus bestimmten Gründen einfach durchsetzen wollte. Tatsache war, daß man erst auf öffentlichen Druck zugab, daß man überhaupt nicht wisse, ob und „wie gefährlich das Spiel wirklich ist“, und den Plan zum Verbot von „Paintball“ auch im vierten Anlauf wieder zurückzog (vgl. "Waffenrecht: Koalition zieht Paintball-Verbotsplan zurück", abgerufen am 22.05.2009).
Dieses "Junktim" mochte sogar der eigentliche Zweck sein, da es technisch gesehen so etwas wie eine "Strafbarkeitslücke" bei der Zugänglichmachung von "gewaltverherrlichenden" Medien nicht gibt. Es besteht nur ein definitionsmäßiger Unterschied zwischen diesen und Medien, die bloß gewalthaltig sind. Daß beide Kategorien nicht identisch sind, zeigt zum Beispiel ein Blick auf Antikriegsfilme, die sehr häufig - man bedenke etwa die Vietnamfilme "Platoon" von Oliver Stone oder "Full Metal Jacket" von Stanley Kubrick - erheblich mehr und drastischere Gewaltdarstellungen enthalten als Prokriegsfilme wie in diesem Kontext etwa John Waynes "Die grünen Teufel". Niemand würde nun einen Antikriegsfilm als "gewaltverherrlichend" einstufen, weil es gerade seine Intention ist, Gewalt zu kritisieren.
2.1.5 Die Schützenverein-Lobbyisten - Brutalisierung durch Medienkritiker?
"Steht nicht einfach so rum. Verbietet
irgendwas!"
(www.schandmaennchen.de)
"Wir lehnen eine 'getanzte Weltanschauung'
ab. Was uns nach diesen Jahren noch nicht geglückt ist und
uns daher als Aufgabe bevorsteht ist eben: Die Revolution des
Privatlebens."
(http://www.return2style.de/swheinis.htm;
abgerufen am 04.11.2007)
"Erst die Schußwaffe hat die Menschen
gleich gemacht. Jetzt kann sich auch der Schwächste gegen
Ungerechtigkeit und Unterdrückung wehren."
(Alvaro
Carrera)
1. Zur Klientel der Politiker, die am vehementesten für Verbote von gewalthaltigen Medien eintreten, gehören insbesondere Schützenvereine und Jäger. Solche Vereine sind natürlich genauso wie die Computerspieler bestrebt, den Verdacht von sich abzulenken, und ihre Lobbyisten setzten entsprechend alles daran, Schießen oder Jagen als Sportarten mit ausschließlich positiven Wirkungen und positivem sozialen Umfeld darzustellen. So forderte Günther Beckstein auch nach dem Amoklauf in Erfurt, nachdem bekannt wurde, daß Robert Steinhäuser Mitglied eines Schützenvereins gewesen war, nicht etwa eine strengere Reglementierung der Mitgliedschaft oder zumindest des Zugangs zu Waffen, sondern forderte im Gegenteil dafür, daß die Altersgrenze für einen Eintritt in solche Vereine auf zehn Jahre abgesenkt werden sollte (vgl. "Günther Beckstein gegen Rechtsstaat, Demokratie und die Liberalitas Bavariae", abgerufen am 19.05.2008). Zu einem Zeitpunkt, da wieder einmal über ein Verbot gewalthaltiger Computerspiele "diskutiert" wurde, machte Innenminister Wolfgang Schäble einen ähnlichen Vorschlag, die Altersgrenze für den Erwerb von Sportwaffen wieder von 21 auf 18 Jahre zu senken. Hier wurde der Einfluß der Waffenlobby offenbar, die nach eigenem Bekunden dieses Vorhaben intensiv betreibe (vgl. "Waffenrecht: Schäuble räumt Fehler ein", abgerufen am 26.06.2008). Die CDU-Politikerin Astrid Vockert, Schirmherrin des Nordwestdeutschen Schützenbundes, schlug schließlich vor, ein Schulfach "Schießen" einzuführen (vgl. "Schießen als Schulfach", abgerufen am 29.08.2007).
Auch andere Schützenvereine hatten angeboten, Schülern sogar an „Problemschulen“ im Rahmen des Sportunterrichts das Schießen beizubringen. Auch befinden sich die Schießbahnen von etlichen Schützenvereinen sogar auf dem Gelände von Schulen. Nun könnte man davon ausgehen, daß jemand, der weiß, wie man eine Waffe bedient – Sportschützen schießen längst nicht nur mit Luftgewehren, sondern eben auch mit „scharfen“ Waffen -, im Zweifelsfalle eher geneigt sein könnte, auch Eine einzusetzen. Es mag andererseits auch sein, daß zum Beispiel Herbert Scheithauer mit seiner Aussage sogar Recht hat, daß Amokläufe nicht allein deswegen zunehmen, weil Waffen in Reichweite sind. Dennoch konnte auch dieser „Experte“ sich nicht verkneifen, die Schuld letztlich darauf zu schieben, „dass in Kinderzimmern Krieg simuliert (werde) und der Waffengebrauch so einfach zu erlernen (sei)“ (vgl. "Waffen an Schulen - Verbot wird nichts ändern", abgerufen am 15.05.2009). Indem er diese beide Gedanken verknüpfte – schließlich -, versuchte er zu suggerieren, Computerspieler hätten eine Ahnung davon, wie reale Schußwaffen bedient würden, im Vergleich zu Nichtspielern. Er stellte aber damit letztlich dar, daß er keine Ahnung davon hat, wie ein Computerspiel überhaupt bedient wird, und daß man dadurch den Gebrauch von Waffen nicht erlernen kann
(i) Tatsächlich werden Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen in den Medien fast immer positiv als Zeichen gelungener sozialer Integration bzw. als „Freizeitvergnügen für die ganze Familie“ (vgl. (Lethmathe, 22.05.2009), abgerufen am 22.05.2009) dargestellt oder die „gute Jugendarbeit“ der Schützenbrüder (vgl. "Kritik an Schießstand an der Schule", abgerufen am 22.05.2009) oder die „pädagogische[n] Vorteile und [Förderung der] Konzentration und [der] kognitiven Fähigkeiten“ herausgestellt (vgl. "Aufregung über Sportschützen: Scharfe Schüsse an Schulen", abgerufen am 22.05.2009). Niemand hatte letztlich sonderliche Kritik daran, daß selbst Kinder sich am „Vogelschießen“ beteiligen, bei dem offenbar auf lebensnah bemalte Figuren geschossen wird, und dies wurde auch als „gut christlich“ angesehen (vgl. "Die Schützenfestsaison ist eröffnet", abgerufen am 15.05.2009).
Und Schützen schießen in der Realität dabei auch nicht weniger als Egoshooter-Spieler virtuell. Für den Schützenfest im Jahr 1979 wurde zum Beispiel festgehalten, daß nicht weniger als „550 Schuss Kleinkaliber-Munition und 290 Schuss mit Munition des Kalibers 16 […] erforderlich“ gewesen seien, bis der „Königsvogel“ „erlegt“ worden sei (vgl. „Notiert in Buer - Vor 30 Jahren“, in: „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ vom 21.05.2009). (Zum Vergleich einmal den Spießrutenlauf, der sich neuerdings ergibt, wenn junge Erwachsene auf einer LAN-Party „ab 12“ oder „ab 16“ freigegebene Computerspiele spielen wollen, die neuerdings als „Killerspiele“ gebrandmarkt werden, die zwingend verboten werden müßten – vgl. "Oberbürgermeister von Nürnberg begründet IFNG-Absage [damit] dass, man 'Killerspiele' nicht hoffähig machen wolle", abgerufen am 15.05.2009).
Mag es sein, daß die Luftdruckwaffen, die in einem bestimmten Verein benutzt werden, nicht dazu geeignet sind, , so daß selbst ein „Schützenbruder“ oder Einbrecher, der eine Waffe entwendet, damit keine nennenswerten Verletzungen verursachen würde (vgl. "Kritik an Schießstand in der Schule", abgerufen am 22.05.2009), und daß viele Sportschützen auch keine Waffen in die Hand nehmen würden, . Die Reflexpolitiker müßten eigentlich, nachdem wissenschaftliche Studien eine deutliche kausale Wirkung des Vorhandenseins von Waffen für die Gewalttätigkeit aufzeigen, Schützen- und Jagdvereine als Verursacher dieser Gewalttätigkeit darstellen. Denn das Vorgehen gegen Paintball oder Computerspiele zeigt eigentlich, daß es der Politik ja nicht um Fakten, sondern allein um den Anschein ging. Allerdings wird in Schützenvereinen und Schießclubs durchaus auch mit scharfen Waffen geübt und hatten eigentlich alle Amokläufer ihre Waffenerfahrung in Schützenvereinen gewonnen (vgl. Bott 2002). Tatsächlich aber gehen sie diesen Schritt gerade nicht, sondern fördern Schützenvereine weiterhin, selbst diejenigen, deren Anlagen sich auf dem Gelände von Schulen befinden (vgl. "Unterricht mit noch mehr Schuss", abgerufen am 22.05.2009). Tatsächlich ist in den USA nach Amokläufen mit vielen Opfern wie in Littleton oder an der Virginia Tech University der Verkauf von scharfen Waffen sogar angestiegen (vgl. ).
(i) Es gibt durchaus die Position, daß die leichte Verfügbarkeit von Waffen, verbunden mit einer Mentalität, daß sich dadurch Probleme regeln ließen, deren Einsatz gedanklich nahelegt (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.). In verschiedenen Studien wird insbesondere das Vorhandensein von Waffen als Ursache für den Anstieg der Gewalttätigkeit festgestellt (vgl. Olson 2004, S.). So würden die meisten Täter, die mit Schußwaffen morden, ihre Taten nicht begehen, wenn keine Schußwaffe verfügbar ist (vgl. Lemaine 2004, S.12). Eine Untersuchung von Waffenbesitz und Kriminalitätsraten in 14 Ländern fand eine deutliche Korrelation von 0.746 zwischen dem Anteil der Waffenbesitzer an der Gesamtbevölkerung und der Rate der Morde, die mit Schußwaffen begangen wurden (vgl. ebd., S.16). Was aber die Taten in Verbindung mit Schußwaffen angeht, die in Deutschland begangen wurden, handelte es sich dabei zu 95.5% um illegale oder erlaubnisfreie Waffen, nicht aber um die erlaubnispflichtigen Waffen, die in Schützenvereinen, Schießclubs oder Jagdvereinen verwendet werden (vgl. Becker 2001, S.5). Nun solche Vereine für die Brutalisierung verantwortlich zu machen, ist also ebenfalls zu einfach.
(ii) Durch Computerspiele allein kann man übrigens das Schießen nicht erlernen, sondern es braucht dafür immer die Einübung mit der realen Waffe (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.50). Robert Steinhäuser führte seinen Amoklauf insbesondere deshalb durch, weil ihm einerseits Schußwaffen verfügbar waren und er sich andererseits wegen seiner realen Schießausbildung zutraute, in der gewählten Situation auch mit der Schußwaffe umgehen zu können (vgl. ebd., S.61f.). Unterrichtet man entsprechend mehr Jugendliche im Schießen, so besteht die Gefahr, daß mehr Jugendliche sich in einer konkreten Situation den Umgang mit der Waffe zutrauen und so eher bereit sind, diese zur Durchsetzung eines konkreten Interesses einzusetzen.
2. Fehlwahrnehmung der fremden und der eigenen Rolle
Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann, seines Zeichens ein passionierter Jäger und Scharfmacher im Kampf gegen die Gewaltdarstellung in den Medien, hatte im übrigen auch keine Hemmungen, das neue computerisierte "Schießkino" eines Schützenvereins auszuprobieren (vgl. http://www.abendblatt.de, abgerufen am 30.11.2007). Dabei handelt es sich um eines der von Schünemann so gehaßten "perversen Killerspiele", das den Spieler noch dazu in die von "Counterstrike"-Spielern verachtete Position eines "Campers" (stationären Scharfschützen) setzt, der noch dazu - auch dies ist ja eines dieser unrichtigen Vorurteile gegen "Counterstrike", das in "Frontal 21" verbreitet wurde - auf Lebewesen schießt, die nicht das geringste Interesse daran haben, dem Spieler ans Leder zu wollen. Während er gleichzeitig andere derartige Computerspiele ganz heftig geißelte und gleichlautende Darstellungen von Computerspielern über den Ertüchtigungscharakter ihrer eigenen Aktivitäten nicht gelten ließ, sondern vielmehr sogar den Besitz von gewalthaltigen Computerspielen mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft sehen wollte (vgl. Wikipedia: Killerspiel, abgerufen am ). Da man davon ausgehen kann, daß Schünemann sich von der Benutzung des Schießkinos nicht enthalten würde, sollten Computerspiele verboten werden, müßte man hier also nach Schünemanns eigener Position davon ausgehen, es bei Schünemann mit einem gefährlichen Menschen und nicht nur politischen Amokläufer zu tun zu haben. Jedenfalls ist ihm und anderen Jägern, die sich gegen Computerspiele wenden, weil diese angeblich schlimmer sein als was sie so machen, aber eine gewisse Unehrlichkeit damit zunächst einmal zu unterstellen. Weiterhin würde Schünemann damit das Argument der Computerspieler bestätigen, daß sie selbst diese so verantwortungsvoll einsetzen, daß sie dadurch nicht zu Gewalttaten provoziert werden.
Man kann aber noch abstrusere Argumente konstruieren als in die "Diskussion" ohnehin schon eingebracht wurden: So versucht die US-Armee mit einem Schießkino namens "Virtual Army Experience", in dem die Version 3.0 ihres Werbecomputerspiels "America's Army" vorgeführt wird, Jugendliche von den Vorzügen des Militärischen zu überzeugen (vgl. "Virtual Army Experience", abgerufen am 07.08.2008). Da es sich dabei allerdings um eine von Uwe Schünemann abgesegnete "gute Ertüchtigung" handelt, wird er sich kaum dagegen verwehren wollen. Oder wird Schünemann diese Entwicklung damit kommentieren wollen, daß solche Schießkinos nur dann "gute Ertüchtigung" seien, wenn parallel auch eine Ausbildung in einer dreidimensionalen Umgebung stattfindet, damit sich dann wirklich die Fähigkeit und das Zutrauen von Jugendlichen zur Benutzung der Waffe verbessert (s.o.)?
a) Paßt Gewalt zu unserer Kultur?
Wie paßt dies nun zu der zum Beispiel von Edmund Stoiber geforderten "gesellschaftlichen Ächtung der Gewalt", die "nicht zu unserer Kultur passe"?
Tatsächlich zeigten Schünemann, Beckstein und Konsorten eigentlich mit der Klientel wie mit ihrem Handeln auf, daß Gewalt offenbar sehr wohl in unserer Kultur verankert ist. Ansonsten gäbe es nicht auch solche traditionsreichen Vereine. Jäger und Schützen, die gut getroffen und viele Tiere "zur Strecke gebracht" haben, werden von ihren Kameraden gefeiert. Sportler aus "kampfbetonten Sportarten", etwa Boxer oder Fußballer, werden heute noch als "Helden" gefeiert wie beispielsweise früher Gladiatoren. Nach einem Boxkampf wurde sogar davon gesprochen, die beiden Kontrahenten hätten die Zuschauer "elf Runden lang ganz toll unterhalten" (Wladimir Klitschko gegen Tony Thompson, RTL, 12.07.2008). Die Gesellschaft feiert also Kämpfer, die in gewisser Weise auch Gewalt ausüben.
Tatsächlich sind nach Sofsky (1996) Gewalt und Kultur unlösbar miteinander verschränkt. Nicht nur kann Gewalt Ausprägung einer Kultur sein. Sondern der Mensch ist auch bestrebt, seine Freiheit zu erweitern, indem er Gewalt gegen kulturelle Formen ausübt, die er als einengend empfindet. Der Fall, daß keine Gewalt ausgeübt wird, ist eher die Ausnahme und ergibt sich auch nicht aus einer plötzlichen Moralität, sondern aus Sättigung (vgl. Cierpka und Diepold 1997, S.210f.).
Und auch die politische Rhetorik - beispielsweise der genannten passionierten Jäger - ist von einer dermaßen beispielhaften (in dem Falle verbalen, allerdings ist die verbale sehr stark mit auch körperlichen Formen assoziiert) Aggressivität gegen Andere, die ihre Meinung nicht teilen - bevorzugt natürlich gegen solche, die einem nicht direkt gegenübersitzen -, daß man sehr wohl den Eindruck haben muß, daß auch das Ausleben der Gewalt zu unserer Kultur gehört. Nur tun viele Menschen es nicht bewußt oder aber "notgedrungen": Ein beliebtes "Argument", das sich Vegetarier anhören dürfen, dreht sich etwa darum, daß diese Menschen häfig sehr wohl Schuhe oder Gürtel aus Leder tragen. Und sie müssen sehr wohl aufpassen müssen, ob die geliebten Pommes nicht mit tierischem Fett (so einen Fall gab es bei McDonald's) oder die Gummibärchen nicht mit Gelatine vom Schwein hergestellt wurden.
Die letzten Jahre sind auch in Deutschland von einer Militarisierung der Politik gekennzeichnet. Militärische Gewalt wird nicht nur als wichtiges Mittel der Politik (vgl. das Zitat von Peter Struck, "Deutschland [werde] auch am Hindukusch verteidigt"), sondern auch als ethisch gerechtfertigt angesehen. Gerade im militärischen Bereich werden sehr viele Sprachregelungen verwendet, die eine hohe Billigung von Gewalt und eine Abstumpfung gegen diese darstellen. Und auch die Regierung hat natürlich ein Interesse daran, Kriege zu rechtfertigen oder die Wirkungen der eigenen Beteiligung kleinzureden: Zur Rechtfertigung der deutschen Beteiligung am Luftkrieg gegen Jugoslawien wurde erklärt, das serbische Militär verfüge über einen sogenannten "Hufeisenplan" zur "ethnischen Säuberung" des Kosovo. Es gibt bis heute keine konkreten Beweise dafür, daß ein solcher Plan existierte. Dieser Plan erschien also eher als eine Propagandalüge, die angestrengt worden war, um die Luftangriffe zu rechtfertigen (vgl. "Medien und Krieg: Der Hufeisenplan", abgerufen am 02.12.2007; Angerer und Werth 2001). Weiterhin erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die deutschen Kampfjäger, die für die Mission "Enduring Freedom" Aufklärungsflüge in Südafghanistan unternähmen und - wie es im Militärischen heißt - Ziele "anmalen", würden ja nicht selbst schießen (vgl. "Einsatz im Kampfgebiet, aber kein Kampfeinsatz", abgerufen am 02.12.2007). Von Seiten der NATO bzw. USA war man während der Kriege in Jugoslawien und Irak darum bemüht, möglichst wenig Opfer zu zeigen. Deswegen beschränkte sich das präsentierte Bildmaterial letztlich auf vorausgewählte Orte, an denen sogenannte "eingebettete" Journalisten US-Fahnen schwenkende Iraker sehen konnten, und Infrarotbilder, auf denen Menschen bei der gewählten Zoomstufe nicht zu erkennen waren, oder ohnehin nur als Silhouetten erscheinen, die keine individuellen Körpermerkmale besitzen. Während Meldungen und Bilder von durch Schlamperei oder Inkaufnahme verletzten oder umgekommenen Zivilisten, die die Regimes in Jugoslawien oder im Irak veröffentlicht hatten, empört mit den Worten zurückgewiesen wurden, wie man derartig "unbedeutende Kollateralschäden" so schamlos instrumentalisieren könne (vgl. Martig 2003). Man wußte spätestens seit dem Vietnamkrieg um die Macht der Bilder: Denn die öffentliche Meinung gegenüber diesem Krieg war in dem Augenblick gekippt, als die Fernsehzuschauer sehen konnten, daß dieser Krieg so gar nicht dem entsprach, was die Regierung darüber erzählte. Vielleicht ist es deswegen wichtig anzumerken, daß besonders viele Amokläufer (24%) von Beruf Polizisten oder Soldaten sind (vgl. Safe School Initiative 2001, S.).
[Eine These zur Erklärung von Amokläufen mag es tatsächlich auch sein, daß von staatlicher Seite aus Gewalt als Lösung für Probleme dargestellt wird und frustrierte Jugendliche dies möglicherweise verinnerlichen.]
Genauso werden Durchsetzungsfähigkeit und Konfliktneigung als Tugenden angesehen, die einen Bewerber für eine gute Position ausmachen. All diese impliziten und expliziten Ausübungen von Gewalt sind solange toleriert, wie sie an gewisse Regeln gebunden sind, die "Tiefschläge" vermeiden sollen. Dabei interessant ist, daß tatsächlich Computerspiele doch die strengste Regelbindung besitzen, da sie im Unterschied zum realen Leben nur das erlauben, was ihre Algorithmen zulassen. Sind beispielsweise in einen simulierten Boxkampf Tiefschläge gar nicht erst als Möglichkeit einprogrammiert, so kann der Spieler diese auch nicht durchführen. Im realen Leben werden Boxer vielleicht ggf. doch schon einmal Techniken anwenden, die vom sportlichen Gesichtspunkt her nicht ganz astrein sind, wenn sie damit davonkommen. In den Medien wird allerdings kolportiert, es gehe in ihnen darum, möglichst indiskriminit und regellos zu handeln. Diese Vorstellungen ergeben sich aus der Diskrepanz der Wahrnehmungen des Spieler, der die Mechanismen kennt, die dem Spiel inhärent sind, und des außenstehenden Zuschauers, der gar nicht verstehen kann, worum es dabei überhaupt geht. Wer mit dem "pornographischen Blick" oder der Attitüde des "Bildungsbürgers", der sich mit "so etwas" aus Prinzip nicht abgibt an das Spiel herangeht, kann diese Mechanismen allerdings auch nicht durchdringen.
Ansonsten haben die Deutschen auch Erfahrungen damit, Menschen zuerst als eine immense Bedrohung für das abstrakte Wohl des Volkes darzustellen, die in Wahrheit nicht die Mittel - weder Lobby noch Interesse noch gefährliche Ideologie - haben, um derartige Vorstellungen überhaupt zu entwickeln, geschweige denn durchzusetzen, und diese dann ohne weitere Empathie generalstabsmäßig zu entmenschlichen. In diesem Kontext sei gar nicht einmal so sehr von dem Umgang der Nationalsozialisten mit den Juden gesprochen, weil dies ein "Totschlagargument" der besonderen Art wäre, sondern vielmehr vom Umgang der deutschen Staatsmacht mit der KPD in den 1950er Jahren oder auch von den Folgen der Selbstauflösung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS), der immerhin öffentlichkeitswirksam Mißstände hatte anprangern können, so daß bis dahin die Staatsmacht es nicht gewagt hatte, mit Gewalt gegen tatsächliche oder vermeintliche Extremisten vorzugehen, dessen Selbstauflösung dann aber zu einem "Dammbruch" der Gewalt führte (vgl. Siepmann 1990, S.340; nach Krauskopf 2004, S.69 Fußnote 86).
Bei den Computerspielern handelt es sich übrigens um eine Gruppe, die noch sehr viel größer ist als die Gruppe der Schützen und Jäger. So gab es in Deutschland im Jahr 2005 etwa 1.6 Millionen Sportschützen und 350.000 Jäger (bmi.gv.at, S.1). Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2006 hatten allerdings 38% der Deutschen Erfahrung mit Computerspielen (vgl. Quandt 2007, S.5). Dies sind etwa 31 Millionen Menschen . Nach der Untersuchung der Safe School Initiative (2002) war auch gerade festgestellt worden, daß . Das Argument, hier müsse eine Minderheit bek&aump;ft werden, würde dann viel eher auf die Schützen und Jäger passen als auf die Computerspieler. Es soll allerdings gezeigt werden, daß man sehr leicht in den Wahn abgleitet, wenn man so argumentiert.
b) Bedingte (Un-)Wahrscheinlichkeiten
Uwe Schünemann hatte als Begründung für seine Forderung propagiert, daß "[d]ie überwiegende Zahl der Amokläufer in der [sic!] vergangenen Jahren [...] solche Spiele gespielt" habe (http://www.pr-inside.com/de/innenminister-der-union-wollen-killerspiele-verbie-r121859.htm; abgerufen am 09.06.2007). Allerdings ist diese Behauptung aus verschiedenen Gründen falsch:
(i) Der Begriff des "Amoklaufs", der hier verwendet wird, ist allerdings sehr eingeschränkt. In der Literatur wird ein Amoklauf zum Beispiel als (versuchte) Tötung von mindestens drei Menschen bezeichnet. Allerdings halten sich die Medien nicht an diese Definition, sondern bezeichnen Gewalttaten vergleichsweise willkürlich als "Amokläufe".
Besonders deutlich wird dies natürlich bei sogenannten "school shootings", die von jugendlichen Tätern im Umfeld von Schulen begangen werden und sehr viel mehr Aufmerksamkeit erregen als Amokläufe, die in einem anderen Umfeld und insbesondere von Erwachsenen begangen werden, eben auch deshalb, weil im intuitiven Reflex kaum die Verbindung zu Computerspielen gezogen wird. Tatsächlich sind diese "school shooter" im Schnitt mit 15.6 Jahren sehr jung (vgl. Robertz 2005, S.50f.).
In Deutschland sind allerdings Amokläufe selbst nicht wissenschaftlich untersucht, sondern nur die Berichterstattung über als "Amokläufe" dargestellte Ereignisse, so daß nicht klar ist, wieviele Amokläufe es in Deutschland wirklich gibt (vgl. LKA NRW 2007, S.1f.). Gemäß den international verfügbaren Daten sind allerdings Amokläufer im Schnitt deutlich älter, nämlich 35.2 Jahre (vgl. Faust 2003, S.21f.).
Auch vom Anteil der "school shootings" an allen Amokläufen her sind Jugendliche unter den Amokläufern eher unterrepräsentiert: So gab es hochgerechnet nach Faust (2003) zwischen 1974 und 2002 weltweit 464 Amokläufe nach obiger Definition (vgl. Faust 2003, S.21f.), aber nur 75 "school shootings" (vgl. Robertz 2005, S.50f.). Diese machen also "nur" 14% der Amokläufe aus. Nach der deutschen Kriminalstatistik verüben allerdings Jugendliche und Heranwachsende etwa 47% aller Straftaten (vgl. Heinz 2004, S.57). Insofern sind also Jugendliche und Heranwachsende unter allen Amokläufern deutlich unterrepräsentiert.
Nun könnte man zunächst erwarten, daß unter den "school shootern" schon allein deshalb häufiger Computerspieler zu finden sind, weil Computerspieler im Schnitt eher jünger sind. Allerdings ist auch dies nicht der Fall, und anscheinend haben "school shooter" im Schnitt eher weniger Kontakt mit gewalthaltigen Computerspielen:
Sebastian Bosse, der Amokläufer von Emsdetten, hatte derartige Spiele, die von den Medienkritikern als besonders gefährlich gegeißelt wurden, nicht spielen können, weil sein Rechner nicht die erforderliche Hardwareausstattung hatte (vgl. http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/23/0,3672,4078743,00.html, abgerufen am 07.11.2007). Cho Seung-Hui (Virginia Tech) hatte zuletzt Jahre zuvor Videospiele gespielt, die keine gewalttätigen Themen enthielten (vgl. Virginia Tech Review Panel 2007, S.32). Bei der Durchsuchung seiner Habe war aufgefallen, daß er kein einziges Computerspiel besaß. Im Falle von Felix, eines der Mörder von Tessin - in diesem Zusammenhang war ebenfalls, u.a. von "Panorama" behauptet worden, vermeintliche "Killercomputerspiele" seien für seine Tat verantwortlich, hätten etwa die Hemmschwelle des Täters herabgesetzt, so daß dieser schließlich dafür bereit gewesen sei - wurde eine Verantwortung von Computerspielen von den Ermittlungsbehörden ebenfalls explizit ausgeschlossen (vgl. ). Robert Steinhäuser (Erfurt) hatte gerade das Spiel "Counterstrike", das zuerst für seinen Amoklauf verantwortlich gemacht wurde, nicht spielen können, weil sein Rechner nicht über einen Internetanschluß verfügte (vgl. ). Er hatte ähnliche Spiele, wie etwa "Quake 3" zwar gespielt, für diese wurde eine auslösende Rolle aber ebenfalls explizit ausgeschlossen (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.). Dies ist nicht nur ein Einzelfallbild, sondern es läßt sich auf alle "school shootings" generalisieren:
Tatsächlich fand eine Untersuchung der "Safe School Initiative" (2002), daß nur 12% der jugendlichen Amokläufer, die zwischen 1974 und 2000 ein "school shooting" durchgeführt hatten, sich mit gewalthaltigen Computerspielen beschäftigt hatten, allerdings sehr viel mehr mit gewalthaltiger Literatur, bzw. selbst Gewaltphantasien produziert hatten (vgl. Safe School Initiative 2002, S.26). Während gleichzeitig - laut verschiedenen Studien, auch der KFN-Studie(!) - ca. 40% der Jugendlichen gewalthaltige Computerspiele konsumieren (vgl. Haier 2005, S.38; Baier und Pfeiffer 2007, S.30). Amokläufer scheinen also im Unterschied besonders wenig Kontakt zu gewalthaltigen Computerspielen zu haben. Es erscheint kaum plausibel, etwas als "ursächlich" für Gewalttaten darzustellen, das eine unterdurchschnittlich unter den Gewalttätern vertretene Gruppe in Bezug zur entsprechenden nicht gewalttätigen Gruppe unterdurchschnittlich häufig konsumiert hat.
Ähnliche äußerte sich die Freie Wählergemeinschaft „Bürger für Karlsruhe“ - neben üblichen Kritikerargumenten -, es sei „eine Tatsache, dass ausnahmslos jeder gewaltbereite Jugendliche diese Spiele konsumier[e]“ (vgl. "Killerspiele-Nacht gibt falsches Signal", abgerufen am 10.05.2009). Allerdings ist auch diese Aussage inhaltlich falsch und noch viel extremer als die von Medienkritikern, die – selbst Hopf mit seiner bis dato unübertroffen gebliebenen „Korrelation“ - „nur“ eine höhere Wahrscheinlichkeit von Spielern behaupten, gewalttätig zu werden. Vielmehr gibt es auch die Vorstellung, daß viele besonders gewaltbereite und -tätige Jugendliche aufgrund ihres Lebensstils oder ihrer finanziellen Situation gar ziemlich wenig Spiele konsumieren (vgl. ).
(ii)
"Ich töte gern"
("Jagd
- der legale Lustmord", abgerufen am 26.06.2008)
"Seit meinen ersten Jagdabenteuern weiß
ich: Jagd eröffnet einen Freiraum für Verbrechen bis zum
Mord und für sexuelle Lust, wann und wo immer gejagt
wird."
Jagd ohne Mord ist ein Begriff, der sich selber
aufhebt."
"Die wirkliche Jagd ist ohne vorsätzliche
Tötung nicht zu haben. Leidenschaftlich Jagende wollen töten.
[...] [E]s ist das, der wunderbare Samenerguss, der erste bei
Bewusstsein."
(Paul Parin, "Die Leidenschaft des
Jägers")
"Über die Jagd wird wohl noch mehr
gelogen als über den Krieg. Sie ist selbst einer. Ein höchst
ungleicher freilich, ein Krieg gegen völlig wehrlose Wesen,
wobei die Jäger nichts riskieren als allenfalls ein bisschen
Schnupfen oder einen Sturz von ihrem Aussichtsturm."
(Karlheinz
Deschner, in: "Main-Post", 22.01.2005)
"Dass die Jäger den Wald gesund
halten, ist ein Schmarrn.Wir haben in Österreich 110.000
Jäger.Die schießen doch nicht unentwegt auf kranke
Tiere.Jagd ist eine Lusthandlung."
(Antal Festetics,
Wildbiologe)
"Viele Jäger begreifen ihr Treiben als
Sport.Was aber ist sportlich daran, wenn Menschen anderen
fühlenden Lebewesen Schmerzen bereiten oder sie gar
töten?"
(Franz Alt, Fernsehjournalist)
Bauen wir einmal eine ähnliche Argumentation auf und schauen uns die Konsequenzen an. Gebrauchen wir einmal Schünemanns Argument gegen ihn selbst, gegen Beckstein und gegen Stoiber: Hermann Göring (vgl. "Der Geist aus der Flasche", abgerufen am 25.05.2008), Erich Honecker (vgl. "Das letzte Halali des Erich Honecker", abgerufen am 25.05.2008) und Erich Mielke (vgl. "Mielkes Waffen-Sammlung wird versteigert", abgerufen am 25.05.2008) waren allesamt "passionierte[.] Jäger". Freilich ohne daß wir unterstellen wollen, daß Jäger auch einen Hang zu totalitären Ideologien hätten oder das Leben verachteten (vgl. "Jagd: Das sagen Kleingeister und große Geister", abgerufen am 25.05.2008). Auch ist auffällig, daß ein Großteil der Amokläufer eine überdurchschnittliche Faszination an realen Waffen hatten und eben auch in Schießclubs überdurchschnittlich aktiv waren (vgl. Bott 2002).
Allerdings frönen weltweit auch Millionen anderer Menschen diesem "Hobby". Ob man es jetzt pervers findet oder Jäger für geistige Krüppel hält oder nicht -- daran kann man vielleicht auch seine eigene Objektivät überprüfen --, ändert auch nichts daran, daß die meisten Schützen und Jäger gesetzestreue und psychisch einigermaßen gesunde Menschen sind und eben nicht Amok laufen. Diese vermeintliche "Eigenschaft", die Schünemann festgestellt haben will, bedeutet also nichts.
Bösche und Geserich (2007) befinden, daß im Rahmen einer solchen Äußerung auch die falsche bedingte Wahrscheinlichkeit erklärt wurde, und bestätigen damit insbesondere das Argument der Spieler, daß täglich Millionen Menschen solche Spiele spielen, es aber im Vergleich dazu nur eine sehr geringe Anzahl von Amokläufen selbst von jugendlichen Tätern gebe: Was die Kritiker angäben, sei die Wahrscheinlichkeit des Konsums gegeben eine Gewalttat. Wolle man aber die Frage beantworten, ob gewalthaltige Computerspiele tatsächlich zu Amokläufen "verleiteten" oder "animierten", müsse man die Wahrscheinlichkeit einer Gewalttat gegeben den Konsum messen und von dieser die Wahrscheinlichkeit einer Gewalttat gegeben keinen Konsum subtrahieren [In quasi-mathematischer Notation: DP = P(e|u) - P(e|~u)]. Gewalthaltige Spiele kämen nur dann als "Ursache" in Frage, wenn jugendliche Konsumenten wirklich deutlich wahrscheinlicher Gewalttaten verübten als Nichtkonsumenten (vgl. S.58). Für diese Größe werden in der Wahrscheinlichkeitsforschung zwei Bezeichnungen und Definitionen geführt:
- Sehr häufig wird der Begriff der Kontingenz verwendet. Allerdings ist diese Größe ebenfalls nicht hinreichend, um eine Kausalität zu beweisen, da auch Größen, die nur über eine Drittvariable zusammenhängen, etwa die Geburtenrate und das Vorhandensein von Störchen, eine positive Kontingenz aufweisen. Die Kontingenz wird entsprechend unter der Annahme berechnet, daß die Ursache und der Effekt keine gemeinsamen Ursachen haben (vgl. Hagmayer 2000, S.28f.).
- Eine synthetische Definition, die die Perspektive "ex ante" ("im Vorhinein") und "ex post" ("in Rückschau") zusammenführt, ist die Probability of Sufficiency and Necessity. Die Probability of Sufficiency bildet ab, wie hinreichend die Ursache für den Effekt ist, d.h. wie wahrscheinlich es ist, daß eine Ursache den Effekt hervorruft unter der Voraussetzung, daß beide zuvor nicht aufgetreten sind. Sie liefert also ein Maß, wiestark eine Ursache einen Effekt beeinflußt. Es ist PS = (P(e|u) - P(e|~u)) / (1 - P(e|~u)). Die Probability of Necessity bildet ab, wie notwendig die Ursache für den Effekt ist, d.h. sie gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß der Effekt nicht aufgetreten wäre, wenn die Ursache nicht aufgetreten wäre, unter der Voraussetzung, daß beide schon aufgetreten sind. Es ist PN = (P(e|u) - P(e|~u)) / P(e|u). Dieses Maß wird auf die gleiche Formel wie die Kontigenz zurückgeführt, setzt allerdings zusätzlich noch die sog. Monotonizität voraus, d.h. die Annahme, daß eine Ursache entweder Auslöser des Effektes ist oder nicht wirkt, aber niemals den Effekt hemmt (vgl. ebd., S.32f.). Dies ist allerdings bei Computerspielen nicht unbedingt gegeben. So gibt es auch Studien, in denen Testpersonen, z.B. hyperaktive Kinder, die diese konsumiert hatten, nach einem solchen Kurzzeitversuch weniger aggressiv waren als vorher (vgl. ).
(iii) Nun möchte man vielleicht fragen, woher diese Darstellungen kommen. Im Falle von Schünemann oder Beckstein, wenn diese eine Ursächlichkeit von Computerspielen für Gewaltakte behaupten, kann man davon ausgehen, daß es sich um schlichte Unwissenheit bzw. um Intuitionen handelt, die nicht wissenschaftlich gerechtfertigt sind, wie diese auch freimütig zugeben (vgl. z.B. "Ist Schünemann pervers oder einfach nur dumm?", abgerufen am 27.10.2007). Allerdings gibt es von Günther Beckstein auch weitergehende Behauptungen, die eher davon zeugen, daß es sich hier um bewußte Irreführungen handelt, da Beckstein die diesbezüglichen Tatsachen bekannt sein müßten, wenn er seine damaligen Aufgaben zumindest halbwegs ordentlich erledigt und sich nicht allein durch markige, aber unausgegorene Ideen hervorgetan hat. So forderte der damalige bayerische Innenminister etwa mit Blick auf die Kriminalstatistik der 18-25jährigen, für die Indizierungen von Computerspielen natürlich nicht mehr greifen, ein Verbot solcher Spiele (vgl. "Aufstand gegen von der Leyen: Beckstein fordert totales Verbot von 'Killerspielen'", abgerufen am 08.05.2008). Damit hatte er versucht, seine rein intuitiv getroffene Aussage mit einer Konstante der Kriminalistik zu "beweisen", die - ganz unabhängig von der Verfügbarkeit von Computerspielen - seit Beginn der Erfassung Ende des 19.Jahrhunderts in jedem Land der Welt konstant zu finden ist, daß nämlich die Altersgruppe der jungen Erwachsenen die meisten Straftaten verübt (vgl. Heinz 2004, S.27). Wenn man weiter ausdifferenziert, so zeigt sich ansonsten, daß die Altersgruppe der 21jährigen und Älteren nur noch 7% aller Straftäter ausmacht (vgl. dazu etwa Pfeiffer(!) XXXX, S.6). Genau genommen hat dieses Argument also keine Aussagekraft. Ansonsten zeigen verschiedene Statistiken auch auf, daß während des Zeitraums, in dem von Beckstein so genannte "Killerspiele" verfügbar waren, die Gewaltkriminalität in den USA um 53%, die Rate der von Jugendlichen begangenen Morde sogar um 77% abnahm (vgl. Sternheimer 2007, S.13).
3. Schließlich zeugen gerade die Freizeitbeschäftigungen von Beckstein, Schünemann und Stoiber doch davon, daß sowohl Gewalt in unserer Gesellschaft einen Platz hat, und diese und die markigen Worte, mit denen sie Computerspiele und deren Konsumenten bedenken, selbst von ganz erheblicher Aggressivität.
4. Ansonsten machte Schünemann mit seinen Äußerungen auch deutlich, daß Instrumente wie Vorratsdatenspeicherung und Onlinedurchsuchung seinem Bekunden nach vielmehr indiskriminit und ohne konkreten Verdacht angewandt werden sollen. So wurde er in einem Interview mit dem Magazin "stern" in der Hinsicht zitiert, er plane, alle Computerspieler "dingfest" zu machen (siehe V.2.2).
5. Schünemann hatte Schützenvereine, Schießclubs und ähnliche Vereinen mit dem Argument in Schutz genommen, daß diese Jugendlichen Werte vermitteln würden (vgl. etwa bei „Maybritt Illner“ am 26.03.2009). Ohne Ahnung würde man hier nur auf die Idee kommen, daß Jugendlichen beigebracht werde, nur auf die Scheibe zu zielen, und sie für gute Schießleistungen gefeiert werden. Andererseits hatten eigentlich alle jugendlichen Amokläufer in solchen Vereinen trainiert. Die von Schünemann propagierte „Wertevermittlung“ hatte bei ihnen also offenbar nicht funktioniert. Streng genommen hätte das für Schünemann eigentlich ein Grund sein müssen, ein Verbot aller Schützenvereine, Schießclubs etc. zu fordern. Dies hatte er aber nicht getan, und sein Argument damit als ideologisch aufgezeigt.
6. Ein zynisches Fazit: Brutalisierung durch Medienkritiker?
Angesichts der Aggressivität, mit der insbesondere die „passionierten Schützen“ und die Konservativen gegen Computerspiele angeredet haben, kann man mittlerweile kaum anders als selbst zynisch zu werden.
Da werden - mit dem eigenen Weltbild gerechtfertigt – Computerspieler mit den Unterstützern , Phantasien über staatliche Gewaltausübung geäußert, etwa Razzien bei Computerspielern zu veranstalten und wer böse „Killerspiele“ besitze, bis zu drei Jahre ins Gefängnis zu sperren.
Wenn, wie sie selbst Computerspielern, die angesichts solcher Angriffe gereizt reagieren, mit der Behauptung über den Mund fahren, daß aggressive Rede sei die Vorstufe körperlicher Gewalttätigkeit, und sich damit wieder einmal selbst bewiesen sehen, müßte man einmal nachfragen, wo, wenn doch nur Computerspiele aggressiv machen, die Aggressivität denn herkommt, die diese Politiker an den Tag legen. Da die meisten der konservativen Medienkritiker, die sich durch diese Angriffe ausgezeichnet haben, Mitglieder von Schützenvereinen sind, läge es nahe, vielleicht einmal dort zu suchen, und man könnte die These aufstellen, daß entweder diese Aggressivität dort im Rahmen der „Wertevermittlung“ mit vermittelt wird, sich zumindest doch parallel zu ihr ergibt, oder ob am Ende die reklamierte „Wertevermittlung“ bei ihnen nicht funktioniert hat. (Noch dazu hatten sich auch die meisten der jugendlichen Amokläufer ihre Kenntnisse über Schußwaffen in Schützenvereinen, Schießclubs und ähnlichem erworben hatten.)
Da hört man, daß „ein gestandenes Mannsbild“ auch mit 1.2 Promille Alkohol im Blut noch Auto fahren können müsse, und es sei Ausdruck von Mannhaftigkeit und gelungener sozialer Integration betrachtet wird, zum Spaß im Wald Kaninchen – oder, ebenfalls tendentiell konservative Klientel – als Soldat in Afghanistan Taliban über den Haufen zu schießen. Ein erwachsener Mann spielt also nicht, sondern er schießt richtig. Seine Amokläufe und -fahrten darf er überall veranstalten – im Wald, hinter dem Steuer, im Saal, vor Mikrofon und Kamera oder in fernen Ländern, wo „Deutschland […] verteidigt“ wird. Die Hauptsache ist aber, daß man jemandem damit richtig wehtut. Und schließlich kennen nicht einmal Innen- und Justizminister die eigenen gesetzlichen Bestimmungen und/oder sind nicht dazu fähig, Statements abzugeben, die keine gravierenden inhaltlichen oder menschlichen Fehler enthalten.
Und auf welcher Ebene ist die politische Kultur angekommen, wenn man (CDU), wenn die Argumente ausgehen, versucht, Druck aufzubauen, um erwachsene Menschen dazu zu zwingen, mittlerweile sogar Inhalte nicht mehr zu konsumieren, von denen man bis dato der Meinung war, diese könnten keinen 12jährigen oder Älteren mehr „sozialethisch desorientieren“? Wenn Uwe Schünemann meint, Spieler dürften „aber nicht diese Killerspiele“ spielen, aber in einen ohnehin nicht definierten Begriff dann noch willkürlich Spiele hineindefiniert, ist das auch keine sachlichere Definition als wenn Klaus Miehling sagt, man dürfe ruhig zur Gitarre singen, aber ja nicht auf den Korpus schlagen, weil das „Gewaltmusik“ sei. Letztlich ist die Differenzierung zwischen dem, was als „gut und erlaubt“ angesehen wird und dem, was „verdachtenswert und schlecht“ sei, auch kaum nachzuvollziehen – da wird es als „Ertüchtigung“ angesehen, in einem „Schießkino“ mit einer scharfen Waffe auf real abgefilmte Tiere zu schießen, aber der „semantische Akt“ des Mausklickens auf Polygonfiguren wird als aggressionsfördernd, „die Tötungshemmung abtrainierend“ oder als „Training für den Amoklauf“ angesehen. Amokläufe werden immer noch mit realen Waffen und auf Lebewesen durchgeführt. Letztlich ist die Distanz zwischen dem Tier, auf das man mit einer realen Waffe schießt, und dem Menschen, auf den man einer realen Waffe schießt, aber kleiner.
Damit ist die „Differenzierung“, die die Politiker und „Experten“ da machen, letztlich völlig willkürlich und es auch unsinnig, von den Spielern zu verlangen, daß sie andächtig darauf lauschen, wenn Provinzpolitiker plötzlich entdecken, daß ein neues Spiel auf die Liste der „besonders brutalen Spiele“ zu setzen sei – wohlgemerkt eines, das bis zum Tag zuvor als für Zwölfjährige unbedenklich angesehen wurde, wie im Falle des Strategiespiels „Warcraft 3“ geschehen -, und dann versuchen, eine Hetzkampagne loszutreten, welche „Menschenverachtung“ Veranstalter von LAN-Parties für Erwachsene an den Tag legen, wenn sie Teilnehmern erlaubten, „so etwas“ zu spielen. Letztlich will man damit auch nur selbst wieder maßgeblich werden, über das Privatleben der Menschen bestimmen wie seinerzeit die katholische Kirche mit dem „Index der verbotenen Bücher“, bei dem man Inhalte einfach deshalb verbot, weil diese einfach nicht in die Weltanschauung hineinpaßten, die man den Menschen gerne verordnen wollte. Schießwut drückt sich letztlich im ganzen Denken und Tun aus.
Letztlich führt aber gerade dieser Zynismus zu nichts, weil er die Schützen auch nicht anders charakterisiert als die konservativen Reflexpolitiker die Computerspieler beschrieben hatten. Und schließlich sind auch nicht diejenigen Jugendlichen Amok gelaufen, die in ihrem Handeln zu wenig reglementiert wurden, sondern gerade diejenigen, in deren Haushalten permanent Leistung abgefordert wurde, in denen eine strikte Erziehung gepflegt wurde, bei der Disziplin und Kontrolle groß geschrieben wurden, der Vater Haushaltungsvorstand und nicht zu kritisierender Patriarch war. Allerdings ist auch nicht davon auszugehen, daß die Reflexpolitiker, wenn Computerspiele, jegliche Gewaltdarstellungen und auch der Gebrauch „böser Worte“ dann endlich verboten wäre, sich mit den wahren Ursachen der Gewalt, die es zweifelsohne dann immer noch geben wird, auseinandersetzen würden. Denn diese „Werte“ bilden die Grundlage ihres Weltbildes: wenn Christian Pfeiffer damit beginnt, mit dem Argument die Ganztagsschule zu propagieren, dann würden die Schüler wenigstens am Nachmittag etwas „Konstruktives“ tun, von Blaskapellen und Fußballvereinen redet, oder Uwe Schünemann und seine Parteikollegen den Schützenverein zu einem Dreh- und Angelpunkt der Wertevermittlung in der Gesellschaft erklären und Jugendlichen regelmäßig das Schießen beibringen wollen, dann äußern sie damit immer mit, daß es einfach erwünscht ist, wenn Kinder und Jugendliche ein gewisses Maß an Kontrolle erfahren – möglichst natürlich während ihrer gesamten wachen Zeit.
Ebensowenig aber, wie Amokläufe von Rentnern oder von tief gläubigen Müttern im Westen der Republik begangenen Kindstötungen benutzt werden konnten, um Dinge, die einem schon immer am Herzen lagen, etwa deren vermeintlichen Medienkonsum oder der „erzwungenen Proletarisierung“, anzuprangern, preschten diese Reflexpolitiker angesichts solcher Ereignisse mit Vorschlägen vor, sie wollten die Menschen endlich vor der „Gewalt durch Senioren“ schützen und soziale Einbindung durch christliche Missionierung oder durch Schützenvereine fördern.
Wie der (Kriminologe) Günther Pilz konstatierte, könnte aber genau diese Kontrolle ein Aspekt sein, die zur Gewalttätigkeit beiträgt. So lasse sich beobachten, daß trotzdem die traditionellen „Hooligans“ weitgehend verschwunden seien, nun die ursprünglich gewaltfernen „Ultras“ im gleichen Maße zunehmend gewaltbereiter würden, wie es polizeiliche Strategie sei, mit Repressionsmaßnahmen „präventiv“ gegen potentielle Gewalttäter zu handeln (vgl. „“, DLF, xx.xx.2009).
Allerdings wird niemand sein Weltbild hinterfragen, sondern immer nur Beweise suchen, die dieses unterfüttern und gegen Kritik immunisieren. Computerspiele wurden in der letzten Zeit für kaum einen Mißstand nicht verantwortlich gemacht. Seien es Jugendkriminalität, schlechte Noten, wurde auch das Bild des vermeintlich computersüchtigen und schließlich amoklaufenden computerspielenden Soziopathen heraufbeschworen. Von diesem Bild konnte es dann auch keine Abweichung geben: Wenn nun ein Schützenbruder Amok lief oder ein Fußballfan sich prügelte, so wurde nicht analysiert, lag dies niemals daran, daß im Schützenverein, im Fanclub, im Umfeld des Fußballspiels oder hinter verschlossenen Türen – es sei denn natürlich, auf dem Computer - etwas Falsches passiert wäre, sondern es wurde ganz messerscharf geschlossen, das habe an den Computerspielen gelegen. Bei den vielen Jugendlichen, die am Computer spielen, mußte man irgendwann schon aus Gründen der Wahrscheinlichkeit auf einen stoßen, der tatsächlich „Counterstrike“ und Konsorten gespielt hatte. In der Logik der Politiker waren also sogar die schuld, die den Schützenverein oder das Fußballspiel gar nicht erst besucht hatten. Auch dies ist ja ein klassisches Argumentationsmuster, ist nämlich derjenige, den man zum Feind erklärt, plötzlich selbst schuld an seiner Stigmatisierung. Manche Computerspieler wähnten bereits die „Killerspielersterne“ in der Luft liegen, womöglich farblich abgestuft nach der Altersfreigabe („ab 12“, „ab 16“ oder „ab 18“) der inkriminierenden Medien, damit man die Schwerverbrecher auch von den leichten Fällen, die vielleicht noch in die Gesellschaft wieder zu integrierenden sind, unterscheiden könne. Vermutlich aber ist es den betreffenden Politikern nicht so klar, daß sie da Muster abrufen, die in der Vergangenheit zu kleinen und großen Gewaltakten geführt hatten, sondern sie möchten sich „nur“ als Helden profilieren, die etwas gegen außerordentlich gefährliche Verbrecher getan haben. Und das ist eben um so leichter, je weniger tatsächliche Gefahr von ihnen ausgeht.
2.1.6 Das „Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“
Mich persönlich haben die Amokläufe, von denen in den letzten Jahren immer wieder berichtet wurde, schockiert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob daraus politisch oder im Leben die richtigen Schlüsse gezogen werden. Wem aber ist geholfen, wenn aus Ratlosigkeit blinde Wut wird und man als persönlich Betroffener beginnt, selbst dreinzuschlagen?
Das „Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden“ ist ein Verein, der nach dem Amoklauf von Winnenden, bei dem am 11.März 2009 16 Menschen getötet wurden, von Eltern von Angehörigen gegründet wurde. Neben einem schärferen Waffenrecht wird in einer bundesweiten Unterschriftenaktion auch ein Verbot von, so wörtlich „Killerspielen, die dazu dienen, Menschen zu töten“ gefordert (vgl. ). Man fragt sich dabei, ob dies bloß ahnungslos und schlecht ausgedrückt ist, ob man damit einen bestimmten Eindruck vermitteln wolle, Computerspiele seien für sich bereits tödliche Waffen, oder ob man diese Haltung selbst vertritt, daß nämlich Menschen, die gewalthaltige Spiele spielen, dazu prädisponiert seien, Amokläufe zu begehen – ob in einem kausalen Zusammenhang, oder sie zumindest zur Vorbereitung nutzen könnten.
Schließlich aber gab die Leiterin in einem Interview zu Protokoll, daß sie überhaupt nicht wisse, warum Tim K., der Amokläufer von Winnenden, seine Tat überhaupt begangen hatte („Deutschland heute“, DLF, 05.08.2009). Nun wissen nicht einmal die „medienwirksamen“ Politiker und „Experten“, sondern sogar die „Interessengruppe“ überhaupt nicht, ob die Forderungen, die sie da aufstellt, überhaupt etwas ändern würden.
2.1.6 Brad Bushman und Craig Anderson (2001)
Anderson und Bushman veröffentlichten im Jahr 2001 sowohl eine der in der Literatur meistzitierten Metauntersuchungen zum Thema "Computerspiele und Gewalt" (Anderson+Bushman 2001) als auch einen populärwissenschaftlichen Artikel (Bushman+Anderson 2001), der darauf zugeschnitten war, letztlich einen extremen Zusammenhang zwischen Mediengewalt und aggressivem Verhalten darzustellen. Dieser Artikel ist in vielerlei Hinsicht allerdings eher kritisch zu sehen und erlangt viel eher den Charakter einer Suggestion. (Auch die "Metaanalyse" Anderson+Bushman ist dabei aber ausgesprochen prägnant: Allein der sehr lange Titel des Papiers nimmt eine halbe Seite ein, so daß er die gleiche Empfindung der Plakativität wie eine Überschrift in der "Bild"-Zeitung vermittelt. Darin ist die Suggestion des "Skandals" eigentlich immer schon enthalten . Zum anderen gebrauchen die Autoren doch recht kuriose Argumentationslinien, berichten sie etwa an anderer Stelle davon, anläßlich der Terroranschläge von New York und Washington am 11.September 2001 eine Diskussion um die Darstellung von Gewalt in den Medien entstanden sei (vgl. Bushman+Anderson 2002, S.1679), ganz so, als habe man geglaubt, Medien könnten jetzt nicht mehr nur Automatenaufbrüche (vgl. Hopf) oder Amokläufe (vgl. Pfeiffer) "erklären", sondern auch den islamistischen Terror.)
1. Kriminalstatistiken: Dunkelfeld und Hellfeld
Zunächst führen Bushman und Anderson als "Beweis" für eine Zunahme der Gewaltkriminalität während des untersuchten Zeitraums zwischen 1950 und 2000 eine sogenannte Hellfeldstatistik zur Kriminalität an (vgl. S.478). Im "Hellfeld" werden all diejenigen Taten registriert, die angezeigt wurden und für die auch ein Täter ermittelt wurde (vgl. Heinz 2004, S.4f.). Diese stellt allerdings nicht die tatsächliche Entwicklung der Kriminalität dar:
a) Ein großer Fehler von Erhebungen - insbesondere zur Jugendgewalt - ergibt sich dadurch, daß viele Verbrechen von mehr als einem Täter begangen werden, so daß im Rahmen von Verhaftungen ein Verbrechen gleich mehrfach gezählt wird. Ist darüber hinaus noch der Anteil der Gruppentäter in den einzelnen Ethnien verschieden, kann z.B. der Eindruck entstehen, Ausländer seien erheblich häufiger delinquent als Inländer (vgl. McCord und Conway 2005, S.2f.). Für die Stadt Philadelphia ergibt sich für das Jahr 2005 eine Differenz um etwa den Faktor zwei, je nachdem ob Gruppendelikte statistisch entsprechend berücksichtigt wurden oder nicht (vgl. ebd., S.7).
b) Neben dem "Hellfeld" gibt es ansonsten noch ein "Dunkelfeld", das all jene Taten umfaßt, die zwar begangen, aber nicht entdeckt bzw. angezeigt wurden oder zu denen kein Täter ermittelt werden konnte (vgl. Heinz 2004, S.4f.). Das "Dunkelfeld" stellt also die tatsächliche Kriminalität dar, das "Hellfeld" insbesondere die "öffentlich wahrgenommene" Kriminalität. Aus einer Entwicklung des "Hellfelds" kann keine Aussage über die Entwicklung im Dunkelfeld abgeleitet werden. Insbesondere kann eine Steigerung der Hellfeldkriminalität sehr verschiedene Ursachen wie eine Zunahme der Kriminalität, aber auch eine Veränderung des Anzeigeverhaltens oder Veränderungen der Erfassungsmethoden haben (vgl. ebd., S.7).
Tatsächlich liefert ein Vergleich zwischen der von Bushman und Anderson angeführten "Hellfeld"-Statistik und der sogenannten "National Crime Victimization Study", einer seit 1973 jährlich durchgeführten Dunkelfelduntersuchung, deutliche Diskrepanzen. So ist zwischen 1973 und 2002 die Gewaltkriminalität im Dunkelfeld um 53% zurückgegangen, während die Hellfeld-Statistik für den gleichen Zeitraum einen Anstieg um 70% verzeichnete (vgl. S.7f.).
c) In diesem Zusammenhang ist süffisant, daß seit 1993 Egoshooter wie etwa "Doom" und seine Nachfolger populär wurden (vgl. Kunczik und Zipfel 2004, S.183). Mit dem gleichen platten Recht, wie dies die Medienkritiker tun, wenn sie eine Kausalität von Computerspielen für die Steigerung der Hellfeldkriminalität propagieren, könnte man nun auch versuchen, den Rückgang der Dunkelfeldkriminalität auf das Vorhandensein dieser Spiele zurückzuführen. Allerdings wird weder die eine noch die andere Folgerung der Materie vollauf gerecht.
d) Schließlich ist zu bemerken, daß es sich z.B. bei der polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), die häufig als Argumentationsgrundlage angeführt wird, um eine Tatverdächtigenstatistik handelt. Wenn also in einem Jahr mehr Jugendliche einer Straftat verdächtigt werden, so muß dies nicht heißen, daß tatsächlich mehr Jugendliche straffällig geworden sind, sondern kann auch heißen, daß sich vielmehr die Ermittlungsarbeit stärker auf Jugendliche konzentriert hat (vgl. ). Ein besonders eklatanter Fall, wenn sich dort Untersuchungen manifestiert hätten, wäre in diesem Zusammenhang etwa der Fall eines "Holzklotzattentats" gewesen, bei dem ein erwachsener Mann einen schweren Holzblock von einer Autobahnbrücke geworfen hatte, wodurch eine Frau tödlich verletzt wurde (vgl. ). Die Polizei hatte allerdings ihrerseits zunächst primär gegen Jugendliche ermittelt und einen Massengentest mit 1200 Jugendlichen erwogen, die in der betreffenden Ortschaft lebten (vgl. ).
2. Bushman und Anderson verweisen natürlich auf das übliche Argument, daß der Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Aggression statistisch gesehen ähnlich stark sei wie etwa der zwischen Rauchen und Lungenkrebs (vgl. Bushman und Anderson 2001, S.480f.).
a) Korrelation = Kausalität?
Nun stellten Bushman und Anderson gewalthaltige Computerspiele hier in den Kontext einer ganzen Reihe von Zusammenhängen, für die eine Kausalität einigermaßen leicht nachzuvollziehen ist. So werden an Lungenkrebs Erkrankte nicht lieber als Nicht-Erkrankte in asbestverseuchten Räumen verweilen.
Die Kausalität, die mit gewalthaltigen Computerspielen verbunden ist, ist allerdings deutlich unklarer und komplexer. Zwar können experimentelle Studien eine Auswirkung auf kurzfristige Befindlichkeiten zeigen, indem zwei Gruppen miteinander verglichen werden, deren Charakteristika sich nur durch die untersuchten Einflüsse unterscheiden. Allerdings ist damit noch immer nicht geklärt, welche Prozesse genau zu diesem Effekt geführt haben (vgl. ), und auch langfristige Wirkungen lassen sich aus kurzfristigen Wirkungen nicht ohne Weiteres ableiten (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.). Zum Teil wird schließlich in der Wahrscheinlichkeitsforschung sogar in Frage gestellt, daß sich mit Hilfe eines Zusammenhangsmaßes eine Kausalität beweisen läßt, da es sich dabei um voneinander unabhängige Perspektiven handle (vgl. Renkl 1993, S.117). In den Medien werden korrelative Aussagen allerdings gerne als "Belege" für eine Kausalität dargestellt (siehe I.2.3.1 (Kontraste)).
b) Operationalisierung von "Aggressivität"
Ansonsten ist allerdings auch die Operationalisierung für die Stärke des vermeintlichen Effektes verantwortlich. Medienkritiker zeigen zum Beispiel ein deutliches Interesse daran, die Begriffe "Aggressivität" und "Gewalttätigkeit" kaum zu definieren und praktisch synonym zu gebrauchen, so als ob zwangsläufig aus einem aggressiven Gedanken eine aggressive Handlung entstehe (vgl. Olson 2004, S.146f.). Tatsächlich aber ist der Effekt, den Studien liefern, um so geringer, je genauer sich diese an einigermaßen standardisierten Definitionen von "Aggressivität" ausrichten (vgl. GamePolitics 2007).
3. "Media Bias"
a) Im Rahmen der Metaanalyse versahen Bushman und Anderson zunächst 636 wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Zeitungsartikel, die sich mit den Auswirkungen von Mediengewalt beschäftigten, mit einem Punktwert zwischen -10 und +10, je nachdem welche Haltung in diesen dazu ausgedrückt wurde. Der Punktwert eines Artikels wurde um so größer gewählt, je deutlicher Artikel Stellung gegen Mediengewalt bezogen bzw. von einer gewaltsteigernden Wirkung von Mediengewalt ausgingen (vgl. Bushman und Anderson 2001, S.482).
Von den Artikeln hielten nur 5.7% Mediengewalt für eine Ursache von Gewalttätigkeit, und 48% rieten den Eltern nicht einmal, den Medienkonsum ihrer Kinder zu reglementieren. In der Auftragung wurde für Artikel, die 1950 erschienen waren, gerade einmal ein Punktwert knapp über 2 festgestellt. Für Artikel bis 1975 stieg der durchschnittliche Punktwert bis knapp über 5, um im Jahr 2000 einen Wert von 3.5 Punkten zu erreichen (vgl. ebd., S.483).
b) Bushman und Anderson zeichneten danach in einem zweiten Schritt die Aussagen über Korrelationen nach, die in wissenschaftlichen Studien zum Thema Gewaltwirkung getroffen wurden. Studien, die zwischen 1975 und 1995 veröffentlicht wurden, hielten eine durchschnittliche Korrelation von 0.14 fest, während Studien aus dem Jahr 2000 eine Korrelation von 0.2 aufwiesen. In experimentellen Studien tritt seit 1975 ziemlich gleichbleibend eine Korrelation von etwas unter 0.25 auf, während für nichtexperimentelle Studien, die zum Beispiel im realen Umfeld durchgeführt wurden, im Schnitt eine Korrelation von 0.1 festgestellt wurde. Für das Jahr 2000 wird allerdings eine Korrelation von 0.17 festgehalten (vgl. ebd., S.483-485).
c) Äpfel-mit-Birnen-Vergleich
Die Untersuchungen mögen für sich genommen zunächst noch einigermaßen valide sein. Bushman und Anderson behaupten nunmehr allerdings, daß die Medien im Rahmen der Berichterstattung einen deutlichen Bias zugunsten einer bestimmten Position hätten und Beiträge nicht zur Kenntnis nähmen, die nicht ihrer Grundhaltung entsprächen. Insbesondere, so behaupten sie, sei dieser "Bias" zugunsten von Medien ausgeprägt. Somit würden die Untersuchungsergebnisse der Wissenschaft falsch dargestellt (vgl. ebd., S.486).
Um dies plausibel zu machen, gehen Bushman und Anderson in einem dritten Schritt daran, die Aussagen miteinander zu vergleichen, die in den Zeitungsartikeln und den Korrelationsstudien getroffen wurden, indem sie die beiden Kurven so skalieren und aufeinander projizieren, daß für das Jahr 1975 ein Gleichstand zwischen der Interpretation der Wissenschaft und der Medien suggeriert wird (vgl. ebd., S.485; hier Bild 2.1.6.1).
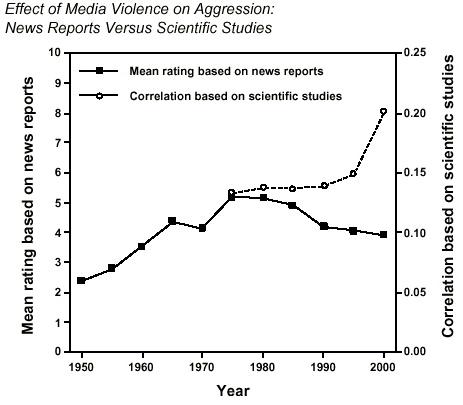
Bild
2.1.6.1. Quelle: aus Bushman+Anderson (2001)
Da der Punktwert zwischen 1975 und 2000 sank, während der Korrelationswert im selben Zeitraum stieg, suggeriert die Graphik nunmehr, daß sich seit 1975 eine deutliche Diskrepanz zwischen den Einschätzungen von Wissenschaft und der Medien entwickelt habe. Bushman und Anderson geben insbesondere sogar eine deutliche negative Korrelation von im Mittel -0.68 und -0.75 für eine "konservative Schätzung" zwischen den beiden Urteilen an (vgl. ebd., S.485f.).
Allerdings erscheint dieses Ergebnis sehr stark herbeikonstruiert:
- Bei einer anderen, etwa einer gröberen Skalierung für die Bewertung von Artikeln, wäre die Korrelation deutlich geringer ausgefallen. Entsprechend möglich ist zum Beispiel ein "Zuschneiden" der Bewertungsfunktion auf den gewünschten Zweck.
- Daneben kann man aus einem Punktwert bzw. aus einem Artikel, in dem keine statistischen Aussagen gemacht wurden, keine Korrelation konstruieren, aus einer Korrelation aber genauso wenig einen Punktwert. Diese beiden Skalen sind nicht auf der gewählten Basis miteinander vergleichbar.
Auch an einer anderen Stelle scheinen Bushman und Anderson zu konstruieren. Eine Spezialität ihrer Argumentation ist es, daß sie verschiedene Gesundheitsrisiken betrachten und die Größe der mutmaßlichen Zusammenhänge mit der Größe des mutmaßlichen Zusammenhangs zwischen Computerspielen und Gewalt vergleichen. Dabei kommen sie auch regelmäßig zu einer Aussage, daß der Effekt von Computerspielen sogar größer sei als etwa der Zusammenhang beispielsweise zwischen Passivrauchen oder Asbestverseuchung und Lungenkrebs oder zwischen der Benutzung von Kondomen und einer HIV-Infektion (vgl. Ferguson und Kilburn 2009, S.4). Es lassen sich daran aber verschiedene Kritiken äußern:
Zum einen deswegen, weil es ziemlich unbestreitbar ist, daß die Aussetzung mit Asbest die Wahrscheinlichkeit erhöht, an Lungenkrebs zu erkranken, und nicht etwa Krebskranke sich aus unerfindlichen Gründen häufiger an Orten mit hoher Asbestkonzentration aufhalten. Während der Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt zumindest kein rein kausaler ist. Indem er aber in diesen Vergleichskontext gestellt wird, wird dies suggeriert.
Ein anderer, womöglich aber wichtigerer Punkt ist, daß auch hier versucht wird, über eine ähnliche Konstruktion verschiedene Maße zueinander in Beziehung zu setzen, oder Schätzmethoden angewandt werden, die zu falschen Ergebnissen führen (vgl. Ferguson und Kilburn 2009, S.4):
- So wenden sie die Methode der sog. „binomiale Effektgröße“ an, um den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs zu berechnen. Diese Methode sei laut verschiedenen Autoren notorisch dafür, Effektgrößen als zu klein einzuschätzen. Ein Beispiel dafür findet sich auch hier: So kommen Bushman und Anderson so zu einer Schätzung von r=.4, d.h. Rauchen könne 16% der Varianz bei Lungenkrebs erklären. Laut einer Statistik der American Cancer Society erkläre das Rauchen aber 87% der Varianz, so daß sich ein r-Wert von etwa .9 ergebe.
- An Stellen, an denen Angaben über Effektgrößen fehlen, versuchen Bushman und Anderson weiterhin, aus Quotenverhältnissen (odds ratios) und relativen Risiken einen r-Wert zu berechnen, was als ungültige und fehlerhafte Methode angesehen wird.
- Als Angabe für die Effektgröße bei verwenden Bushman und Anderson einen Wert, der aus einer Metaanalyse von Paik und Comstock (1994) stammt, wo er mit r=.31 angegeben wird, und ignorieren gleichzeitig niedrigere Werte aus ihren eigenen Studien. Um ihnen beizuspringen, hatten Bushman und Anderson damit argumentiert, daß Studien gewissen Qualitätsmaßstäben genügen sollen (vgl. XXXX), und mögen ihre eigenen Studien auch an diesen gemessen und diese damit als beschädigt angesehen haben. Allerdings scheint auch das Ergebnis von Paik und Comstock verfälscht zu sein, eben auch deswegen, weil keine andere Metaanalyse eine derartige Größe erbracht hatte. Auch was das Alter der Studie angeht, bestehe die Gefahr, daß ältere Studien in die Betrachtung mit eingegangen seien, die mit möglicherweise weniger aussagekräftigen und gültigen Methoden durchgeführt wurden (vgl. Ferguson und Kilburn 2009, S.1f.).
d) Der "Bias" ist möglicherweise anders herum
Es muß wirklich die Frage gestellt werden, ob Medien überhaupt objektiv über Kriminalität berichten. Dies würde mit einschließen, daß Medienberichte über Gewalttaten der tatsächlichen Entwicklung der Gewalttaten entsprechen.
- Verschiedene Untersuchungen fanden tatsächlich, daß ein gewisser "media bias" existiert. Dieser ist allerdings nicht wie Bushman und Anderson vermuten, auf eine Verharmlosung gerichtet, sondern berichten tendentiell häufiger über Gewalttaten als dies ihr Anteil und ihre Entwicklung nahelegen. Saleth (2004) stellte fest, daß insbesondere Gewaltdelikte mit zusätzlicher Schwere und solche, die von Jugendlichen oder Heranwachsenden begangen wurden, jeweils überproportional häufig berichtet werden (vgl. S.122-128). Eine weitergehende Aufschlüsselung der Zahl an konkreten Berichten, die in der Presse berichtet wurden, nach den Jahren ihrer Begehung zeigt außerdem, daß eine Veränderung in der Häufigkeit von Berichten nicht mit der Entwicklung der Gewaltkriminalität zusammenhängt. Vielmehr können für den Zeitraum von 1975-2000 Perioden von jeweils sechs bis sieben Jahren Dauer abgegrenzt werden, in denen jeweils wellenartig die Anzahl von Berichten über Gewalttaten zu- und wieder abnimmt. So wird im ersten Jahr einer solchen Periode eine besonders niedrige Anzahl an Delikten berichtet, während im dritten Jahr einer Periode die höchste Zahl an Gewaltdelikten, und zwar mit zunehmender Nähe zur Gegenwart bis zu siebenmal soviele Delikte berichtet werden (vgl. Saleth 2004, S.179, Tabelle zu Schaubildern 32,33 und 34). Dies läßt sich damit assoziieren, daß nicht die Zahl der Gewalttaten so stark zugenommen hat als vielmehr sich die Sensibilität der Öffentlichkeit für das Thema verändert hat (vgl. etwa Pröhl 2005, S.175). Wenn 1999 (mit 14 berichteten Gewaltdelikten im Untersuchungsgebiet von Saleth im Vergleich zu 29 Delikten in 1998, 20 in 2000) als Beginn einer neuen Periode angesehen wird, so kann diese Periode bis ins Jahr 2005 oder 2006 fortgeschrieben werden. Folglich wäre ein Zeitraum wieder einmal maximierter Sensibilität tatsächlich für 2007/2008 zu erwarten.
Forderungen von Politikern nach härteren Strafen scheinen damit weitgehend zeitlich assoziiert zu sein, springen also die Politiker möglicherweise auf derartige Berichterstattungen an, die durch diese drastischen Unterschiede eine erhebliche Zunahme zumindest suggerieren. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, daß andere Experten zum gleichen Zeitpunkt der Meinung sind, daß Strafen in sehr vielen Fällen zu hoch seien und daß auch die Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts ggf. weiter in das Erwachsenenalter möglich sein sollte, da heute die Reifung häufig verzögert eintritt (vgl. Cziesche und Freiburg 2002; Kreuzer 2008). Diese Maßnahmen können also durchaus fehlgeleitet sein. Allerdings zeichneten einerseits die lobenden Berichte in der Journaille, in denen Politiker für ihr "hartes Durchgreifen" gefeiert wurden - auch - und fälschlich - aus ökonomischen Motiven heraus (vgl. "Ein Wintermärchen für Roland Koch", abgerufen am 24.06.2008) - und auch die Rückfallquote ist vielleicht um so höher, je härter Jugendliche angefaßt werden (vgl. "Härtere Jugendstrafen erhöhen die Rückfallquote", abgerufen am 24.06.2008); andererseits auch die scheinbar auf die Reglementierung folgende Abschwungphase der Gewalt - tatsächlich primär der Berichterstattung -, eine trügerische Illusion davon, daß man ja etwas getan hatte, um der vermeintlichen "Explosion" der Gewalt Herr zu werden. Ging andererseits die Gewalt tatsächlich zurück, schrieb man sich dieses umgehend selbst auf die Fahnen, obwohl Experten zum Teil sogar der Meinung sind, daß die Höhe von Strafen überhaupt keine Auswirkung auf die Kriminalität hat (vgl. Wagner 2003).
- Was die Ergebnisse von Studien angeht, so fand Ferguson im Rahmen seiner Metauntersuchung, daß auch hier ein "media bias" existiert, der zu deren deutlich überzogener Darstellung tendiert (vgl. GamePolitics 2007). So zeigen Medien sehr häufig eine Erwartungshaltung gegenüber wissenschaftlichen Studien, die nur insoweit gewürdigt werden, wie sie (vermeintlich) die schon vorhandenen Werthaltungen stützen können.
Dies sollen zwei Beispiele erläutern: Nach dem Amoklauf von Littleton hatte der damalige US-Präsident Clinton eine Studie über die Auswirkungen von Gewalt in Auftrag gegeben. Kurz vor deren Veröffentlichung erschien etwa in der auflagenstarken "Los Angeles Times" ein Artikel, in dem orakelt wurde, die Studie habe bewiesen, was man schon immer gewußt hatte, nämlich daß die Medien schädlich für die Entwicklung von Kindern seien und diese zu Gewalttätern machten. Die Studie selbst enthielt allerdings keine derartigen Aussagen, sondern fand allenfalls einen sehr geringen Effekt von Computerspielen, der von der Stärke her an zehnter Stelle nach z.B. der Erziehung, der Gewaltneigung der Eltern und der schon vorhandenen Aggressivität stand. Insbesondere korrigierte jene Zeitung ihre Aussage nicht, sondern die tatsächlichen Resultate wurden nicht einmal zur Kenntnis genommen (vgl. Gagne 2001).
Für Deutschland ist etwa das Beispiel des "Kontraste"-Berichtes zu nennen, in welchem auf Basis von Halbwissen auf die KFN-Studie rekurriert wurde, die ihrerseits zum Teil schlecht interpretierte Daten enthält, um damit zu propagieren, diese Studie habe schlüssig bewiesen, daß Computerspiele gewalttätig machten.
Die Abnahme des Punktwertes zwischen 1975 und 2000 kann also genauso auch Produkt einer Annäherung der beiden Einschätzungen aneinander sein, daß also zum einen die möglicherweise negative Haltung der Medien zu Fernsehen und Computerspielen eine Zeitlang abnahm. Allerdings war diese ebenfalls mögliche Darstellung von Seiten der Autoren auch nicht erwünscht.
e) Das "Argument der großen Zahl". Bushman und Anderson (XXXX,S.) - und im Anschluß an sie etwa Mathiak und Weber (2006, S.954) - argumentieren, daß bereits angesichts der großen Zahl von Millionen Spielern selbst ein geringer Effekt dieser Spiele auf die Gewalttätigkeit, das soziale Verhalten etc. eine Auswirkung auf die Gesellschaft haben könne. Es sollte nun aber reflektiert werden, ob diese Argumentation wirklich sinnvoll und anwendbar ist.
Denn schließlich würden Menschen überhaupt nichts tun, wenn dies keinen Effekt auf sie hätte, wie N.N. (xxxx) findet (vgl. ). Dies ist einerseits eine "Milchmädchenrechnung", mit der - selbst wenn vielleicht keine Beweise vorliegen - sofort per Intuition ein solcher Effekt "bewiesen" werden kann. Andererseits wird hiermit aufgezeigt, daß mit der großen Zahl - denn es läßt sich stets ein Mensch finden, der einen bestimmten Einfluß nicht verträgt - jeder Einfluß als problematisch oder gefährlich dargestellt werden könnte.
f) Bushman und Anderson propagieren in ihrem Artikel weiterhin, daß Medien aus falsch verstandener "Fairness" "Minderheitenmeinungen" überrepräsentierten (vgl. ebd., S.486f.). Angesichts der Fernsehberichte und Diskussionen über Gewaltdarstellung in den Medien, bei denen man es nicht schaffte, andere "Experten" aufzutreiben als jene, die ohnehin schon von vornherein gegen Computerspiele waren - es sei denn, um diese verächtlich zu machen -, ist dieses Argument allerdings nachvollziehbar.
2.1.7 Dave Grossman
Dave Grossman macht gewalthaltige Computerspiele insbesondere für im letzten Jahrzehnt aufgetretene "school shootings" verantwortlich. Er propagiert, daß mit Hilfe von gewalthaltigen Computerspielen Jugendliche letztlich das Töten trainieren würden. Dabei scheut sich Grossman nicht, auch mit kruden Vergleichen und unlogischen Argumentationen zu operieren und Verhaltensweisen auch bei einer nur geringen Ähnlichkeit auf in Computerspielen durchgespieltes Verhalten zurückzuführen. Seine Argumentationen werden gerne von Medienkritikern aufgenommen, da sie einerseits prägnant sind und andererseits die Komplexität der Fragestellung auf den einfachen Nenner des „Medienkonsums“ verengen. In der wissenschaftlichen Diskussion werden sie allerdings kaum rezipiert (Hausmanninger 2005), während Dave Grossman besonders unter Medienkritikern als eine der hauptsächlichen Quellen gebraucht wird.
1. So berichtet er von einem Amoklauf in Jonesboro, Arkansas, der einige Wochen vor dem Amoklauf von Littleton stattfand. Dabei hatten zwei Jugendliche, von denen einer große Erfahrung mit Schußwaffen gehabt hatte, der andere aber angeblich nur an Egoshootern geübt habe, auf fünfzehn Menschen geschossen und fünf davon getötet. Insbesondere befremdlich nennt Grossman die große Zielgenauigkeit, mit der auch der zweite Teenager geschossen habe (vgl. Grossman 2001, S.3). Diese Darstellung ist allerdings aus zwei Gründen nicht nachzuvollziehen:
a) Zum einen ist es denkbar unwahrscheinlich, daß zwei Jugendliche, die gemeinsam einen Amoklauf planen, sich mit unterschiedlichen Methoden und getrennt voneinander darauf vorbereiten, der eine in den Wald geht und schießen übt, während der andere allein mit einem Egoshooter übt. Viel wahrscheinlicher ist es, daß die Jugendlichen gemeinsam schießen geübt haben, und es sich bei der Aussage des zweiten Jugendlichen um eine Selbstrechtfertigung oder Schutzbehauptung handelt.
b) Zum anderen fanden Bösche und Geserich (2007) deutliche Probleme, was den Erwerb von Kenntnissen über den Schußwaffengebrauch angeht. So werden die Handhabung und physikalischen Eigenschaften der Waffe und des Projektils in Egoshootern nicht, falsch bzw. nur vereinfachend dargestellt und liefert ansonsten das Spiel fehlerhafte visuelle Informationen, so daß zum Beispiel Entfernungen nicht richtig eingeschätzt werden können. Darüber hinaus ist das Zielen mit der Maus eine zweidimensionale Aktivität, während das Zielen in der Realität eine dreidimensionale Aktivität ist. [Auch neuere Konzepte, wie die dreidimensionale Maus der neuen Nintendo-Spielkonsole "Wii", dürften dafür eher ungeeignet, etwa die Auflösung dafür erheblich zu grob sein.] Diese Faktoren können die Treffergenauigkeit negativ beeinflussen. Insbesondere aber können Egoshooter nur dann Schießfähigkeiten verbessern, wenn parallel dazu ein reguläres Schußwaffentraining durchgeführt wird (vgl. ebd., S.51f.).
2. Grossman geht weiterhin davon aus, daß wiederholte Abläufe in Computerspielen ("point and shoot") letztlich den Spieler dazu bringen würden, Verhaltensabläufe zu verinnerlichen, die in konkreten Situationen unbewußt ablaufen würden. So berichtet er von einem Jugendlichen, der einerseits viele Egoshooter gespielt, sich aber andererseits irgendwann entschlossen hatte, mit einem Kumpel einen Laden zu überfallen. Bei diesem Überfall habe er dem Verkäufer ins Gesicht geschossen, ohne dies zu wollen. Der Junge - und so auch Grossman - machen nunmehr Computerspiele dafür verantwortlich (vgl. Grossman 2001, S.6f.).
Diese Darstellung läßt sich allerdings psychologisch nicht unbedingt nachvollziehen. So stellen Bösche und Geserich (2007) fest, daß durch eine Einübung von Bewegungsabläufen insbesondere eine höhere Verarbeitungskapazität für eine bewußte Entscheidung zur Verfügung steht, und zum anderen Streß gemindert wird, der die wesentliche Quelle von Kurzschlußreaktionen wie der von Grossman dargestellten ist, im Gegenteil also eine Verselbständigung des eingeübten Verhaltens eher unwahrscheinlicher wird (vgl. S.50+53). Insbesondere entspricht das von Grossman propagierte einfache "Stimulus-Response"-Modell nicht dem Stand der wissenschaftlichen Forschung (vgl. Kellershohn 2003, S.1f.)
3. Grossman ist auch der Urheber einer von vielen Medienkritikern (vgl. Hopf 2002, S.254; jugendschutz.net 2003, S.34; ; Buckley+Anderson 2006, S.364f.; Krautz 2009, S.1) wiederholten Behauptung, die US-Armee trainiere ihre Rekruten mit Hilfe von Videospielen für das Töten, indem hier zum Beispiel systematisch die Tötungshemmung aberzogen werde (vgl. Pöhlmann 2006, S.16; Bösche und Geserich 2007, S.48f.).
Je nach der Quelle, in der man nachliest, sind Darstellungen über die tatsächliche Verwendung von Computerspielen mehr oder weniger stark mit Berichten über Projekte des Militärs verzahnt, so daß ggf. der Eindruck entsteht, es gebe diese Verbindung. . (vgl. Buckley+Anderson 2006, S.364f.) Allerdings findet sich in dieser Darstellung kein Hinweis darauf, daß das Militär mit einem ihrer Projekte versucht habe, Soldaten für den Kriegseinsatz die Tötungshemmung abzutrainieren oder sie „abzustumpfen“.
Allerdings sind Computerspiele aus verschiedenen Gründen dafür nicht anwendbar:
a) Die Simulation der Waffe und des Waffenverhaltens in Computerspielen entspricht kaum der Wirklichkeit (s.o.).
b) Der Darstellung, die notgedrungen eine simulierte dreidimensionale Umgebung auf eine zweidimensionale Fläche (das Monitorbild) umsetzt, fehlen möglicherweise entscheidende Tiefeninformationen, so etwa die in der Natur beim Betrachten realer Objekte in verschiedener Entfernung auftretende unterschiedliche Schärfe, die zur Schätzung der Entfernung von Objekten möglicherweise genauso relevant ist wie im Nahbereich, um sich in einer realen Umgebung zu orientieren (vgl. Bösche und Geserich 2007, S.54).
c) Auch können mit Hilfe eines Computerspiels taktische Fähigkeiten nur sehr inadäquat vermittelt werden. Der Spieleravatar ist in der Situation etwa in "Counterstrike" entweder voll handlungsfähig - unabhängig von seinem Gesundheitszustand - oder tot. Er ermüdet auch nicht. Entsprechend "unsoldatisch" sind die Verhaltensweisen von Spielern im simulierten Gefecht. So nehmen sie etwa Treffer in Kauf, um sich dadurch in eine bessere Position zu bringen. Im Spiel gewonnene Verhaltenslektionen sind auf reale Kampfsituationen nicht anwendbar. Andere Spiele wie "America's Army" oder "Operation Flashpoint" sind etwas realistischer, was auch Erschöpfung und das Schadensmodell angeht, aber immer noch unvollständig (vgl. ebd., S.51f.+54).
d) Nicht, daß die Armee nicht versucht hätte, mit Hilfe eines eigenproduzierten Spiels Rekruten zu generieren. So hatte die US-Armee die Produktion von „America's Army“ an der eigenen Naval Postgraduate School mit diesem Ziel betrieben. Man ging damals davon aus, daß sich die Kosten bereits dann amortisiert hätten, wenn es gelänge, dadurch drei- bis hundert Rekruten zusätzlich zu gewinnen (Schaefer 2002). Wie allerdings bekannt ist, wurden dadurch die Rekrutenzahlen tatsächlich nicht gesteigert. Möglicherweise waren den potentiellen Soldaten in diesem Zusammenhang die realen Kriege, in die die USA verstrickt waren und sind, deutlich prägnantere Eindrücke als eine Simulation des Krieges.
Auch hatte die Armee eine lange Tradition betrieben, Trainingsmethoden zu ersinnen, die die Bereitschaft von Soldaten erhöhen könne, auch auf den Gegner zu schießen. Während des zweiten Weltkrieges hatten überhaupt nur 15 bis 20 Prozent der Soldaten auf den Gegner geschossen, während des Korea-Krieges bereits 50 Prozent. Dies sei darauf zurückzuführen gewesen, daß Soldaten auf Silhouetten hätten schießen müssen, die beim Training blitzschnell aus dem Boden klappten. Nach dem Vietnamkrieg sei es kaum mehr vorgekommen, daß Soldaten nicht auf den Gegner geschossen hätten. Jedoch stammt auch diese Angabe von Grossman. Aber die „Aberziehung der Tötungshemmung“ hatte schlicht und einfach nicht funktioniert. So wäre es u.U. anzunehmen gewesen, daß die Soldaten, die diesen Trainingsmethoden unterzogen wurden, auch im allgemeinen Leben eine höhere Gewaltneigung haben oder wahrscheinlicher auf Menschen schießen würden. Dies war jedoch nicht der Fall – die Soldaten hatten eben nur auf Befehl oder um sich und Andere zu schützen, von der Waffe Gebrauch gemacht (vgl. "Brain trauma growing problem among veterans", abgerufen am 16.05.2009).
Durch Computerspiele wurde die Tötungshemmung ebenfalls nicht abgebaut. Weder in Versuchen hatte dies geklappt (vgl. "Gottseidank ein Sündenbock", abgerufen am 07.11.2007), noch gab es überhaupt eine derartige Ausbildungsmethode: Anläßlich des Amoklaufs von Winnenden am 11.03.2009 interviewte das Spielemagazin „Gamestar“ einen ehemaligen Berufsoffizier mit zwölf Jahren Erfahrung unter anderem in der Ausbildung von Rekruten. (Freilich werden die Medienkritiker dem nicht zuhören, denn schließlich interviewte ihn ja ein „per se“ korrumpiertes Medium, und spielt der Interviewpartner im Unterschied zu Dave Grossman seiner Aussage nach selbst am Computer spielt, und „Hauptmann M.“ auch nicht denselben Bekanntheitsgrad hat.) Wegen seiner aktuellen Tätigkeit mußte er aus Sicherheitsgründen anonymisiert werden. Grundsätzlich wäre es ihm damit möglich gewesen, seine Arbeitgeber anzuschwärzen und Grossmans Aussage zu bestätigen. Dies tat er aber nicht, sondern erklärte, daß er noch niemals davon gehört hatte, daß die deutsche oder die US-Armee derartige Ausbildungsmethoden einsetzen würden. Allenfalls werden in „Schießkinos“ einfache Darstellungen eingeblendet, die Schießausbildung setzt stets aber die reale Waffe voraus (vgl. "Amoklauf in Winnenden: Drill durch Ego-Shooter?", abgerufen am 27.04.2009).
Die einzige Anwendung, die Computerspiele im Rahmen der US-Armee haben, ist die Vermittlung von Informationen über die Beschaffenheit des Geländes und die Bewegung im Gelände (vgl. "'Killerspiele' - Die üblichen Verdächtigen", abgerufen am 07.11.2007). Das Töten selbst, d.h. der Umgang mit der Waffe, wird weiterhin nur in der realen Welt und mit einer realen Waffe trainiert (vgl. Pöhlmann 2006, S.16f.).
Trotzdem das „Argument“ aus dieser Sicht eigentlich widerlegt sein sollte, entwickelte es sich zum Selbstläufer insbesondere unter Medienkritikern, und wird in dieser Form auch in fast jedem Artikel, Mitteilung oder Fernsehdiskussion von den Protagonisten wiederholt (vgl. "Innenminister Joachim Herrmann: Keine Geschäfte mit Tötungstrainingssoftware", abgerufen am 01.05.2009).
Die US-Armee versucht allerdings möglicherweise eine andere Analogie zwischen realer Welt und Computerspielen herzuleiten, durch die es den Soldaten leichter gemacht werden soll, ihr Ziel zu treffen. Es erscheint zumindest plausibel, daß Infrarotdarstellungen, die als Orientierungsquellen für Beschuß eingesetzt werden, die ja nur menschenförmige Schemen darstellen, auf denen man individuelle Züge nicht erkennen kann, auch dafür sorgen können, daß Soldaten sich leichter von der Vorstellung lösen können, einen Menschen getötet zu haben. Tatsächlich äußerte ein Kampfpilot der US-Armee, daß der reale Einsatz mit einem F-117A-"Tarnkappenbomber" ihn an ein Computerspiel erinnert habe (vgl. "Momente der Geschichte", History Channel). Es soll also gerade nicht das Computerspiel der Realität angepaßt werden, sondern umgekehrt die Realität dem Computerspiel. Auch fielen in einer Untersuchung von Ladas (2002) nur Spieler als überdurchschnittlich aggressiv auf, die Spiele bevorzugten, die strukturelle Ähnlichkeiten zur heutzutage üblichen Kriegspropaganda aufweisen, während Spieler von Egoshootern, Rollenspielen etc. keine Auffälligkeiten aufwiesen (vgl. Kimm 2005, S.22).
4. Grossman behauptet ansonsten auch, daß es buchstäblich tausende Studien gebe - so propagieren Hänsel und Hänsel (2006) etwa eine Zahl von 3600, inzwischen gehört habe ich auch eine Zahl von angeblich 6000 empirischen Studien -, die einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Computerspielen und Gewalttätigkeit bewiesen, aber nur 18, die keinen solchen Zusammenhang auswiesen (vgl. S.6). Hierbei handelt es sich allerdings um die Gesamtbibliographie zum Thema (vgl. Rhodes 2001, S.). Selbst die Medienkritiker Anderson und Bushman geben die Anzahl der Artikel mit 202 (vgl. Bushman und Anderson 2001, S.484), die Anzahl der empirischen Studien mit 35 an (vgl. Anderson und Bushman 2001, S.356). Wenn nun zum Beispiel die Hälfte der Studien keinen oder nur einen nicht statistisch relevanten Zusammenhang ausweisen, ist dies ggf. durchaus bemerkenswert.
5. Grossman erfindet daneben kurzerhand eine neue Krankheit und tauft sie - in Anlehnung an das AIDS-Virus - AVIDS ("Acquired Violence Immune Deficiency Syndrome") (vgl. Grossman 2001, S.6). Diese Begrifflichkeit suggeriert gewissermaßen eine Unweigerlichkeit eines Gewaltaktes infolge des Computerspielens. So wie letztlich fast jeder HIV-Positive (nur in sehr wenigen Ausnahmefällen, wobei die Gründe dafür weitgehend unbekannt sind, bricht die Krankheit AIDS auch nach Jahrzehnten nicht aus) irgendwann an einer Krankheit stirbt, für die das HI-Virus den Weg freigeräumt hat, würde - so die Assoziation, die sich daraus ergibt -, letztlich jeder Jugendliche, der ein gewalthaltiges Computerspiel spielt, irgendwann in eine Situation kommen, in der die propagierte Aufhebung der Tötungshemmung letztlich zu einer Gewalttat führen würde. Ein solches Vorgehen ist wohl kaum als objektiv zu bezeichnen.
6. Um sein Argument plausibel zu machen, daß Computerspiele abstumpfend wirken sollen, gebraucht er bisweilen kräftige Bilder. So sei die Betrachtung von Computerspielen ähnlich zu sehen wie das Vorgehen der japanischen Besatzungsarmee in China, als man Soldaten befahl, Gefangene mit dem Samuraischwert zu massakrieren. Dieses Handeln sei ihnen mit Alkohol und der Zuweisung von „Freudenmädchen“ versüßt worden, was Grossman ganz analog zu der Punktzahl, die man in entsprechenden Spielen für das Vorgehen gegen virtuelle Figuren erhält, und der Umgebung sieht, in der man diese Spiele konsumiere. Dieses bringe bei, Gewalt mit angenehmen Gefühlen zu assoziieren, und enthemme letztlich auch (vgl. N.N. 2002, S.2).
Dieses „Argument“ zeigt jedenfalls meiner Meinung nach sehr deutlich, wie Kritikerargumente funktionieren: Jeder einigermaßen menschenrechtlich denkende Mensch wird derartige Handlungen wie die des japanischen Besatzungsregimes verurteilen. Die Argumentation setzt also an einem moralischen Konsens an. Im Verständnis dieses moralischen Konsenses ist davon auszugehen, daß ein 18jähriger, dem der Befehl gegeben wird, einen wehrlosen Gefangenen mit dem Samuraischwert zu töten, dabei große Ablehnung und Ekel empfindet, dies nur tun würde, wenn er durch Widerspruch sein eigenes Leben verlieren würde. Andererseits kann es aber auch sein, daß im historischen Kontext dieser Junge so indoktriniert war, daß er das Gegenüber gar nicht als Mensch ansehen konnte, dann wäre allerdings Grossmans Argument ggf. hinfällig, weil er ja schon einen ganz anderen Grund hatte, so zu handeln. Tatsächlich berichteten damals japanische Zeitungen sogar ohne den geringsten Abscheu über eine bizarre Wette zwischen zwei Offizieren, wer von ihnen als erster hundert Chinesen köpfen könne. Als beide sich aber getroffen und festgestellt hätten, daß sie nicht mehr feststellen konnten, wer von ihnen zuerst den hundertsten Menschen getötet hatte, hätten sie beschlossen, die Wette bis zum 150. Getöteten fortzusetzen (Lang+Hansen 1997). Es war also eine ganze Gesellschaft der nationalistischen Propaganda und dem Glauben anheim gefallen, Chinesen seien Freiwild, das ohne Gewissensbisse getötet werden könne.
Grossman nimmt schließlich von dem Spieler an, daß dieser während des Spielens eben solche Empfindungen haben müsse. Allerdings kann – dies wäre natürlich durchaus eine größere Untersuchung an vielen Personen wert, um es auf eine empirische Basis zu stellen! – ich mich nicht entsinnen, daß ich beim Spielen von Egoshootern und ähnlichen Spielen die Assoziation gehabt hätte, dort nun reale Lebewesen vor mir zu haben. Zumindest ein Zweig der Habitualisierungstheorie vertritt die Haltung, daß ein „Abstumpfungseffekt“ oder gar eine Umkehrung, die gewalttätiges Handeln in der Realität als wünschenswert darstellt, nur dann auftreten kann, wenn beim Konsum überhaupt zunächst negative Empfindungen auftreten (vgl. ). Wer sich mit der Materie nicht auseinandersetzt, für den ist allerdings die Analogie plausibel, so daß Jeder, der gegen diese Haltung argumentiert, sich selbst vor dieser Öffentlichkeit diskreditiert, indem er sich vermeintlich außerhalb der Moral stellt.
Weiter oben wurde bemerkt, daß weder die US- noch die deutsche Armee so etwas wie die von Grossman behaupteten „Tötungssimulatoren“ einsetzen. Die tatsächliche „Brutalisierung“ von Soldaten soll (zumindest in der Zeit des Vietnamkrieges) im übrigen ganz in Anlehnung an die japanische Methode mit sogenannten „Kaninchen-Lektionen“ stattgefunden haben. Der Ausbilder habe während eines Vortrags über Überlebenstechniken ein Kaninchen im Arm gehalten. Wenn aber alle das Kaninchen liebgewonnen hätten, hätte er diesem das Genick gebrochen, das Fell abzogen und es zerlegt. Die Soldaten hätten mit solchen Lektionen darauf vorbereitet werden sollen, in einer Überlebenssituation unter Umständen selbst Tiere zu töten. Demnach hätten diese Lektionen brutalisierend gewirkt und auch Kriegsverbrechen wie das Massaker von My Lai begünstigt (vgl. „Discovery Geschichte: Sir! No, sir!“ [- Über die Geschichte der Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg]). Wenn auch der Übergang zum Menschen von einem lebenden Tier deutlich näher erscheint als von einer virtuellen Figur aus, besteht allerdings immer noch ein Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen.
2.1.8 Werner Glogauer
1. Wie bereits zuvor dargestellt, ist Glogauer in der Medienkritik kein Unbekannter. Er hatte bereits 1993 anläßlich eines Mordes, den zwei Zehnjährige an einem Zweijährigen begangen hatten, aufgrund einer vagen Ähnlichkeit eines Sachverhalts mit einem bestimmten gewalthaltigen Film, der damals heftig angegriffen wurde, propagiert, dieser Film sei der Auslöser für die Tat gewesen oder habe den Tätern zumindest eine Handlungsanweisung geliefert. Meldungen, daß dieser Film es dann nicht gewesen sein konnte - z.B. Polizeiprotokolle und eine tatsächliche Durchsicht des Films(!) - waren gegenüber der laut tönenden Medienkritik fast völlig ignoriert worden (s.o.).
2. Werner Glogauer zeichnet für die deutsche Ausgabe von Grossmans Buch "Stop teaching our kids to kill" verantwortlich, worin er - gewissermaßen als Tenor - jedes Auftauchen des Wortes "violent" als "gewaltverherrlichend" übersetzt (vgl. Kellershohn 2003, S.3). Auch durch die Bezeichnung von gewalthaltigen Computerspielen als "Mordsimulationsspiele" stellt er klar, daß von seiner Seite aus eine differenzierte Auseinandersetzung nicht zu erwarten ist (vgl. ebd., S.1).
[Dies ist freiwillig nicht allein sein Problem, sondern auch viele andere Medienkritiker: So sehen Steckel und Trudewind (2002) jegliche Darstellung von Gewalt als "verherrlichend" an (vgl. S.53), und auch Gieselmann (2003) kann letztlich nicht zwischen Ernst Jüngers Kriegspropagandabuch "In Stahlgewittern" - das sinnigerweise die Darstellung der Greuel des Grabenkrieges konsequent vermeidet -, und Stephen Spielbergs Spielfilm "Der Soldat James Ryan" unterscheiden (vgl. S.39f.) - der allerdings zumindest mit einem hohen US-Patriotismus unterlegt ist -.]
Computerspiele werden von seiner Seite aus von vornherein in Bezug auf vorgegebene moralische Vorstellungen und auch als Ausdruck einer abartigen Subkultur abgewertet, mit der - normativ - ein anständiger Mensch sich nicht abgeben dürfe, wenn er nicht vor Glogauer die Stellung eines seriösen Gesprächspartners verlieren wolle (vgl. ebd., S.2-4). Ohne Kenntnis der für Außenstehende unverständlichen Symbolik betrachtet Glogauer gewalthaltige Computerspiele mit Entsetzen und einem gewissermaßen "pornographischen Blick" und unterstellt diese auch den regelmäßigen Nutzern von gewalthaltigen Computerspielen, womit er letztlich die schädliche Wirkung solcher Spiele zu motivieren sucht (vgl. ebd., S.6f.).
3.
"Through the whole piece you may observe
such a similitude of manners in high and low life, that it is
difficult to determine whether - in the fashionable vices - the
fine gentlemen imitate the gentlemen of the road, or the gentlemen
of the road the fine gentlemen."
(John Gay, "The
Beggar's Opera", 1728, III.Akt)
Für Glogauer beschränkte allerdings seine Kritik auch nicht auf gewalthaltige Computerspiele, sondern dehnte sie etwa auch auf die Zeichentrickserie "Die Simpsons" aus. Im Jahr 1993 kommentierte er die Serie damit, diese "ziel[e] auf [die] systematische Zersetzung aller positiven zwischenmenschlichen Werte" und auf deren Ersetzung durch "[d]as rücksichtslose Ausleben jeglicher Impulse und Affekte, hemmungslose Aggressivität und Destruktivität". Insbesondere stelle diese Serie also "eine radikale Entmenschlichung" dar (vgl. Kunczik 2000, S.5).
Hier ist insbesondere ein Argumentationsmuster zu erkennen, daß letztlich eine bestimmte Werthaltung in eine Darstellung hineinkonstruiert werden soll. Konkrete Inhalte werden solange bewußt falsch dargestellt bzw. sinnentstellend zusammengefügt, bis sich das gewünschte Bild ergibt.
Tatsächlich aber könnte der Grund auch ein Anderer sein. So stellen die Macher der Serie "Die Simpsons" immer wieder auch die Einfältigkeit und Bigotterie ihrer Landsleute dar. Kunczik (2000) bewertete Glogauers Kritik als "Kulturpessimismus" (vgl. ebd., S.5), während andererseits natürlich auch naheliegt, daß jemand, dessen Haltung im Rahmen einer Darstellung bloßgestellt wird, vehement gegen diese Darstellung wettern wird.
So sei beispielhaft erwähnt, daß in der Serie immer wieder auch die Medienkritik mit Spitzen gescholten wird:
(i) In verschiedenen Fällen werden Forderungen von "pressure groups" thematisiert, Gewaltdarstellungen, Pornographie und Süßigkeiten zu verbieten. Die Abschaffung hat manchmal wenigstens indirekt den propagierten Effekt - so sehen sich die Kinder die nun langweiligen Fernsehsendungen nicht mehr an und gehen stattdessen draußen spielen -, schießt aber schließlich über das Ziel hinaus - so will die "pressure group", die Mutter Marge gegründet hat, schließlich Michaelangelos "David" als ein "besonders prägnantes Beispiel von Schmutz und Herabwürdigung" aus dem Museum verbannen. Die Konsequenz kann also nicht sein, Gewaltdarstellungen etc. insgesamt aus den Medien zu verbannen, sondern sich vielmehr mit der Rolle solcher Darstellungen in der Kultur auseinanderzusetzen (vgl. "Itchy & Scratchy & Marge", abgerufen am 06.10.2007).
(ii) In der Folge "Der Clown mit der Biedermaske" (vgl. "Krusty Gets Busted", abgerufen am 25.11.2007) wird der beliebte Fernsehclown, der unreflektiert Clips der brutalisierten "Tom & Jerry"-Version "Itchy & Scratchy" vorgeführt und seinen Assistenten zu schmerzhaften Auftritten gezwungen hatte, von diesem als Verbrecher dargestellt. Dieser Assistent stellt sich selbst als "Medienkritiker" dar, der als Nachfolger des geschaßten und ins Gefängnis geworfenen Clowns dessen Show übernimmt und dann versucht, Kinder mit Kost auf einem doch sehr hohen Niveau (Vorlesestunden, Problemberatung, Lieder von Cole Porter) zu versorgen. Es ist zwar löblich, nicht nur zu unterhalten, sondern dabei auch Werte zu vermitteln oder Interesse an weitergehender Auseinandersetzung mit Themen zu fördern. Allerdings schadet man sich dadurch höchstens selbst, wenn man andere als verbrecherisch oder unmoralisch darstellt, im Grunde genommen selbst mit Mitteln arbeitet, die man den anderen zu benutzen immer unterstellt.
(iii) In der Folge "Bart schlägt eine Schlacht" sind es vor allem die Erwachsenen, die den Kindern vorleben, wie man sich Anderen gegenüber verhält: So erklärt Vater Homer seinem Sohn, und man müsse sich über jeden lustigmachen, der sich von einem selbst unterscheide, und müsse sich "männlich" verhalten, inklusive der Prügeleien. Zum Schluß hält dann der Sohn der Familie, der mit Hilfe vieler anderer gequälter Kinder dem Schulrowdy hatte heimzahlen können - wonach man die Beiden allerdings immerhin Kuchen essend im Wohnzimmer der Simpsons wiederfindet -, daß es ja auch viele gute Kriege gegeben habe (vgl. "Bart the General", abgerufen am 26.11.2007).
(iv) Auch all zu einfache Wirkungsthesen finden ihren Platz im Universum der "Simpsons". So erscheint es zum Beispiel durchaus fragwürdig, eine immer wieder vorgespielte Phrase ("yvan eht nioj" = "join the navy") reiche aus, um Jugendliche zu einer Handlung zu bewegen, zu der sie nicht schon zuvor bereit waren (vgl. "New Kids on the Blecch", abgerufen am 26.11.2007), oder ein Kind könne sich mit dem in einem Ballerspiel gesteuerten Roboter oder Hubschrauber identifizieren ("G.I. D'oh!").
(v) Die Folge "Horror frei Haus" hat schließlich einen Prolog, der auf die Verantwortung der Eltern verweist. Dort heißt es, daß Eltern, wenn sie nicht wollten, daß sich ihre Kinder derartige Inhalte ansehen, sie lieber ins Bett schicken - oder eben mit ihnen etwas Anderes machen sollten - als sich bei der Sendeanstalt zu beschweren (vgl. "Treehouse of Horror", abgerufen am 26.11.2007).
2.1.9 Helmut Lukesch
1. Helmut Lukesch argumentiert in seinem 2002 gehaltenen Vortrag "Mediengewaltforschung: Überblick und Probleme" zunächst ähnlich wie Dave Grossman, indem er einen Zusammenhang zwischen der als krebserregend betrachteten Substanz Nitrofen, für die ein Anwendungsverbot auf Basis nur zweier Studien ein völliges Anwendungsverbot erlassen wurde, und der Gewaltdarstellung in Medien herzustellen sucht (vgl. Lukesch 2002, S.1f.). Damit wird bereits klargestellt, daß der Medienkritiker die Meinungshoheit einfordert.
Er greift ansonsten Wissenschaftler, die nicht die gleiche katastrophale Bilanz für die Auswirkung von gewalthaltigen Medien ausweisen, zum einen als von der "Medienlobby" gekauft, zum anderen als ignorant gegenüber gegenteiligen Befunden an (vgl. ebd., S.1f.).
2. Daneben vertritt Lukesch auch einen pauschal-moralisierenden Kritikansatz. Aus ihm spricht die Vorstellung des "Bildungsbürgertums" und der "Altvorderen", daß Dinge wie Fernsehen, Computerspiele oder auch Aspekte der jugendlichen Lebenskultur "per se" als grenz- oder minderwertig eingeschätzt werden und auch so dargestellt werden müssen.
Einen neueren Vortrag hielt Lukesch im Jahr 2006. Darin präsentierte er zunächst Statistiken, daß heute öffentlich-rechtliche Sender mehr Gewaltdarstellungen (vgl. Lukesch 2006, S.24), weniger prosoziale Inhalte (vgl. ebd., S.31) und mehr Drogendarstellungen (vgl. ebd., S.35) zeigten als private Sender. Trotzdem präsentiert Lukesch - in Verkürzung des antiken Mottos "panem et circenses" ("Brot und Spiele") - den verqueren Slogan, "Aldi und PRO 7" trügen zu der Brutalisierung der Jugendlichen bei (vgl. ebd., S.37). Das ist in vielerlei Hinsicht problembehaftet:
a) Zum einen ist dies eine Verkürzung von "panem et circenses". So wurde mit einer großzügige Ernährung und Unterhaltung der Massen mit Gladiatorenspielen, Wagenrennen etc. primär auf die Ruhigstellung angesichts von politischen Problemen abgestellt.
b) In Bezug auf dieses Motto ist auch nicht klar, was damit eigentlich ausgesagt werden soll, insbesondere wie "Aldi" da hineinpaßt: Billigmärkte verhindern im Auftrag des Staates Hungerrevolten? Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen? Oder am Ende noch: Billigmärkte brutalisieren?
c) Schließlich darf man ja auch auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen nichts kommen lassen, da es zu einem "erwachsenen Mediennutzungsverhalten" gehört, mit stärkerem Gewicht dort zu konsumieren. Wenn allerdings nun Mediengewalt so gefährlich ist und andererseits öffentlich-rechtliche Sender mehr davon ausstrahlen, kann man eben dies gerade nicht mehr fordern, da nach der These die Jugendlichen noch mehr brutalisiert würden, sähen sie sich öffentlich-rechtliche Sender an.
d) Wenn andererseits "panem et circenses" auch die Intention einer gewissen Brutalisierung ausdrücken soll - genauer sollten die Römer an ihre "glorreiche Vergangenheit" erinnert werden - (vgl. "Rom - Stadt der Sünde", History Channel, 15.12.2007), so stellt sich hier die Frage, in wieweit ein Staat und Politiker, die gleichzeitig für deutsche Militäreinsätze sind und entsprechend ja erst Personal brauchen, das diese ausführt, andererseits leugnen kann, daß Gewalt zu seinem Wesen gehöre.
Eine Arbeitsthese, die man aufstellen kann, wäre, daß Jugendgewalt und auch sog. "school shootings" sich in Phasen häufen, in denen auch der Staat und die Politik eine Haltung zeigen, daß mit Gewalt Probleme gelöst werden können. Vertritt nun die Politik gleichzeitig eine feindliche Haltung gegen (insbesondere virtuelle) Gewaltdarstellungen, so nimmt sie damit eine widersprüchliche Haltung ein.
3. Schließlich präsentiert Lukesch in seinem Vortrag auch etwas, das er für "Piercing" hält (vgl. ebd., S.43), und bezeichnet es natürlich als "Körperverstümmelung" (ebd., S.46).
Mit seiner Beurteilung steht er unter den Medienkritikern natürlich nicht allein. So glaubt etwa Polina Hülsenbeck, daß Tätowierungen, Piercings und etwa auch das Tragen bestimmter Bekleidung autoaggressives Verhalten darstellten (vgl. Erfmann 2001, S.44). Teilweise findet sich auch immer noch die Vorstellung, daß Piercing auch nur von halbseidenem oder lichtscheuem Gesindel "in Hinterzimmern" vorgenommen werde (vgl. "Zahnschmuck und Piercing"; abgerufen am 16.11.2007). Der Kriminalbiologe Mark Benecke, der übrigens selbst tätowiert ist, interviewte sehr viele Anhänger von "Body Modifications", die auch durchaus weiter gehen können als Tätowierungen. Manche Menschen sehen es natürlich dann gewissermaß als "berufliche Pflicht" an, moralisch entrüstet zu sein oder Verbote und strenge Bestrafungen zu fordern. Der Blog-Autor "Monoma" konnte nicht umhin auszubreiten, daß als Benecke seine Ergebnisse auf einem Kongreß der deutschen Rechtsmediziner in Frankfurt präsentierte, "selbst abgebrühte Obduktionsexperten über die gezeigten Bilder bestürzt" gewesen seien. Er setzte "Body Modification" dann auch direkt mit der Existenz virtueller Welten, eben etwa Computerspielen, in Zusammenhang (vgl. "assoziation: piercing, tattoos, body modification - ein nachtrag", abgerufen am 16.11.2007). Mit anderen Worten wird also die Bewegung in virtuellen Welten als selbstschädigendes Verhalten dargestellt, dem Millionen von Menschen anheimgefallen seien.
Allerdings entspricht die Einschätzung, Gepiercte oder Tätowierte litten häufiger an psychischen Störungen, nicht den Tatsachen. Aufgrund ihrer Untersuchungen berichtet die Psychotherapeutin Aglaia Stirn im Gegenteil aber davon, daß Menschen, die zuvor körperbezogene Komplexe gehabt oder Traumata erlitten hatten, diese mit Hilfe von Piercings oder Tätowierungen verarbeiten könnten (vgl. "Tattoo-Ausstellung: Gezeichnet von Leid und Lust", abgerufen am 16.11.2007). Auch Stirn ist aber der (doch etwas zu) affirmativen Meinung, der Wunsch nach (insbesondere mehreren) Piercings "stell[e] mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine misslungene Identitätssuche dar und [könne] als Symptom für psychische Konflikte gewertet werden" (vgl. "Körperschmuck ist auf dem Weg zur Normalität", abgerufen am 16.11.2007). Papameletiou et al. (2003) verweisen auf mehrere Studien, nach denen das Vorhandensein von Tattoos und Piercings mit einer höheren Neigung zu risikobehaftetem Verhalten assoziiert sei, auch hier: Gewalttätigkeit, Drogenkonsum, sexueller Aktvität oder Selbstmordneigung. Entsprechend rieten sie Ärzten, die bei einer Untersuchung an einem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Tattoos oder Piercings bemerkten, detailliert nach entsprechenden Verhaltensweisen zu befragen (vgl. S.27f.). Allerdings dürfte es überzogen sein, von einem heute doch relativ häufigen Phänomen - so gaben bei einer genannten Befragung im Jahr 1999 27% der Marine- und Luftwaffenrekruten in den USA an, tätowiert oder gepierct zu sein (vgl. ebd., S.28) - verkürzend auf universelle Eigenschaften der Befragten zu schließen: Piercings und Tätowierungen dürften entsprechend eher in Ausnahmefällen Darstellungen psychischer Störungen sein.
Dennoch gibt es natürlich auch hier Menschen, etwa der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Theo Windhorst, die derartige Gestaltungen möglichst deutlich reglementieren, insbesondere natürlich für Jugendliche selbst bei Einwilligung ihrer Eltern verbieten wollen. Sicherlich ist seine Forderung richtig, Piercing- und Tattoostudios gründlich auf die "sittliche" Eignung und Hygiene zu überprüfen. Zum Teil wird hier ebenfalls mit Horrorszenarien gearbeitet. So etwa, daß durch das sprichwörtliche "Arschgeweih", d.h. ein tätowiertes Steißbein, die Periduralanästhesie, wie sie beim Geburtsvorgang verabreicht werden kann, kaum möglich sei (vgl. "Bis zur Körperverletzung. Piercing- und Tattooverbot für Kinder und Jugendliche", abgerufen am 24.04.2008). Allerdings ist kein Mädchen qua Geschlecht darauf "gebucht", irgendwann Kinder zu bekommen. Und schließlich ist es auch durchaus überheblich zu glauben, von einem Schreibtisch im fernen Berlin aus die Reife der Tochter oder des Sohnes besser beurteilen zu können als deren eigene Eltern, die tagtäglich mit der Erziehungsaufgabe konfrontiert sind.
Dr.Hermann Kalhoff aus Dortmund wird zitiert, daß gefalle das Tattoo irgendwann nicht mehr, "die Haut dann abgefräst werden" müsse, und entferne man das Piercing, "behalte [man] eine Narbe zurück". "Das [sei] manchmal wie ein Stigma", so der Arzt weiter (vgl. "Bis zur Körperverletzung. Piercing- und Tattooverbot für Kinder und Jugendliche", abgerufen am 24.04.2008). Allerdings können Tätowierungen - wenn auch zwar nicht schmerzfrei, so doch mit deutlich weniger Schmerzen und Narbenbildungen - heute häfig per Laserbehandlung entfernt werden, und müssen die Patienten auch genügend "Lehrgeld" bezahlen, da diese Angelegenheit nicht von der Krankenkasse übernommen wird (vgl. "Tattoo Laser Enfernung" (sic!), abgerufen am 24.04.2008). Zum anderen gehört zum Stigmatisieren auch jemand, der dem Anderen einredet, er müsse sich für etwas schämen oder sei dafür verachtenswert.
Hubert Maessen, Kommentator beim WDR, hatte schließlich kaum noch ein "Argument": Viele Träger von Piercings und Tattoos hätten einen gräßlichen Geschmack. Man dürfe nicht Volljährige das nicht tun lassen. Und nicht zuletzt, pfusche der Mensch durch Schönheitsoperationen "dem lieben Gott ohne jeden Skrupel ins Handwerk" (vgl. "Tattoo, Piercing und Plastikbusen - erst ab 18?", abgerufen am 24.04.2008). Angesichts solcher Argumentationen ist wieder nur schwer zu trennen, was wirkliche Besorgnis und was demonstrative Empörung sein soll. Sicherlich ist es aus physiologischer Sicht problematisch, bei einer 16jährigen, die sich noch im Wachstum befindet, den Busen zu vergrößern. Allerdings gibt es Fälle, in denen Jugendliche regelrecht psychisch krank sind, weil ihre Körper nicht altersadäquat entwickelt sind. Beispielhaft deshalb, weil Jugendliche Abweichungen von vermeintlichen Normen mit Hänseleien und Mobbing "bestrafen", wenn die Brüste auch mit 17 partout nicht wachsen wollen, ist letztendlich immer zu bedenken, daß es auch medizinisch notwendige oder zumindest therapeutische Operationen gibt.
2.1.10 Werner Hopf
Auch der Schulpsychologe Werner Hopf spielt mit seinen "unveröffentlichten Studien" die Rolle eines der heftigsten Medienkritiker. Seit Jahren sieht er Computerspiele als wesentliche Quelle für die Gewalttätigkeit von Jugendlichen an. Diese Einlassungen werden bereitwillig von den Medien aufgegriffen, um wieder einmal darzustellen, was man schon immer wußte, daß nämlich Computerspiele "dumm und gewalttätig" machten.
Im Mai 2008 ging wiederholt eine "bisher unveröffentlichte Studie" durch die Presse, die angeblich belegen solle, daß gewalthaltige Computerspiele - beispielsweise noch vor eigenen Gewalterfahrungen oder der eigenen Persönlichkeit - der stärkste Faktor seien, der die Gewalttätigkeit beeinflusse, und sich ein starker Konsum auch auf die Deutsch- und Englischnoten auswirke. Hopf und seine Mitarbeiter hatten, um dies zu belegen, 653 Schüler zweimal im Abstand von zwei Jahren befragt und deren Schulnoten im Alter von 13 mit denen im Alter von 14 Jahren verglichen (vgl. Schmich 2008).
Allerdings sind die Thesen, die Hopf aufstellt, auch sehr abenteuerlich. So ist er etwa der Meinung, daß die Inhalte von Spielen eine Vorbildfunktion für die Jugendlichen hätten (vgl. Schmich 2008). So sei es dann ganz klar, daß Jugendliche Vandalismus verübten oder Automaten aufbrächen (vgl. "Computer: Gewaltspiele stärkster Risikofaktor für Jugendkriminalität", abgerufen am 21.05.2008).
Den Abfall der Schulnoten erklärt Hopf sich dadurch, daß die dargestellte Gewalt eine so starke Faszination ausübe, daß Spieler kein Interesse mehr am Lernen hätten (vgl. Schmich 2008). Allerdings ist dies wieder einmal nur der Rekurs auf die "Milchmädchenrechnung", daß wer andere Aktivitäten ausübt, weniger Zeit für schulische Aktivitäten zur Verfügung hat. Ein begeisterter Fußballspieler oder eine begeisterte Eiskunstläuferin, die acht Stunden pro Tag beim Training verbrächten, hätten ähnlich wenig Zeit für das Lernen. Andere Untersuchungen zeigen daneben, daß man selbst diese Aussage nicht kategorisch treffen kann (vgl. ).
Schließlich fordert Hopf angesichts der "überall zu sehen[den]" "Verrohung, die dadurch entsteh[e]", ein Verbot von "Computer-Gewaltspielen" (vgl. Schmich 2008). Allerdings sollen Computerspiele, die erst "ab 16" oder "ab 18" freigegeben sind, ja ohnehin nicht in die Hände von 12 oder 14jährigen. Fordert man deren Verbot, so muß man konsequenterweise auch ein Totalverbot von Alkohol fordern, der ja auch nicht in die Hände von Kindern gehört, oder auch Autos verbieten, weil manche Fahrer sich dazu verleitet fühlen, zu rasen.
Als zusätzliche "Belege" hierfür wurden Craig Anderson - seinerseits ebenfalls ein bekannter Medienkritiker - und die Psychologin Ingrid Möller als Quellen angeführt (vgl. "PC-Gewaltspiele wecken kriminelle Energie", abgerufen am 20.05.2008). Von Craig Anderson und seinem Kollegen Brad Bushman, die Hopf gerne zitiert (vgl. Hopf 2004, S.113), wurde bereits festgestellt, daß dieser, um eindeutige Ergebnisse herzustellen, auch mit extremen Methoden gearbeitet hatte (s.o.). In der Arbeit von Möller findet sich ansonsten auch die Äußerung, daß es mit statistischen Methoden kaum möglich war, über den Zusammenhang zwischen der ohnehin schon gegebenen (Trait-)Aggressivität und einer positiven Bewertung von Gewalt als Handlungsstrategie hinaus überhaupt einen eigenständigen Beitrag des Konsums von gewalthaltigen Computerspielen aufzuzeigen, und in der Jugend ohnehin sowohl die Aggressivität als auch der Konsum von gewalthaltigen Computerspielen - unabhängig von hypothetisch unterstellten Wirkzusammenhängen - höher seien (vgl. Möller 2006, S.194+198). In einer anderen Untersuchung von Möller und Krahé stellte sich dar, daß das von den Forscherinnen erstellte Modell so schlecht war, daß beinahe die gesamte Varianz der Gewaltakzeptanz durch Fehler erklärt werden konnte (vgl. Schlag und Pietschmann 2007, S.12). Nicht genannt wurden außerdem Befunde, daß Personen, die eine größere Spielerfahrung haben, Gewalt i.a. kritischer gegenüberstehen (vgl. Brady und Matthews 2006, S.345, Tabelle 2) oder daß gewalthaltige Spiele keinen größeren Einfluß auf die Aggressionsneigung haben als neutrale Spiele (vgl. Narvaez und Metton 2006, S.5) (siehe II.2).
Berichte über Hopfs Einlassungen sind einmal mehr Beispiele einer Verselbständigung. Medienkritiker verstehen es, die latent vorhandenen negativen Einstellungen gegenüber dem Fremden, damit Unberechen- und für sie Unkontrollierbaren auf Computerspiele umzulenken. Konkrete Ergebnisse müssen damit gar nicht einmal mehr geliefert werden - so hatte selbst Christian Pfeiffers Institut KFN das so vielgescholtene "Counterstrike" als nicht besonders gewalttätig eingestuft und war mit der bisherigen Einstufung "ab 16" zufrieden gewesen -, trotzdem wurden diese Impulse von der Berichterstattung dankbar aufgenommen. Die Pressemitteilung zur Veröffentlichung der entsprechenden Ausgabe von "Geo Wissen" wurde sogar noch in Lateinamerika von der Journaille weitgehend wortgleich wiederholt (vgl. "Videojuegos violentos motivan la criminalidad", abgerufen am 23.05.2008).
Bezeichnend ist auch das Timing, denn der Bericht erschien eine Woche vor Veröffentlichung der nächsten polizeilichen Kriminalstatistik. Sollte diese nunmehr die Jugendkriminalität problematisieren, so bot Hopf damit die beliebten einfachen, eingängigen und schon "traditionellen" Erklärungsmuster an.
Artikel werden denn auch bereitwillig mit den schon bekannten Kommentaren versehen: Gerne wird noch heute kolportiert, daß die Amokläufer von Erfurt und Emsdetten Fans des Spiels "Counterstrike" gewesen sein sollen (vgl. "Risikofaktor Computer: PC-Spiele fördern Jugendgewalt", abgerufen am 23.05.2008). Obwohl Steinhäuser (Erfurt) das Spiel nicht spielen konnte, weil er keinen Internetzugang hatte, und Bosse (Emsdetten) selbst angegeben hatte, daß er über keine genügend leistungsfähige Graphikkarte verfügte, um die Spiele zu spielen, die ihm angelastet wurden. Zwar wird dargestellt, daß nach Expertenmeinungen Computerspiele nicht für Amokläufe verantwortlich gemacht werden können und ein Verbot der falsche Weg sei. Dennoch wird gefordert, solche Spiele müßten verboten werden. Zwar ist eine Abstumpfung nicht bewiesen, aber mit seinem "gesunden" Menschenverstand wußte man ja ohnehin schon immer, daß durch eine Darstellung von Gewalt "der Spieler in punkto Mitleid natürlich [abstumpfe]". Auf LAN-Partys gehe es "völlig anonym und gerazu autistisch zur Sache. Nur wenige Teilnehmer [nähmen] ihren Blick jemals vom PC-Bildeschirm (sic!)". Und auch das genannte Spiel wird angeführt, "wie brutal es dort zur Sache" gehe - wobei wieder einmal auch der Screenshot aus der blutigen "ab 18"-US-Version nicht ausgespart bleibt. Nicht genannt wird zum Beispiel, daß die deutsche Version keine Blutspritzer enthält oder daß selbst die meisten Spieler dieser Version solche Darstellungen ohnehin als störend empfinden und abschalten. Schließlich wird der Begriff des "Killerspiels" oder "Gewaltspiels" dann auch wieder auf Strategiespiele ausgedehnt (vgl. "PC-Gewaltspiele wecken kriminelle Energie", abgerufen am 20.05.2008). Wenn nun ansonsten das veröffentlichende Magazin "GEO Wissen" damit titelte, Computerspieler manövrierten sich "in die Gewaltfalle" (vgl. "GEO Wissen" Ausgabe 41 vom 14.05.2008), so findet sich auch wieder das schon bekannte "AVIDS"-"Argument". Damit wurde einmal mehr eine Zwangsläufigkeit und Unumkehrbarkeit der "Brutalisierung durch Computerspiele" impliziert.
Auch die Gegenargumente von Computerspielern werden gerne verdreht und zu Strohmännern umformuliert. Wenn Computerspieler angeblich davon sprächen, "nicht jeder werde zwangsläufig kriminell" (vgl. Schmich 2008) bzw. Spiele "nicht allein für Amokläufe verantwortlich" seien (vgl. "PC-Gewaltspiele wecken kriminelle Energie", abgerufen am 20.05.2008), so konnte die "Widerlegung" freilich nur sein, Studien zu finden, die aufzeigten, daß Computerspieler zwangsläufig und allesamt aggressiv, gewalttätig und dumm würden (vgl. noch einmal den "GEO"-Titel).
Auch wird gerne falsch dargestellt, was genau da untersucht wurde. Schon der "Kontraste"-Bericht, mit dem die "Lawine" des Jahres 2007 losgetreten wurde, hatte suggeriert, die KFN-Schülerbefragung aus dem Jahr 2005, auf die sich Christian Pfeiffer beständig beruft, "belege" die Wirkung von Medien (vgl. ) -- so als handle es sich um eine Untersuchung zur Medienwirkung. Christian Pfeiffer wurde selbst als "Computerspielexperte" oder als "Medienwirkungsforscher" vorgestellt. Tatsächlich hat Christian Pfeiffer von Computerspielen seiner eigenen Aussage nach keine Ahnung (vgl. ) und war die Schülerbefragung nichts weiter als eine querschnittliche Befragung gewesen, bei der neben etlichen anderen Faktoren gerade einmal auch der Medienkonsum erfragt wurde (vgl. ). Auch von Hopfs Studie wurde behauptet, die "Forscher [hätten] zwei Jahre lang den Spielern über die Schulter geschaut" (vgl. Schmich 2008). Dies war allerdings ebenfalls nicht passiert, sondern man hatte auch dort nichts weiter als eine Untersuchung mit statistischen Methoden durchgeführt (vgl. ). Weitergehende Untersuchungen über Denkweisen von Spielern etc. fanden nicht statt, da man ja schon wußte, was man beweisen wollte.
Die Wissenschaftler können freilich weiterhin anführen, sie hätten lege artes gearbeitet, indem sie etwa bemerken, daß aus einer Korrelation selbstverständlich keine Kausalität folge (vgl. Pfeiffer XXXX, S.). Da ihnen aber das Ergebnis ganz recht zu sein scheint, haben sie auch nichts dagegen, wenn in den Medienberichten zum Thema dann ausgeführt wird, sie hätten "Studien mit eindeutigem Ergebnis" geliefert (vgl. "Computer: Gewaltspiele stärkster Risikofaktor für Jugendkriminalität", abgerufen am 21.05.2008). Andererseits gebrauchen sie aber auch gerne Begriffe, die eine Kausalität gedanklich schon implizieren. So meint Hopf, der Konsum gewalthaltiger Medien "erklärt" 20 Prozent der Varianz bei der Delinquenz von Jugendlichen (vgl. Hopf 2004, S.106). Wieder einmal machen also "Killerspiele [...] aggressiv, brutal und dumm" (vgl. Schmich 2008) und sind damit für alle Probleme der modernen Gesellschaft und/oder Kindererziehung verantwortlich.
Wie weit es dabei wirklich um die Sorge um die Kinder bestellt ist, macht Hopf im Interview auch klar: Dort wird Hopf kolportiert, daß es "pure Illusion und eine Lüge" sei, Schülern und Eltern Medienkompetenz zu vermitteln (vgl. Schmich 2008). Hopf scheint nun ein Verbot von Computerspielen als Mittel dafür zu sehen, um sich wieder in Sicherheit wiegen und sich auch weiterhin nicht um seine Kinder kümmern zu müssen (vgl. "Korrelationen, Beweise, Ursachen - alles derselbe Kram", abgerufen am 22.05.2008).
Wenn wir nun auch auf den Gedanken eingehen, daß durch die Abschaffung von Computerspielen die Gewalttätigkeit nicht verringert würde, weil sie keine Ursache ist, wie der Psychologe Wolfgang Bergmann geäußert hatte (vgl. ), so könnte man schließlich räsonieren, daß es auch gar nicht darum geht, die vermeintlich gesellschaftsbedrohende Gewalttätigkeit der Jugend abzubauen. Sondern sie ist schlichtweg notwendig, um eine Abgrenzung gegenüber der Jugend zu definieren. Da neue Medien zuerst vor allem von den jungen Menschen aufgegriffen werden, wird die Medienkritik letztlich die Verlängerung des traditionellen Generationenkonfliktes.
2.1.10.1 Das Konzept von der "sozialwirksamen Schule"
2.1.10.2 "Mediengewalt, Lebenswelt und Persönlichkeit - eine Problemgruppenanalyse bei Jugendlichen" (2004)
Übrigens enthielt der Artikel von Jochen Paulus, den Gruner+Jahr mit der Pressemitteilung beworben hatte, ganze zwei Sätze über die angeblich bahnbrechende und zweifelsfreie Untersuchung von Hopf (vgl. Paulus 2008, S.71). Der neueste zum Zeitpunkt des Schreibens verfügbare inhaltlich relevante Artikel, der direkt von Hopf stammt, wurde im Jahr 2004 veröffentlicht und befaßt sich mit einer Längsschnittstudie, die er in Zusammenarbeit mit den Tübinger Forschern Rudolf Weiß und Günther L. Huber um die Jahreswende 1999/2000 durchgeführt hatte - zumindest Weiß ist als Medienkritiker mit teilweise abstrusen Thesen bekannt (siehe I.2.1.10). Dabei wurden 1016 10 bis 18 Jahre alte Hauptschüler über verschiedene Problemaspekte wie ihre Mediennutzung, den von den Eltern gepflegten Erziehungsstil - und sinnigerweise auch deren Mediennutzung -, und ihre Cliquen befragt und schließlich auch mit Hilfe von Fragebögen die Neigung zu aggressivem Verhalten und dessen letztliche Ausübung erhoben (vgl. Hopf 2004, S.102-104).
2.1.10.2.1 Vergangene Studien
Bereits die Darstellung anderer Studien in der Einleitung verweist auf echte fragliche Aspekte: Bandura folgerte zum Beispiel, als Kleinkinder von vorgeführtes Handeln nachahmten, indem sie zunächst auf Plastikpuppen, später auch auf verkleidete Menschen einprügelten, daß dargestellte Gewalt zum Imitieren anreize oder sogar eine automatische Imitation hervorrufe (). Allerdings werden die Experimente von Bandura vielfältig kritisiert:
Zunächst handelt es sich dabei um einen monokausalen und mechanistischen Ansatz, der die Problematik stark einschränkt. Eventuell wurde sogar der falsche Fokus gewählt, da man hier eher den "Modellerneffekt" untersuchte als die Medienwirkung. Die Kleinkinder, die als Versuchspersonen dienten, mögen in der künstlich hergestellten Laborsituation Unsicherheit darüber empfunden haben, wie sie sich überhaupt verhalten sollen, und dementsprechend eine Handreichung dazu im Erwachsenenverhalten, d.h. insbesondere im Verhalten des Vorführers, der auf die Plastikpuppe einschlug, gesucht haben. Dies wurde dadurch begünstigt, daß im Labor die im Film vorgeführten Objekte real vorhanden waren. Weiterhin kann man durchaus den Eindruck haben, es sei damals erwartet worden, daß die Kinder so handeln. Tatsächlich nimmt der "Nachahmungseffekt" ab, je weniger wohlwollend die Beobachter/Versuchsleiter auf die "Gewaltausübung" reagieren (vgl. Kimm 2005, S.113f.). Die Anwesenheit von Plastikpuppen oder verkleideten Menschen mag im typischen Verständnis von Kindern weiterhin eine Spielsituation verstärkt charakterisieren. Auch konnte das Ergebnis mit Kindern höherer Altersstufen nicht repliziert werden (vgl. Kimm 2005, S.114). Schließlich verletzt auch die propagierte "Imitation von Gewalt" der Definition von Aggression, die Hopf wenig später (vgl. Hopf 2004, S.99f.) selbst verwendet, nämlich die der "unmittelbare[n] Absicht zu verletzen", also der bewußten Schädigung.
Zum anderen stellt Hopf keine Entwicklung dar, was etwa die Gewaltkriminalität unter den untersuchten Hauptschülern angeht. Betrachtet man Untersuchungen, die zeitlich durchaus mit der Untersuchung von Hopf übereinstimmen, so stellt man fest, daß zwischen 1993 und 2003 diese um circa ein Drittel abgenommen hatte (vgl. Heinz 2008, S.14, aus der Graphik abgelesen). Noch einmal bemerkt, wurden gerade in diesem Zeitraum die besonders gescholtenen Ego-Shooter und Spielekonsolen erst weitreichend verfügbar. Auch die selbstberichtete Delinquenz nahm zwischen zwei Untersuchungen in Duisburg in den Jahren 2002 und 2004 bzw. Greiswald 1998 und 2002 deutlich ab (vgl. ebd., S.15f., aus der Graphik abgelesen).
2.1.10.2.2 Pfadanalyse
Hopf wiederholt zumindest seit dem Jahr 2000 beständig die These, daß der Einfluß der Medien, so etwa von "Horror-Gewalt-Filme[n]" und "Video-Gewaltspielen" (vgl. ebd., S.106) eine der wesentlichen Ursachen, wenn nicht die zentrale Bedingung der Gewalttätigkeit von Jugendlichen sei (vgl. Hopf 2004, S.112; Rosch 2006, S.45). Er versucht dies mit einer Pfadanalyse zu belegen:
Liest man den Beitrag aus dem Jahre 2004, so findet man, daß Hopf dort ein Modell entwirft, das den eigenen Medienkonsum der Jugendlichen bzw. den Medienkonsum der Eltern als Ursache für alle Probleme darstellt, die im Umgang mit Jugendlichen ggf. relevant sein können. Indem er nun also die Gewalttätigkeit von Jugendlichen auf deren eigene Handlungen, insbesondere das Medienverhalten, zurückführt, schiebt er damit die gesellschaftliche Verantwortung wieder auf den Einzelnen ab. Solche Studien passen natürlich denen gut in den Kram, die z.B. das permanente Vermitteln von Benachteiligungen und Minderwertigkeitsgefühlen wie z.B. im dreigliedrigen Schulsystem, das Schüler "begabungsgerecht" (primär wird diese "Begabung" nach der sozialen Schicht bestimmt, aus der die Schüler stammen) selektiert, immer noch als "Gewinnermodelle" angesehen werden. Entsprechend werden gesellschaftliche Ursachen von Gewalt nicht diskutiert oder reflektiert. Im folgenden soll kurz diskutiert werden, in wieweit Pfadanalysen Aussagen über kausale Zusammenhänge liefern können.
2.1.10.2.3 Theoretische Grundlagen der Pfadanalyse
Die Pfadanalyse stellt eine Erweiterung der multiplen Korrelations- und Regressionsanalyse dar, mit der versucht wird, Aussagen über Zusammenhänge zwischen Variablen zu liefern, wobei die unabhängigen Variablen auch untereinander korreliert sein können. Im Rahmen der Pfadanalyse wird versucht, Theorien über Ursache-Wirkung-Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen zu bestätigen bzw. solche Aussagen überhaupt erst herzuleiten (vgl. Vorauer-Mischer 2004).
Bei aller Reklamation, daß hier "Kreisprozesse" (Hopf 2004, S.100+112f.) oder "Wechselwirkungen" dargestellt würden, d.h. daß die Umwelt auch wieder auf das Verhalten zurückwirke, werden hier eigentlich nur Modelle verwendet, die "kognitive Medieneffekte wie Überzeugungen [...], Einstellungen und Verhaltenspläne [...] auf Beobachtungslernen zurückführ[en]", die also den Konsum letztlich allein als Ursache, nicht aber als mögliche Wirkung oder als Indikator bzw. Scheinkorrelat ansehen (Wenn Hopf z.B. bemerkt, daß bei einer Gegenrechnung der Medienkonsum nicht durch die Aggressivität erklärt werden konnte, vgl. S.108, kann das z.B. heißen, daß die beiden Größen eine gemeinsame Ursache haben, die Korrelation aber nur scheinbar, nämlich über diese Ursache, besteht). Das ist nach der Darstellung beim "Informationsverarbeitungsmodell" von Huesmann der Fall, aber auch beim "General Aggression Model" (GAM) nach Anderson und Bushman und beim "Modell von Kleiter".
(1) Das GAM modelliert "Kreisprozesse" bereits nur noch auf der Ebene, daß Handlungen bei sozialen Begegnungen durch Eigenschaften der Person und Situation bestimmt werden und der Ablauf dieser sozialen Begegnungen dann wieder darauf wechselwirke. Für den Konsum von Gewaltdarstellungen wird nur noch modelliert, daß dieser über verschiedene Pfade (Hopfs Begriffsbildungen nach Beobachtungslernen und "Einüben" von Handlungsskripten in der Phantasie, Lernen von negativen Überzeugungen, Abstumpfung, Lernen von Rechtfertigungsmustern, "Sensitivierungs- und Bahnungsprozesse (cueing and priming)", schließlich Erregung und Erregungstransfer), kausalen Einfluß nehme. Die drei Effekte dieser Prozesse seien Aggression, Desensibilisierung und Angst vernden mit einer verzerrten Weltsicht (vgl. ebd., S.100).
(2) Kleiters "Modell der moderierten und hierarchisch intervenierten Aufschaukelung" ist ein komplexes Modell, mit denen auf verschiedenen Ebenen die Entwicklung von Gewalt im Kontext von gewalthaltigen Medien erklärt werden soll. Dieses Modell besteht aus drei Elementen (vgl. Kimm 2005, S.122-124):
- Der "Kernpfad" besteht aus den drei Faktoren "Konsum medialer Gewalt", "Aggressionsneigung"/"Trait-Aggressivität" und "Aggressives Verhalten". Dieses Teilmodell geht insbesondere auf die Lerntheorie von Bandura und die Stimulationsthese zurück. Es wird allerdings als "teilreziprok" bezeichnet, als Kleiter zwar die genannte Wirkungsrichtung als primär ansieht, aber annimmt, daß gewalthaltige Medien für schon aggressive Menschen besonders attraktiv sind.
- Intervenierende Variablen beeinflussen den Verlauf und die Intensität der jeweils betrachteten Wirkung, können dementsprechend z.B. die Entwicklung gewaltnaher Einstellungen begünstigen oder hemmen. Kleiter unterscheidet ihr verschiedene Kategorien von Größen, die an den einzelnen Stufen von Entwicklungsprozessen, den Grundlagen des Prozesses oder auf die Wirkungen anderer Variablen wirken. Darunter fallen Größen wie ein ungünstiges Wohnumfeld ohne Entfaltungsmöglichkeiten; fehlende prosoziale Vorbilder; das "Sensation Seeking" einer Person; das von ihr vertretene Rollen-/Männlichkeitsbild; in wieweit die Person für aggressives Verhalten belohnt wird; und die Form der Problembewältigung, die eine Person wählt.
- Als dritte Kategorie werden die "moderierenden Größen" genannt, die einerseits Grundfaktoren darstellen und andererseits Entwicklungen hemmen oder fördern können. Dies sind Geschlecht, Alter und Bildungsstand einer Person.
Kleiter geht nun von einem "Aufschaukelungsprozeß" aus, d.h. dieser Prozeß läuft nicht gradlinig ab, sondern die verschiedenen Faktoren beeinflussen sich gegenseitig (vgl. ebd., S.122). Kleiter erweitert dieses Modell noch einmal zum sog. MISKA ("Modell der moderiert-intervenierten und sozial-kognitiv gesteuerten Aggression"). Dessen Kern bildet das oben genannte Modell, das um zusätzliche intervenierende Variablen des Medieneinflusses erweitert wird. Dies sind die Handlungsnotwendigkeit, d.h. das Ausmaß, in dem sich die Person dazu gezwungen sieht, eine Handlung durchzuführen; die Kontrollüberzeugung, d.h. als wie groß die Person ihren eigenen Einfluß ansieht; und die direkte Belohnung, d.h. in wieweit die Handlungsweise honoriert wird (vgl. ebd., S.124).
Nun liegt dieses Modell von der Komplexität her an der oberen Grenze des Möglichen und stellt eben kein einfaches Ursache-Wirkungs-Modell dar. Allerdings führt gerade diese Komplexität auch dazu, daß auf seiner Basis kaum Ansatzpunkte aufgeschlüsselt werden können, an denen z.B. die Gewaltprävention ansetzen könnte (vgl. ebd., S.124). Hopf vereinfacht die Betrachtung nun aber auf die drei Aspekte des Kernpfades, der von ihm im Sinne einer einseitigen Kausalbeziehung interpretiert wird. So folge nach dem Konsum von Fernsehgewalt zunächst die Aggressivität, d.h. die Neigung zu aggressivem Verhalten, und dann erst daraus das aggressive Verhalten. Dagegen gebe es kaum einen direkten Einfluß vom Konsum zum aggressiven Verhalten (vgl. ebd., S.101).
Es ist zu beachten, daß im Rahmen der Pfadanalyse häufig von Modellen ausgegangen wird, die man selbst aufgestellt oder aus Theorien abgeleitet hat. In der Praxis würde man am Ende das Modell präsentieren, das hier am ehesten mit den erhobenen Daten in Einklang zu bringen ist (vgl. Langer 2002, S.5; Martin 2007, S.27f.). Es findet also eine "Modellauswahl" statt. Argumentiert man nun auf der Grundlage dieser Modelle, so kann man weiterhin andere Einflüsse natürlich auch nur schwer einbeziehen.
(3) Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß mit einem Pfadmodell zwar gerichtete Beziehungen überprüft werden können, dies allerdings nichts mit der Kausalität (Schermelleh-Engel 2004, S.4) zu tun haben muß. Der Pfadkoeffizient setzt sich aus verschiedenen Größen zusammen, nämlich sogenannten kausalen und nicht-kausalen Effekten (siehe Glossar). Nicht-kausale Größen können ggf. einen Großteil des Pfadeffektes und damit ggf. auch des Korrelationswertes ausmachen (vgl. Zwick 2002, S.81).
(4) Ein Pfadmodell muß auch auf seine Plausibilität hin überprüft werden. So gibt es bestimmte Modellbeziehungen, die aus theoretischen oder logischen Gründen nicht zu halten sind (vgl. Zwick 2002, S.35f.). Dieses Problem wird uns im Zuge der 2008 veröffentlichten Studie von Hopf, Huber und Weiß noch einmal begegnen.
2.1.10.2.4 Daten und Interpretationen
[...] Hier seien einige relevante Beispiele genannt.
(1) So stellte Hopf zunächst eine hohe Interkorrelation zwischen dem Spielen von "PC-Actionspielen" und der Nutzung des Internet (r=0.43) fest. Diese wurde von ihm gleich dahingehend interpretiert, daß die befragten Computerspieler auch einen höheren Gewaltkonsum im Internet pflegten (vgl. ebd., S.104). Aus dieser Ausdeutung mag nun tatsächlich wieder eine konservative politische Grundhaltung sprechen. In konservativer Auffassung ist das Internet natürlich kein sinnvolles Medium, da davon ausgegangen wird, daß es zu großen Teilen aus Pornographie, Gewalt und extremistischer Propaganda bestehe, und entsprechend reglementiert werden müsse. Der Anteil solcher Inhalte ist allerdings tatsächlich sehr gering, und durch mehr Zeit, die im Internet verbracht wird, steigt auch nicht automatisch der Konsum solcher Inhalte (siehe ).
(2) Mediennutzung als Ursache, Moderator und Scheinkorrelat
Im Kontext der Untersuchung wollte Hopf sich natürlich nicht sagen lassen, er habe nicht die Möglichkeit außer Betracht gelassen, daß auch die Aggressivität umgekehrt auf den Medienkonsum wirken könnte. Seiner Pfadanalyse nach soll dies allerdings nicht der Fall sein (vgl. ebd., S.108). Nun ist dadurch allerdings nicht auszuschließen, daß der Konsum von Mediengewalt ein Indikator bzw. ein Scheinkorrelat ist, d.h. daß der Medienkonsum und das Gewaltverhalten eine gemeinsame Ursache haben.
Diese These stützt meines Erachtens ein Vergleich über die Motive, mit denen nicht-delinquente und delinquente Jugendliche Computerspiele nutzen. Hopf kann diese Motive nicht betrachten, da er alle Motive der Mediennutzung, sei es nun Langeweile, Versuche zum Streßabbau oder zur Verdrängung von Problemen etc., als "Lust, virtuell zu töten" sieht (vgl. Hopf 2004, S.108). Im Anschluß an Untersuchungen über die Motive der Mediennutzung auf der einen und wichtiger Persönlichkeitsmerkmale von delinquenten Jugendlichen auf der anderen Seite soll hier in eine andere Richtung differenziert werden.
(2.a) Das wichtigste Nutzungsmotiv von Medien, wenn auch bei Vielspielern nicht ganz so ausgeprägt, ist weiterhin die Langeweile bzw. der Zeitvertreib (vgl. Gehlen 2003, S.83; Pöhlmann 2006, S.40). Ein anderes Nutzungsmotiv, das aber eine im Verhältnis geringere Bedeutung hat, ist das Fluchtmotiv. Spiele werden dort genutzt, um Probleme im Alltag zu verdrängen. Dieses ist besonders ausgeprägt bei Personen, die unter Mißerfolgsängsten oder dem Gefühl leiden, ihr eigenes Leben nicht beherrschen zu können (vgl. Fritz 2003, S.24; zit. nach Nagy 2006, S.40). Besonders attraktiv für dieses Nutzungsmotiv sind natürlich Spiele, die Welten bieten, in der man sich nicht mehr mit den Problemen des realen Lebens auseinandersetzen muß oder soll (vgl. Fritz 1999, S.86; zit. nach Nagy 2006, S.41). Zum "Abreagieren" werden Spiele schließlich nur "manchmal" genutzt (vgl. Gehlen 2002, S.83).
(2.b) Die Frage des Problemlösungsverhaltens ist auch eine Analyseebene bei der Betrachtung von Gewalttätern (Chambers 2006, S.24f.). Rickers (2006) hält in ihrer Untersuchung die vorwiegende Problembewältigungsstrategie für jugendtypische Probleme als Einflußgröße für die Delinquenz von Jugendlichen fest (r=0.28, vgl. S.232). Delinquente Jugendliche versuchen eher, die Beschäftigung mit einem gegebenen Problem zu vermeiden, ggf. wird auch das delinquente Verhalten von ihnen als Versuch einer Problemlösung angesehen oder dargestellt (vgl. S.177-179).
Faßt man nun zusammen, daß sich die Problemlösungsstrategie eines Jugendlichen einerseits auf die Auswahl seiner bevorzugten Computerspiele (2.a) und zum anderen auch auf das Verhalten auswirkt (2.b), so kann zumindest ein gewisser Anteil an der Gesamtkorrelation, den die gemeinsame Ursache "Problemlösungsstrategie" bewirkt, nicht ausgeschlossen werden. Seinerseits ist nach Rickers (2006) das Problemlösungsverhalten natürlich selbst ein Mediator für das delinquente Verhalten von Jugendlichen, während Ursachen u.a. in der Erziehung und sozialen Umgebung - z.B. Konflikte und Gewalterfahrungen -, und in der eigenen Neigung zu Verhaltensproblemen liegen (vgl. S.229).
. Medien mögen ggf. natürlich auch Stereotypen vermitteln, denen Jugendliche zu entsprechen versuchen. Dies kann Delinquenz nach sich ziehen, indem Jugendliche, die sich in den Geldmitteln, die für sie selbst verfügbar sind, materiell benachteiligt fühlen, dann versuchen, sich diese Prestigeobjekte bzw. das zur Beschaffung notwendige Geld ggf. illegal zu beschaffen. Das Risiko hierfür ist allerdings um so größer, je größer das Einkommensgefälle innerhalb einer Gruppe, z.B. einer Schulklasse, ist (vgl. Rickers 2006, S.64f.).
2.1.10.3 "Media Violence and Youth Violence - a Two-Year Longitudinal Study" (2008)
Die bis zum Zeitpunkt des Schreibens (20.09.2008) umfangreichste frei zugängliche Version der oben bereits eingeführten zweijährigen Längsschnittstudie (Hopf et al. 2008) findet sich in zwei Folienvorträgen seines Coautoren Günter L. Huber (Huber 2007 und 2008).
2.1.10.3.1 Einige neue - und alte - Argumentationen aus den Vorträgen
Hubers Vortrag beginnt mit einer Ausführung darüber, daß international in einzelnen Fällen durchaus die Meinung bestehe, Jugendliche könnten sich Computerspiele durchaus in ihrer Geisteshaltung beeinflußt werden. So habe die iranische Regierung ein Computerspiel mit dem Namen "Special Operations 85" lanciert, das - ähnlich wie "America's Army" - möglichst weit verteilt werden solle. Als Begründung wurde angeführt, daß das populäre Spiel besonders geeignet sei, "ideologische Werte wie Opferbereitschaft und Märtyrertum zu vermitteln" (vgl. Huber 2007, S.6-8). Nur kann man aus der politischen Haltung im Iran, die hier dargestellt wird, eben nicht folgern, daß sich ein solcher Effekt dann bei den Spielern tatsächlich abzeichnet. Tatsächlich ist im Iran gar nicht einmal klar, inwieweit die Jugend überhaupt bereit wäre, sich noch einmal zu Märtyrern für die "islamische Revolution" machen zu lassen (vgl. ).
Huber kann sich natürlich weiterhin auch nicht ersparen zu berichten, das US-Militär trainiere ja auch mit gewalthaltigen Spielen (vgl. ebd., S.8). Freilich hier ausgefeilter, so wird hier nicht mehr behauptet, damit sollen die Rekruten desensibilisiert oder aggressiver gemacht werden.
In seinem Vortrag formuliert Huber die Aussage, daß aktuelle Untersuchungen eine kausale Beziehung zwischen dem Konsum gewalthaltiger Spiele und "aggressiven Erregungsmustern im Gehirn" belegen könnten. Dazu zitiert er aus einer Studie von Weber et al. (2006), daß virtuelle Gewalt im Gehirn die gleichen Aktivitätsmuster hervorrufe wie bei aggressiven Gedanken oder einer Neigung zu gewalttätigem Handeln auftrete (vgl. Huber 2007, S.13). Dabei ergeben sich allerdings wiederum Probleme: Zum einen bestehen noch immer Schwierigkeiten dabei, Gehirnaktivität zu interpretieren. So wurde bereits angeführt, daß z.B. Verliebte ähnliche Aktivitätsmuster in ihren Gehirnen zeigen wie die vermeintlich abgestumpften Computerspieler (vgl. ). Die Autoren halten in einem anderen Artikel selbst fest, daß ein einfaches Ursache-Wirkung-Modell nicht angewandt werden kann (vgl. Mathiak und Weber 2006, S.953).
Schließlich wird gerade diese Studie auch sehr unterschiedlich interpretiert. So sieht z.B. Murray (2008) die Ergebnisse dieser und anderer vergleichbarer Studien als Beweise dafür, daß gewalthaltige Medien ihre Konsumenten abstumpfen, zur Imitation "verleiten", oder psychische Traumata auslösen (vgl. Murray 2008). Von anderen Autoren wird allerdings diese gerade wieder kritisiert, daß die Studie keinen nennenswerten Erkenntnisgewinn liefere, sondern letztlich den "Hausverstand" bestätige, daß in einer Spielsituation auch Gedanken geformt werden, die dieser Situation entsprechen (vgl. "Study says gaming causes aggression", abgerufen am 20.09.2008). Die Autoren der Studie selbst beurteilen ihre Ergebnisse wieder ganz anders: Mathiak selbst bemerkt, daß die Studie nur Aussagen über kurzfristige Effekte macht, wie sie gerade während des Spielens auftreten, nicht aber über das langfristige Verhalten der Spieler (vgl. Bißwanger-Helm 2006). Es sei anhand von fMRI-Aufnahmen nicht zu erkennen, ob Spieler nach dem Spielen tatsächlich "gewaltnäher" oder aggressiver sind als vorher, und weiterhin auch im Gehirn Unterschiede zwischen virtueller und realer Gewalt gemacht werden (vgl. Sendetext zu "Welt der Wunder - Ego-Shooter: Spiele für Killer?" vom 04.03.2007).
2.1.10.3.2 Pfadanalyse
Nachdem bereits oben einige Absonderlichkeiten früher konstruierter Modelle aufgezeigt wurden, soll dies auch mit den dort vorgetragenen Pfadmodellen geschehen. Die Autoren der Studie stellten verschiedene Hypothesen auf und generierten Pfadmodelle, mit denen diese überprüft werden sollten:
Die zu überprüfende Hypothese #3 der Autoren lautet, daß der Konsum gewalthaltiger Computerspiele zum ersten Untersuchungszeitpunkt die Ursache für die Gewalttätigkeit zum zweiten Untersuchungszeitpunkt zwei Jahre später sei. Für den Zusammenhang zwischen dem Spielen von gewalthaltigen Spielen zum ersten und der Aggressivität zum zweiten Zeitpunkt gibt Huber im Pfadmodell einen Pfadkoeffizienten von 0.18, und zur Delinquenz einen Pfadkoeffizienten von 0.29 an (vgl. Huber 2007, S.19f.; 2008b, S.36f.).
Im Pfadmodell (vgl. Huber 2007, S.19f.) wird nun auch ein Pfadkoeffizient von 0.18 zwischen den beim Konsum von "Horror-Gewalt-Filmen" (in Spanisch sinnigerweise dann "películas de terror y violencia", vgl. Huber 2008b, S.24) erfahrenen Empfindungen und der physischen Gewalt der Eltern aufgeführt. Verfolgt man diese Beziehung so, dann heißt das, daß Kinder und Jugendliche, die beim Medienkonsum stärker empfinden, von ihren Eltern deshalb mehr geschlagen werden. Für ein Pfadmodell, das die Delinquenz des Jugendlichen zum zweiten Erhebungszeitpunkt darstellt, setzen die Autoren noch das Alter hinzu, bei dem der Jugendliche damit begonnen hat, sich solche Filme anzusehen. Dort wird mit einem Pfadkoeffizienten von -0.20 festgehalten, daß Jugendliche deswegen, weil sie später mit dem Konsum beginnen, weniger von ihren Eltern geschlagen werden. Diese Werte erwecken zunächst den Eindruck, daß auch hier wieder einmal der Medienkonsum zur "Allursache" erklärt würde. Ein Pfadkoeffizient von -0.16 zwischen der Armut des Jugendlichen und seinem Computerspielekonsum deutet allerdings darauf hin, daß eigentlich diejenige Gruppe der Jugendlichen, die nach Einkommen gestaffelt am wahrscheinlichsten gewalttätig wird - dies sind gerade die ärmeren Jugendlichen -, weniger wahrscheinlich spielen. Auch im Angebot ist dann auch ein Pfadkoeffizient zwischen dem Konsum von "Horror-Gewalt-Filmen" mit der Richtung hin zum Geschlecht des Jugendlichen und einem Pfadkoeffizenten von 0.16. Kausal interpretiert hieße das, daß der Konsum von solchen Medien das Geschlecht beeinflußt.
Entsprechend müssen hier wiederum Fragen der Kausalität und der Plausibilität betrachtet werden (s.o.). So erscheint es nicht plausibel, daß Eltern ihre Teenager-Kinder mehr physisch angehen, weil diese sich bestimmte Filme ansehen, was seinerseits wieder darauf hindeutet, daß sich hier die genannten nicht-kausalen (Schein-)Effekte manifestieren.
2.1.10.3.3 "The world according to players of 'killer games'" (2008)
In einem weiteren Vortrag (vgl. Huber 2008a; deutsche Version: Huber 2008c) versuchte Huber, aus der Art und Weise, wie Spieler, die sich durch einen ähnlich gelagerten Bericht in "Frontal 21" im Jahr 2004 verunglimpft gefühlt hatten, im Diskussionsforum des ZDF ihren Unmut über die ihrer Meinung nach einseitige Art der Berichterstattung äußerten. Mit seinem "konstruktivistischen Ansatz" folgerte er, daß Spieler keinerlei Verantwortungsbewußtsein hätten und wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von gewalthaltigen Computerspielen hartnäckig ignorierten. Weiterhin dürfe man sich auch dadurch nicht irritieren lassen, daß ein Großteil der Diskutanten sich über die Berichterstattung negativ geäußert hatten, weil dies zu "unerwünschten Effekten" führen könne (vgl. Huber 2008a, S.26).
Diese Argumentationen und Kommentare der Spieler wurden hier mit Hilfe einer Liste von "logischen Fehlschlüssen" überprüft und zu einem solchen erklärt. So sei es weder relevant, daß Millionen von Spielern der angeblich amoklaufauslösenden Spiele bis dato noch niemanden auf dem Gewissen hätten noch daß in Computerspielen keine realen Lebewesen zu Schaden kommen oder das "Schießen" dort keine dreidimensionale Aktivität darstellt, also auch kein Übungseffekt (bzw. nur dann, wenn parallel auch eine realweltliche Schußwaffenausbildung stattfindet) zustandekommen könne. Ebenfalls weist Huber Kulturkritik von sich, daß etwa auch andere Medien gewalttätige Inhalte präsentieren oder die Gesellschaft selbst bestimmten Aspekten von Gewalt gegenüber positiv gegenübersteht (vgl. Huber 2008a, S.14). Insgesamt demonstrierten viele Spieler im Rahmen ihrer Argumentation gerade, daß sie Vorstellungen aus diesen virtuellen Welten in die reale Welt übernommen hätten (vgl. Huber 2008a, S.20). Die Spieler werden mit religiösen Fundamentalisten und anderen Extremisten verglichen, die keiner logischen Argumentation mehr zugänglich seien (vgl. Huber 2008a, S.23). Ihre Sicht könne gar nicht wahr sein und auch keine wertvollen Diskussionsbeiträge oder Forschungsfragen liefern, da man ja mit Hilfe seiner eigenen Pfadanalyse (vgl. Huber 2008a, S.25) "belegt" hatte, daß ihre Beiträge nicht wahr sein könnten (vgl. Huber 2008a, S.24). Damit zeigt Huber allerdings gerade das selbstimmunisierende Verhalten, das er den Computerspielern vorwirft.
Wenn Huber andererseits kritisiert, müßte er ansonsten aber auch den Medienkritikern vorwerfen, sie hätten ganz ähnlich argumentiert. So ist bereits der Gebrauch des Begriffs „Killerspiele“ ein „argumentum ad populum“, die Übernahme und der inflationäre Gebrauch der anderweitig unbewiesenen und sogar widerlegten Behauptung von Dave Grossman ein „argumentum ad verecundiam“, und auch die (faktisch unwahre) Behauptung, es gebe Tausende Studien, die alle bewiesen, daß Computerspiele gewalttätig machte, ein „argumentum ad numerum“. Darauf hinzuweisen ist freilich ein „tu quoque“ (vgl. "Atheism: Logic & Fallacies", abgerufen am 01.05.2009). Die eigenen Argumente werden allerdings auch nicht dadurch besser, daß man sich damit beschäftigt, die Argumentationen der Gegenseite auf logische Fehler hin zu sezieren.
Der Ansatz war letztlich also darauf ausgelegt, die Spieler als valide Diskussionspartner und gleichzeitig auch Argumente, die diese möglicherweise hätten anbringen können, zu diskreditieren. Damit begeht der Autor schließlich selbst den Fehlschluß des "tu quoque", da dies weiterhin noch als Retourkutsche dafür erscheint, daß einige Spieler Konsequenzen aus der "ergebnisoffenen" journalistischen Arbeit gefordert hatten (vgl. Huber 2008a, S.20). Gleichermaßen sei auch erwähnt, daß im "Frontal 21"-Chat nach der Ausstrahlung eines anderen Beitrags ein Diskutant bekundet hatte, er hoffe, daß die Kinder von Jürgen Fritz, dessen Meinung ja nun eine etwas andere ist, selbst einmal ein bißchen von "friedliebenden Computerspielern" verprügelt würden (vgl. I.2.2.).
2.1.10.4 Eine gewisse historische Entwicklung? / Fragen an die Größen hinter den Zahlen
Hopf hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit solchen "Studien" eingelassen, die stets reklamierten, daß ein großer Teil der jugendlichen Gewalttätigkeit und Kriminalität auf den Konsum gewalthaltiger Medien zurückzuführen sei. Allerdings ist nicht bekannt, ob er daraus im Sinne einer Metaanalyse tiefergehende Schlüsse gezogen hat.
So hatte Hopf in einer ersten diesbezüglichen Veröffentlichung zu einer Studie, die im Jahr 2000 durchgeführt worden war, noch eine Korrelation von r=0.51 zwischen dem "Konsum von Mediengewalt" und der "Gesamtgewalttätigkeit" ausgewiesen (vgl. Hopf 2002, S.254), die entsprechend 26% der Varianz bei der Gewalttätigkeit von Jugendlichen erklären soll. Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2004 wies für dieselben Größen nur noch eine Korrelation von r=0.42 aus (vgl. Hopf 2004, S.106). Diese würde - sofern es sich dabei um einen reinen Wirkungseffekt handelte - 17.6% der Varianz erklären. Im Zeitablauf geht der propagierte Einfluß von gewalthaltigen Computerspielen also zurück.
Es wäre nun sinnvoll, zu hinterfragen, wodurch dieser Unterschied zu erklären ist. Bedeutet dies etwa, daß mit einer technischen Weiterentwicklung - je realistischer also die Spiele werden -, die "Wirkung" geringer wird? Es könnte zum Beispiel sogar ein "negativer Selektionseffekt" gegeben sein, daß aggressive Personen weniger wahrscheinlich zu gewalthaltigen Medien greifen, weil der "Reiz" bzw. die von Hopf suggerierte "Faszination" immer geringer wird und eher unangenehmen Befindlichkeiten weicht, und hier die Darstellung von Gewalt in Konsequenz das Selbstbild des "unverwundbaren Helden" immer weniger bestätigen kann (vgl. Kimm 2005, S.110f.).
2.1.10.5 „Dieser Befehlston...“
„A true war story is never moral. It does
not instruct, nor encourage virtue, nor suggest models of proper
human behavior, nor restrain men from doing the things men have
always done. If a story seems moral, do not believe it. […]
There is no rectitude whatsoever. There is no virtue. […]
You can tell a true war story if it embarrasses you. If you don't
care for obscenity, you don't care for the truth […:] Send
guys to war, they come home talking dirty.“
(Tim
O'Brien, „The Things They Carried“, zitiert nach:
O'Nan 1998, S.514)
In einem weiteren Beitrag von Rainer Fromm („Brutale Computerspiele- Forscher warnen“, in: „heute-journal“, 21.04.2009), in dem dieser wieder einmal die vermeintlich schleichende Militarisierung anprangerte, die durch „Killerspiele“, „Metzelspiele“ und ähnliches in die deutschen Kinderzimmer gebracht werde, wurde auch Werner Hopf interviewt. Er beklagte, „[d]ieses Spiel, Call of Duty, [sei] ein exaktes Training für das Militär. […] Wer das trainier[e], in diesem Befehlston, [sei] gleichgeschaltet mit militärischem Drill und Töten“ (zitiert nach "Dr. Rainer Fromm und die Killerspiele im Heute Journal: 'Sadismus pur'", abgerufen am 01.05.2009). Allerdings ist gerade der „Befehlston“ doch relativ leicht aus dem Szenario heraus zu erklären. Um ein glaubhaftes Szenario zu vermitteln, liegt es nahe, darin auch eine Sprache zu gebrauchen, die in etwa der entspricht, wie man sie beim Militär erwarten würde. Dies hat nichts damit zu tun, daß dadurch der Konsument außerhalb der Realität zu Gewalthandlungen animiert werden sollte – ansonsten würden wohl auch Bücher wie „Im Westen nichts Neues“, in dem der Protagonist der Handlung von seinem Unteroffizier – der vor dem Krieg Briefträger in seinem Heimatort war, hier wird also noch deutlicher kontrastiert – bis zum Erbrechen geschunden wird, als „kriegsverherrlichendes Material“ gebrandmarkt werden.
Bei jedem anderen Medium wird tatsächlich gerade die Authentizität als ein Merkmal für die besondere Qualität angesehen. Es würde schlichtweg nicht als realistisch angesehen werden, spräche zum Beispiel Remarques Militärausbilder in demselben Duktus wie zuvor als Postbote. Dies soll hier für Computerspiele nicht gelten dürfen – trotz aller Reklamation betrachten also die Medienkritiker dieses Medium unter ganz anderen Maßstäben.
2.1.11 Rudolf Weiß
1. Auch Rudolf Weiß hat bereits früher die Medien als auslösendes Moment für viele Probleme unserer Gesellschaft "festgemacht". So propagierte er in verschiedenen Veröffentlichungen, daß der Konsum von ihm so genannter "Horror-Gewaltfilme" bzw. "PC-Tötungsspiele" als letztlich viel wichtigere kausale Ursache für die Entstehung einer rechtsradikalen Gesinnung zu gelten habe als etwa pathologische sozioökonomische Bedingungen oder Perspektivlosigkeit (vgl. Hopf 2002, S.253; Weiß 2002, S.8+14). Bezeichnenderweise führte "Panorama" in seinem ersten Bericht über "Killerspiele" am 22.02.2007 speziell an, daß Spieler solcher Spiele sich aus "Neonazis" rekrutierten, und bezeichnete "Frontal 21"-Redakteur Rainer Fromm gewalthaltige Computerspiele als "den gleichen 'totalitären Bodensatz in der Gesellschaft'" (Lindemann 2008). Da in der Gesellschaft ein mehr oder weniger stillschweigender Konsens besteht, Neonazis und deren "Argumenten" nicht zuzuhören, hat man sich auf diese Weise weitgehend gegen die Kritik von Seiten der Computerspieler und spielender Medienforscher immunisiert.
Weiß schafft es, in einem kolossalen Rundumschlag die seit Jahrhunderten von Altvorderen fast aller Generationen als verlottert gebrandmarkte Jugend und die Symptome von Mißständen in der Gesellschaft, die an der Generationengrenze von den Medien besonders deutlich vermittelt werden, zu Ursachen für diese umzudeuten. Insbesondere stellt er die Entstehung rechtsradikaler Haltungen letztlich als Ergebnis einer "direkte[n] Schiene", die "von Stefan Raab [...], Big Brother und Playback Show [und] Bravo [...] bis hin zu Natural Born Killers [...] oder den aufpeitschenden Neonazisongs von 'Noie Werte' oder den 'Bösen Onkels'" führe. Besonders Jugendliche seien dafür anfällig, da sie sich nicht in Bescheidenheit ergingen und das beschränken wollten, was ihnen möglich sei, und nach spektakulären Vorbildern suchten (vgl. und Zitat Weiß 2002, S.2).
Allerdings sieht Pilz (2001) Rechtsextremismus und Flucht in Medienwelten letztlich als Ergebnis von Gefühlen der Ohnmacht, die die eigentliche Ursache rechtsextremer Gesinnungen sind (vgl. S.11), dies also als Scheinkorrelation. Ansonsten stellt gerade die immer weitere Druckausübung, verbunden mit dieser Forderung nach Bescheidenheit ein Moment dar, mit dem die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen letztlich gesteigert würde (vgl. ebd., S.11f.).
(Ein anderer Punkt, der mir süffisant auffällt, ist auch schon die Wahl des Titels des Beitrags. Wenn dort von einer „Verstärkung der Realität“ gesprochen wird, so heißt das ja, daß mediale Darstellungen Realitäten nicht schaffen, sondern nur Ausschnitte aus ihnen herausnehmen und diese besonders prägnant hervorheben, oder aber Medienkritiker Weiß sein Bild von der Realität selbst aus medialen Darstellungen bezieht. Nicht die Darstellung „an sich“ wäre dann das Problem, sondern vielmehr eine Realität, die von den Menschen als Bedrohung empfunden wird; etwa den für den ganzen Menschen zerstörerischen „Turbo-Kapitalismus“.)
2. Um insbesondere aufzuzeigen, von wie schlechter Qualität die Vorbilder seien, die heutige Medien im Vergleich zu früheren Medien liefern, vergleicht Weiß einige Motive der Novelle "Michael Kohlhaas" von Heinrich von Kleist, die auf ein reales Vorbild aus dem 16.Jahrhundert zurückgeht (vgl. Wikipedia:Michael_Kohlhaas_(Kleist); Wikipedia:Hans_Kohlhase; abgerufen am 07.10.2007), mit ähnlichen in der Filmtrilogie "Rambo". Wo allerdings Gemeinsamkeiten auftauchen, bemüht er sich dabei konsequent um Umdeutungen.
a) Trotzdem Kohlhaas sich nach grausamen Willkürakten der Obrigkeit veranlaßt sieht, mordend und brandschatzend durch das Land zu ziehen, sich dabei zudem als Hersteller der Gerechtigkeit sieht - sein "Amoklauf" hier also als Mittel des sozialen Protests erscheint -, sucht Weiß Kritiken an dessen Handlungen und Charakter zu relativieren. Die Rache, die er übe, sei vor allem "Selbstrache". Kleists Kohlhaas war zum Beispiel dem Urteil Goethes nach von gepflegter Hypochondrie oder großer Rechthaberei geprägt gewesen, was Weiß als "falsche individual-psychologisch [sic!] Reduktion" zurückweist (vgl. Weiß 2002, S.4). Andererseits werden aber moderne Amokläufer vor allem als Psychopathen dargestellt, die durch Medienkonsum zum Realitätsverlust getrieben worden seien (vgl. ebd., S.9), obwohl diese ebenfalls Pamphlete hinterließen, in denen sie deutlich machten, daß vor allem Dinge wie die Flachheit des Lebens oder die Mißachtung des Anderen Beweggründe für ihre verheerenden Entschlüsse waren.
b) Schließlich werde ja auch der Glaube an die Rechtlichkeit wiederhergestellt, weil Kohlhaas schließlich dafür gehenkt wird (vgl. ebd., S.4). Eben noch wurde in der Argumentationslinie von Walter Popp und seinen Epigonen kritisiert, Kinder lernten im Fernsehen, daß es auf sie nicht ankäme, daß sich durch ihr Handeln nichts ändern ließe (vgl. Brugger 2001, S.22f.). Das obrigkeitliche Denken ist allerdings kulturell bedingt. Die Medienmacher hatten wohl sogar damit kalkuliert, daß Medienkonsumenten die Vorstellung hätten, man könne sich ja nicht wehren. Wenn aber Menschen sich gegen üble Propaganda wehren, so ist dies schließlich auch nicht recht, und so wird von ihnen gefordert, sie müßten sich bescheiden (vgl. Weiß 2002, S.2), oder sie werden als "Neonazis", "Süchtige", "korrumpiert" oder potentielle Amokläufer dargestellt. Dies ist eine weitere Absurdität in den Argumentationen der Medienkritiker.
c) Ansonsten wird für Weiß Gewalt und deren Darstellung zum "Selbstzweck", sobald man in eine Situation gerate, in der der Zweck (die gepflegte Vorstellung von "Gerechtigkeit") das Mittel (Gewalt) heilige (vgl. Weiß 2002, S.3). Nun ist das in den "Rambo"-Filmen dargestellte Denken allerdings Abbild der politischen Vorstellungen. Die "Reagan-Ära", in der solche ein erzreaktionäres Weltbild atmenden Filme wie die "Rambo"-Trilogie oder "Die rote Flut" entstammen, war zunächst durch eine Zunahme der Aggressivität der politischen Auseinandersetzung und durch militärische Interventionen, so etwa den Stellvertreterkrieg gegen die Sowjets in Afghanistan, gekennzeichnet.
Diese Filme stellen sehr häufig nicht die wahren Geschehnisse in einem Krieg dar (vgl. Scherz 2003, S.18) und halten sich im Vergleich auch mit der Gewaltdarstellung zurück, während Antikriegsfilme und allgemein gewaltkritische Filme teilweise Gewalt und ihre Konsequenzen prägnanter darstellen (vgl. Riepe 2003, S.19), wohl aber auch eine weitergehende Reflexionsebene anbieten (vgl. Scherz 2003, S.19f.). Als Beispiele für solche Filme sind etwa "Full Metal Jacket" oder "The Deer Hunter" zu nennen, die sich - durchaus verallgemeinernd - mit den psychischen Auswirkungen der eigenen Entmenschung im Zuge des militärischen Drills und der Kriegssituation an sich beschäftigen (vgl. Scherz 2003, S.57f. bzw. S.35-37). Nach einer Definition, die allein auf die Gewaltdarstellung abstellt und nichts über deren Sinn und Hintersinn aussagt, würden diese Filme negativer bewertet als etwa John Waynes "Die grünen Teufel", der bekannteste Pro-Vietnamkriegsfilm.
3. Weiß behauptet, daß nicht nur eine kleine Minderheit, sondern vielmehr drei Viertel der jugendlichen Zuschauer, durch den Konsum gewalthaltiger Medien eine ganze Reihe von Problemen entwickeln würden. Anfällig dafür seien insbesondere selbstunsichere und labile Persönlichkeiten, solche, die in ihrer Kindheit Traumata erfahren oder psychische Probleme hätten. Bei diesen Gruppen, deren Anteil Weiß nach Lamnek mit 17% der 13-15jährigen angibt, zeichneten sich eine Suchtwirkung und die Möglichkeit eines Realitätsverlustes ab. Allerdings würden bereits noch nicht völlig gefestigte Persönlichkeiten auf Darstellungen mit Angst(-Lust) reagieren (vgl. Weiß 2002, S.6f.). Bei dieser Darstellung greift Weiß allerdings auch auf sehr einfache und mehr oder weniger widerlegte Thesen, wie etwa daß Medien Imitationseffekte bewirkten - insbesondere ja zu Taten provozierten, zu denen zuvor kein Wille bestanden habe (vgl. ebd., S.7) zurück.
Andererseits sei für die seiner Schätzung nach 20-30% der Konsumenten, die eine „gefestigte Persönlichkeit“ besäßen, durch Medienkonsum zwar keine Konsequenzen zu befürchten, allerdings würden sie auch eher negativ auf diese reagieren. „(J)e nach sozialer Grundeinstellung“ seien Haltungen vom „nicht betroffen sein bis zu Abwendung (Ekel)“ auftreten (Weiß 2002, S.6). Nun läßt sich aus den Äußerungen von Weiß schon ableiten, daß eine „soziale Grundhaltung“ um so besser zu beurteilen sei, je stärker sie Gewaltdarstellungen in Medien ablehnte. Die letztliche Konsequenz aus einer solchen Aufgliederung ist damit, daß „moralisch gefestigte“ Menschen mit „einwandfreier“ Haltung derartige Inhalte nur ablehnen könnten und nicht konsumierten, und in der Umkehrung damit, daß Menschen, die derartige Inhalte konsumierten, überwiegend „nicht ganz gefestigt“, „selbstunsicher“ seien, „Beziehungsstörungen“, „verminderte Affektsteuerung“, eine „niedrige Intelligenz“, „psychotische Entwicklung“ oder „dissoziale Einstellung(en)“ aufwiesen. (Diese Argumentation wird von Medienkritikern wie Regine Pfeiffer und Sabine Schiffer tatsächlich auch gebraucht, und man konnte sie freilich dafür benutzen, im Rahmen eines „Jugendschutzes“ auch die Erwachsenen vor bestimmten Medieninhalten zu „schützen“.)
Weiß behauptet, daß letztlich viele Formen von erregenden Medieninhalten - und dabei, wieder einmal, längst nicht nur gewalthaltige Medien - zu feindlichen Einstellungen und Gewalt gegen Ausländer führten. Schon die Berichterstattung über Gewalt reiche aus, um letztlich gewalttägige Handlungen auszulösen. Medien stellten also insgesamt "sowohl Verursacher als auch Auslöser" von Gewalt dar (vgl. ebd., S.8).
4. Weiß hat eine Liste von Amokläufen und Mordtaten von überwiegend Jugendlichen veröffentlicht, die er alle in einer kausalen Verbindung mit dem „Gewaltmedien Abusus“ (sic!, Weiß 2009, S.7) sieht, die er in die Kategorien „Horror-Gewalt-Filme“, „Gewaltpornos“ und „Video/PC-Tötungsspiele“ gliedert. Seine Argumentation fußt darauf, daß dieser Konsum „[b]ei fast allen Tätern“ berichtet worden sei (vgl. Weiß 2009, Kap.4).
Allerdings führt die Berufung auf die Berichterstattung zu Fehlern: So war zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Amoklauf von Winnenden innerhalb weniger Tage nach der Tat zum Beispiel berichtet worden, der Täter habe seine Tat zuvor in einem Internet-Chatroom angekündigt, was wenig später dementiert wurde (vgl. "Amokläufer von Winnenden hat die Tat offenbar doch nicht angekündigt", abgerufen am 01.05.2009). Genauso konnte auch eine Meldung des „Spiegel“, der Täter habe am Vorabend für zwei Stunden einen spezifischen Ego-Shooter zu spielen (vgl. "Amokläufer verbrachte Abend vor der Tat mit Killerspiel"), nicht bestätigt werden (vgl. "Nicht sicher, ob Tim K. Gewaltspiel gespielt hat", abgerufen am 01.05.2009). Im Hinblick auf die Berichterstattung fällt auch auf, daß Personen, die gar nicht für eine Expertise für Computerspiele bekannt wurden, im Hinblick auf das Verhalten des Täters messerscharf schlossen, dieses Verhalten könnten Jugendliche „auch in Spielen wie Counter-Strike oder Crysis lernen“, und damit neuerliche Forderungen nach einem Totalverbot von gewalthaltigen Spielen zu begründen versuchten (vgl. "Amoklauf von Winnenden: Polizei hat Hinweise auf Tatmotiv", abgerufen am 01.05.2009). Am Bericht selbst fällt auch auf, daß man sich Fragen wie dem Motiv des Täters für einen Absatz lang gewidmet hatte, während offenbar dessen Medienkonsum, der sich den eigenen Meldungen nach nicht von dem eines durchschnittlichen Jugendlichen unterschieden hatte, viel intensiver thematisiert wurde. Im Nebel von Meldungen und Dementis verschwamm ebenfalls der Punkt, daß der Täter angeblich zuvor in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sein soll (vgl. ).
Andererseits soll der Täter laut seinem Profil, das ein Internetnutzer recherchiert hatte, in der jüngeren Vergangenheit „0.1 Stunden“ mit entsprechenden Spielen zugebracht (vgl. "Winnenden: Familien fordern Killerspielverbot", abgerufen am 01.05.2009), seit seiner Anmeldung am 11.Juni 2008 (man kann das Spiel nicht spielen, ohne angemeldet zu sein, so daß dies womöglich einen gewissen Überblick vermitteln mag) überhaupt nur elf Partien gespielt (vgl. (mutmaßlicher Account), abgerufen am 01.05.2009), wobei er acht Spielversionen oder -varianten ausprobiert hatte (vgl. (mutmaßlicher Account), abgerufen am 01.05.2009). Auch wenn er wohl so Einiges ausprobiert haben mag, zeigt dies eigentlich, daß er kein nennenswertes Interesse für irgendeines dieser Spiele entwickelt hatte. Zum Vergleich kommen „leidenschaftliche Spieler“ womöglich auf mehrere Spielsitzungen pro Woche mit jeweils mehreren Stunden. (Auch sagt es - „argumentum ad numerum“ - eben zunächst nichts aus, daß er gespielt hatte, da zum gleichen Zeitpunkt vermutlich Hunderttausende anderer Personen ebenfalls diese Spiele gespielt hatten, ohne danach Amok zu laufen.)
Zum anderen aber gibt Weiß an, er habe etliche andere Fälle, wie etwa den Amoklauf von Emsdetten oder von Tessin, „noch nicht einbeziehen können“ (vgl. ebd., S.7). Tatsächlich sind dies aber Fälle, in denen eine solche „Kausalität“ explizit ausgeschlossen werden konnte: Der Täter von Emsdetten hatte selbst angegeben, daß die Graphikkarte seines PCs zu langsam war, als daß er ein neueres und „besonders realistisches“ Spiel wie etwa „Doom 3“ hätte spielen können (vgl. "Die üblichen Verdächtigen" (Phoenix), abgerufen am 01.05.2009). Im „Spiegel“-Bericht liest sich das natürlich wiederum anders, dort wurde wiederum behauptet, er habe „Doom 3“ und „Counterstrike“ gespielt (vgl. "Die wirre Welt des Sebastian B.", abgerufen am 01.05.2009).
Auch bei den jungen Tätern von Tessin wurde die These widerlegt, die Medien hätten einen „kausalen Einfluß“ gehabt. Vom Boulevard wurde nun natürlich behauptet, sie hätten das Computerspiel „Final Fantasy VII“ (USK: „ab 12“) nachgespielt, wobei mindestens einer der Charaktere, auf die sie sich angeblich bezogen haben sollen und die ihre Idole sein sollten (vgl. "Das sind die Opfer der Killer-Schüler!", abgerufen am 01.05.2009), nicht im Spiel vorkommt (vgl. Wikipedia: Final Fantasy VII, abgerufen am 01.05.2009). Ein Charakter namens „Reno“ taucht nur im (ebenfalls „ab 12“ freigegebenen) Film „Final Fantasy VII: Advent Children“ vor (vgl. Wikipedia: Advent Children, abgerufen am 01.05.2009). Sowohl das Spiel als auch der Film spielten in fiktiven Welten. Vielmehr zeigte sich in der späteren Darstellung, daß die Täter völlig realitätsfremde Vorstellungen vom Leben im heutigen Japan hatten. So heißt es, sie hätten ein Auto stehlen und dann als Ninja-Kämpfer in den japanischen Wäldern leben wollen. Dies spricht zwar zunächst für die Möglichkeit, daß sich da eine fiktionale Vorstellung verselbständigt hatte. Das alles ist allerdings überhaupt nicht Bestandteil des Szenarios, und das Auftreten eines „Realitätsdurchbruchs“ wurde von Sachverständigen während des Gerichtsprozesses widerlegt (vgl. "Tessin-Prozess: Als zwei Buben zu Bestien wurden", abgerufen am 01.05.2009). Vielmehr hatte einer der Täter schon Jahre zuvor von psychischen Problemen wie Minderwertigkeitskomplexen und Zwangsgedanken berichtet, hatte unter seinen Segelohren gelitten, war deswegen jahrelang als „hässlichster Junge der Klasse“ tituliert worden. Der Junge hatte also auch eine ganze Reihe von Ereignissen erfahren, die er als Demütigungen empfand. Er hatte irgendwann damit begonnen, Gewaltphantasien zu äußern, so etwa im Alter von 15 Jahren, er wolle gerne seine ganze Klasse umbringen (vgl. "Doppelmord in Tessin: 'Wie kommt so viel Hass in unser Kind?'", abgerufen am 01.05.2009).
Wenn Weiß nun nach Gemeinsamkeiten von Amokläufern suchen wollte, so hätte er ggf. dokumentieren sollen, daß eigentlich alle Amokläufer in der Vergangenheit sich Situationen ausgesetzt sahen, die von ihnen als massive Demütigungen empfunden wurden. (Siehe dazu den „Versuch eines Fazits“ am Ende dieses Kapitels).
5. Mit dem Begriff „Abusus“ vermittelt Weiß weiterhin, daß er Computerspiele und insbesondere jene kritisierten Spiele – wegen der damit verbundenen Ausschüttung von Endorphinen - als „Suchtmittel“ ansieht, für ihn offensichtlich ein Grund mehr, diese zu verbieten (vgl. ebd., S.7). Allerdings ist es eben auch nicht so einfach, da es sich bei Endorphinen um „körpereigene Drogen“ handelt, die immer dann ausgeschüttet werden, .
2.1.12 Renate und Rudi Hänsel
1. Nachdem bereits Weiß (2002) Jugendliche dazu aufgefordert hatte, sie sollten sich doch mit ihren Lebensmöglichkeiten bescheiden (vgl. S.2), sehen Hänsel und Hänsel (2006) die Situation, daß ein Computerspieler die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, schließlich sogar als einen "Un-Wert" an, den Computerspiele vermittelten (vgl. dazu V.2.2). Auch hier sind die "Medien an sich" bereits an allem schuld, sollen "Grausamkeiten, Perversionen und Gemeinheiten laut ernstzunehmenden Schätzungen heute 60% bis 70% aller TV-Sendungen und einen noch grösseren Anteil bei den aktuellen Spielen betragen" (vgl. S.9).
2. Weiterhin behaupten sie, "Killerspiele senken eindeutig die Hemmschwelle zum Töten [...]. Killerspiele bereiten auf den Beruf des Söldners vor!" (vgl. Hänsel und Hänsel 2006, S.9).
Dies ist allerdings nicht der Fall. Die Vorstellung, daß Spiele Menschen auf eine bestimmte Rolle vorbereiten, ist zumindest als eindimensional zu bezeichnen (s.o.). Andererseits zeigt sich auch in den wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema der Habitualisierung/Abstumpfung (siehe I.2.2) vielmehr eine Uneindeutigkeit darin, wie nun die Entäußerungen des menschlichen Körpers oder sogar das Gehirns zu interpretieren sind. (Es gab zwar anscheinend auch Versuche der US-Armee, eine solche Habitualisierung herzustellen. Diese hatten allerdings ebenfalls nicht den gewünschten Effekt, die "Tötungshemmung" abzubauen. Warum sollten sie dies auch tun, handelt es sich dort um virtuelle Geschöpfe.)
3. Wieder einmal präsentieren Hänsel und Hänsel auch die inzwischen schon mehrfach widerlegte These, Robert Steinhäuser habe mit dem Spiel "Counterstrike" "das Töten trainiert" (vgl. S.9). Es soll noch einmal festgehalten werden, daß Steinhäuser "Counterstrike" gar nicht hätte spielen können, da dieses Spiel einen Internetanschluß voraussetzt, über den sein Rechner aber gar nicht verfügte. Auch kann man - auch dies zum wiederholten Male gesagt - am Computer offensichtlich Bewegungsabläufe, wie sie bei der Bedienung einer realen Waffe stattfinden, nicht "einüben".
4. Weiter behaupten Hänsel und Hänsel, gewalthaltige Computerspiele seien auch für die Folterszenen verantwortlich, die sich in Abu Ghreib, Guantanamo Bay und anderen Gefängnissen der US-Armee abgespielt hätten (vgl. S.9). Diese Behauptung ist erst recht haltlos. Prominente Beispiele wie das Handeln der Nazis oder auch das "Stanford Prison Experiment" des Psychologen Philip Zimbardo waren gänzlich ohne Computerspiele möglich gewesen.
(i) Zimbardo selbst sah einige Parallelen zwischen seinem damaligen Experiment und den Mißhandlungen von Abu Ghreib. Das "Stanford Prison Experiment" war mit dem Ziel betrieben worden, die Auswirkungen von extremer Entindividualisierung und Entmenschung zu studieren (vgl. Zimbardo et al. 2001, S.8f.). Die Teilnehmer des Versuchs waren 24 männliche Studenten, die zuvor ausgiebigen Tests unterzogen worden waren, um aus der Menge der Bewerber wirklich psychisch gesunde Kandidaten auszuwählen. Diese wurden zufällig auf eine der beiden Gruppen, "Wärter" oder "Gefangene", aufgeteilt. (vgl. ebd., 2001, S.5). Schnell begann danach allerdings die Situation, letztlich der in einem realen Gefängnis immer ähnlicher zu werden. Die "Gefangenen" wurden bald systematisch von den "Wärtern" gedemütigt, in verschiedenen Situationen gegeneinander ausgespielt (vgl. ebd., S.6+20). Bereits 36 Stunden nach Beginn des Experiments mußte der erste "Gefangene" aus seiner Situation befreit werden, weil er einen massiven psychischen Zusammenbruch erlebt hatte, und nach sechs Tagen mußte das Experiment schließlich ganz abgebrochen werden, weil zuviele der Testpersonen gefährlich pathologisches Verhalten entwickelt hatten (vgl. ebd., S.7f.).
a) Im Rahmen von Zimbardos "Stanford Prison Experiment" hatten die "Wärter" deshalb damit begonnen, die "Gefangenen" zu demütigen, weil es keine expliziten Regeln gegeben hatte, die dieses Verhalten als unakzeptabel bewertet hätten. Überhaupt wurden die "Wärter" nicht in ihre Rolle eingewiesen, sondern ihnen lediglich ihre Rolle vorgegeben, die sie mit Inhalt zu füllen hatten. Ihnen war lediglich gesagt worden, daß sie die "Gefangenen" nicht physisch verletzen durften. Diese "Regellosigkeit" nutzten besonders ausgiebig die "Wärter" aus, die in der Nachtschicht tätig waren, weil diese dachten, ihr Verhalten würde nicht überwacht (vgl. ebd., S.6f.+9).
Zimbardo hatte bei seiner Betrachtung des Falles Abu Ghreib und anderer Fälle von Mißhandlungen in Gefängnissen vorgefunden, daß die Beschäftigten, die dort als Wärter eingesetzt wurden, nur geringe Kenntnisse über ihre Aufgaben hatten. Ebenfalls hatte auch keine konkreten Regeln für den Umgang mit Gefangenen gegeben (vgl. Zimbardo et al. 2001, S.11). Zum Vergleich binden Computerspiele dadurch, daß sie sich in Algorithmen abspielen, das Verhalten des Spielers in Regeln.
b) Während des Versuchs hatte der Kontext auf alle Beteiligten abgefärbt. Zimbardo selbst hatte zunächst keine Veränderung an sich festgestellt, andererseits aber hatte seine damalige Verlobte an ihm gefunden, daß er selbst Teil des Systems geworden war, das eine so weitgehende Entmenschlichung betrieb wie ein echtes Gefängnis (vgl. Zimbardo et al. 2001, S.18f.).
Dies verweist natürlich auch auf unser Problem, nämlich den grundsätzlichen Unterschied der Perspektiven, die Medienkritiker und Spieler auf Computerspiele einnehmen. [In der Dissonanztheorie geht man davon aus, daß ein Rollenspiel um so stärker die Veränderung des Charakters einer Person bewirkt, je geringer ausgeprägt die Rechtfertigung für das Einnehmen einer solchen Rolle ist, etwa deswegen, weil die Bezahlung, der Zwang dazu oder die Begründung geringer ist (vgl. Zimbardo et al. 2001, S.10).] Allerdings müssen wir festhalten, daß von Seiten der Medienkritiker in diesem Falle eine Überinterpretation eintritt. [...] / Allerdings wird gerade im Zusammenhang mit Darstellungen in Medien die umgekehrte Relation aufgezeigt, daß nämlich eine höhere Aggressionsneigung insbesondere dort auftritt, wo ein stärkerer Bezug der Gewaltdarstellung zur selbst erlebten oder zur Nachrichten-Realität gegeben ist (vgl. Kimm 2005, S.22).
(ii) Ein weiteres wichtiges Experiment ist das sogenannte "Milgram-Experiment". [...] Stanley Milgram hielt dabei fest, daß zum Beispiel zwar einige der Versuchspersonen der Aufforderung des Versuchsleiters widersprochen hatten, ihrem "Partner" weiterhin Schmerzen zuzufügen. Aber nicht eine der Versuchspersonen hatte gegen die Anweisung verstoßen, solange auf ihrem Stuhl sitzen zu bleiben, bis ihr dies erlaubt würde, etwa um im Nebenraum nachzusehen, ob es dem "Partner" gutginge. Ebenso hatte auch keiner der Kandidaten den Versuchsleiter dazu aufgefordert, sich über das Befinden des "Partners" zu informieren (vgl. Zimbardo et al. 2001, S.3).
Varianten dieses Experiments gehören heute zum Standard-Repertoire auch der Forscher, die sich mit Medienwirkungen beschäftigen. Dabei wird angenommen, daß sich die Aggressivität von Testpersonen durch die Lautstärke eines Tons, den sie dem fiktiven Gegenüber in einen Kopfhörer einspielen, oder durch die Menge an Chilisauce operationalisieren läßt, die diese in einen Kaffeebecher gefüllt haben. Allerdings werden diese Operationalisierungen gleichermaßen kritisiert (vgl. K+Z-GamesMarkt).
Letztlich zeigen gerade das ursprüngliche „Milgram-Experiment“ und seine Nachfolgestudien, daß ein Großteil der Menschen in einer vergleichbaren Situation nur geringe moralische Skrupel haben wird, Anderen Gewalt anzutun. Das Experiment kann heute wiederholt werden, ohne daß dabei statistisch signifikante Abweichungen von Milgrams ursprünglichen Beobachtungen aufträten (vgl. Stöcker 2008). Nicht geklärt ist ggf. auch, ob die Betreuer der Testpersonen darüber Bescheid wußten, welche Testpersonen zuvor mit gewalthaltigen Medien in Kontakt gekommen waren, und unbewußt oder bewußt Signale aussandten, die in der Gabe von Tönen bestärkten oder diese zumindest nicht verhinderten.
5. Insbesondere bezogen sich Hänsel und Hänsel natürlich auf das von der US-Armee selbst in Auftrag gegebene und bei Rekrutierungsveranstaltungen verteilte "America's Army". Dieses ist allerdings auch nicht nennenswert "grausam" oder brutal" (vgl. 2006, S.9), sondern in seinen Gewaltdarstellungen ausgesprochen zurückhaltend - so setzen besiegte Gegner sich einfach hin und zeigen nicht die geringste Spur von Verletzungen (vgl. Gieselmann 2003, S.36)-, was übrigens ebenfalls kritisiert wird, da es einen "komfortablen Konsum" ermöglicht (vgl. Kimm 2005, S.) und erst recht keine Ansatzpunkte für Empathie bietet. Auch von seinen Abläufen her ist "America's Army" eher langwierig - so muß der Spieler zunächst eine "Grundausbildung" durchlaufen und wird auch in seiner Handlungsfreiheit sehr stark eingeengt -, so daß eher Personen daran Interesse haben werden, die bereits eine gewisse Affinität zum Militär haben (vgl. Gieselmann 2003, S.).
2.1.13 Manfred Spitzer
1. Spitzer präsentiert plakativ eine Zahl, daß es "[a]ufgrund der Bildschirm-Medien im Jahr 2020 etwa 40.000 Todesfälle durch Herzinfarkt, Gehirninfarkt, Lungenkrebs und Diabetes-Spätfolgen [und] jährlich einige hundert zusätzliche Morde, einige tausend zusätzliche Vergewaltigungen und einige zehntausend zusätzliche Gewaltdelikte gegen Personen" (Spitzer 2005, S.12) geben werde. Er greift dabei auch auf eine vergleichbare Behauptung von Brandon Centerwall zurück, daß das Fernsehen für jährlich 10.000 Morde, 70.000 Vergewaltigungen und 700.000 Gewaltdelikte verantwortlich sei. Zu begegnen sei diesen vermeintlich zerstörerischen Tendenzen wie immer, nämlich mit Verboten ("Einstiegsdroge Teletubbies", abgerufen am 23.11.2007). Letztlich ist Spitzer damit gegen Computerspiele oder auch die ausgewiesenen Medien im allgemeinen. So hält er es bereits für ein Unding, Fähigkeiten wie die Medienkompetenz von Menschen zu schulen, da ja auch niemand Menschen ernsthaft den "verantwortungsvollen" Umgang mit Heroin beibringen wolle (vgl. "Medienkompetenz auszubilden ist ein ganz großer Irrweg" - Ein Erfahrungsbericht vom Symposium "Spielewelten der Zukunft", abgerufen am 05.10.2008).
a) Allerdings wird hier nur ein indirekter Effekt des Medienkonsums referiert, nämlich daß Personen, die vor dem Fernseher oder Computer sitzen, sich in diesem Moment nicht bewegen. Allerdings treibt man auch selten gleichzeitig Sport, während man liest. Nach derselben Logik müßten also Bücher ebenfalls als gesundheitsschädigend verboten werden.
b) Weiterhin konnte der Zusammenhang, die Centerwall konstruierte, nicht im Hinblick auf eine Kausalität bestätigt werden (siehe dazu II.1.1. Auch gibt es keine Berechnungsgrundlage, die wirklich erlauben würde, derartige Zahlen hochzurechnen (vgl. Frank 2005, S.2). Daneben ist auch der Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum und dem Sporttreiben nicht ganz klar. So fand eine Untersuchung von Roberts et al. (2005), daß Jugendliche, die einen besonders hohen Medienkonsum haben, sich im Vergleich auch besonders viel mit körperlichen Aktivitäten und Hobbys beschäftigten (vgl. S.50).
2. ["Neurobiologische Theorie des Lernens"].
Diese Theorie wird von anderen Wissenschaftlern als bestenfalls grob vereinfachend bis nichtssagend angesehen (vgl. Frank 2005, S.2). Wäre zum Beispiel das menschliche Gedächtnis tatsächlich so einfach, wie Spitzer es hier propagiert, hätten Menschen kaum je irgendetwas erlernen können (vgl. Nieding und Ohler 2006, S.50).
3. Kinder und Computer
"Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie
widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern
ihre Lehrer."
(zugeschrieben dem griechischen
Philosophen Sokrates, 469-399 vdZ; ich hatte auch schon einmal
gehört, daß Sokrates im Unterschied aber auch einer der
Ersten war, die auch die Gründe zu verstehen versuchten,
warum Jugendliche sich so verhielten, und nicht nur als
"Altvordere" über sie dozierten)
Auch fordert Spitzer, Jugendliche erst im Alter von 16 Jahren überhaupt mit einem Computer arbeiten zu lassen, weil diese zuvor noch nicht das Wissen hätten, um die Inhalte, die das Internet auf eine Suche präsentiere, auf ihren Gehalt hin zu sortieren ("Wer weniger fernsieht, wird schlauer!", abgerufen am 23.11.2007). Dies gelte insbesondere für Jungen, da diese "nur ballern, verbotene Spiele runterladen und allerlei andere [sic!] visuo-akustischen [sic!] Unsinn" (Frank 2005, S.3) ausübten, also sich das Medium im wahrsten Sinne "spielend" erschließen, nicht machen, was man ihnen sagt, und Eltern auf die Nerven gehen (dies übrigens eine universelle Kritik der älteren gegenüber der jüngeren Generation seit mindestens 4000 Jahren), während Mädchen qua ihres niedrigeren Testosteronspiegels und besseren Sozialverhaltens - Mädchen sind halt eher auf Wohlverhalten ausgerichtet - schon ab 12 Jahren an den Computer gelassen werden könnten (vgl. ebd., S.3).
Auch geißelt er die "Denkstrukturen", die sich angeblich durch die Benutzung von Präsentationssoftware wie PowerPoint ergeben. In Anlehnung an Edward Tufte versteigt er sich sogar zu der Aussage, daß die Benutzung von PowerPoint für den Absturz des Space Shuttle "Columbia" verantwortlich sei (vgl. ebd., S.3). Schließlich mokiert er sich noch darüber, daß die Lehrerin seinem Kind "nur deshalb" die eigentlich verdiente Note verweigert habe, weil er seine Folienpräsentation nicht mit PowerPoint gestaltet habe (vgl. "Kinder lernen besser ohne Computer", abgerufen am 23.11.2007). Mit seiner Darstellung greift er gleich mehrfach an Realitäten vorbei:
a) Daß der laienhafte Umgang mit einer Präsentationssoftware und die hierdurch abgebildete Politik der Informationsweitergabe bei der NASA dazu geführt habe, daß wichtige Sachverhalte nicht im ihnen zukommenden Stellenwert gewürdigt wurden, ist jedenfalls gerade kein Grund, sich nicht und niemals mit PowerPoint zu beschäftigen. Vielmehr geht daraus die Aufforderung hervor, sich intensiv damit zu beschäftigen, wie Vorträge mit und ohne PowerPoint sinnvoll gestaltet werden und insbesondere die verschiedenen beteiligten Medien (Präsentation, Handout und mündlicher Vortrag) ineinandergreifen müssen, um einen korrekten Eindruck vom dargestellten Inhalt zu erlangen (vgl. Farkas 2005; Farkas 2006).
b) In Zeiten, in denen Firmen selbst für vermeintlich "nicht ausbildungsfähige" Jugendliche mit Hauptschulabschluß (im Alter von 16 Jahren) mitunter schon tiefergehende IT-Kenntnisse verlangen, um diese für ein "ausbildungsvorbereitendes Jahr" anzustellen (vgl. [Medienbericht], Link folgt), ist zudem auch die Forderung, Jugendliche erst ab 16 Jahren überhaupt an den Computer zu lassen, deplaziert. Auch in Schulen sollten entsprechend auch in einem geringeren Lebensalter Computerkenntnisse vermittelt werden. Und wenn es eines der Lernziele solcher Lektionen ist, daß auch der Umgang mit Bürosoftware erlent werden soll, stellt es eben ein Manko dar, handschriftliche Folien zu präsentieren.
c) Daß hier eine Software "vermarktet" werden soll, ist jedenfalls auch nicht der Fall, da zum Beispiel das kostenlose OpenOffice ebenfalls die Möglichkeit zur Erstellung von PowerPoint-Präsentationen bietet.
d) Nach Jackson et al. (2006) ist schließlich der Zugang zu einem Computer, der als Werkzeug zur Erschließung von Wissen genutzt wird, ein wichtiger Prädiktor für die Schulleistungen. So wurde in dieser Untersuchung von 10-18jährigen Schülern festgestellt, daß unabhängig vom Alter die Benutzung des Internets bereits mit einem Zeithorizont von sechs Monaten das Leseverständnis positiv beeinflußt und mit einem Zeithorizont von 12 Monaten eine positive Auswirkung auf die Schulleistungen insgesamt hat (vgl. Jackson et al. 2006, S.430-433). Tatsächlich werden Computer in PISA-"Gewinnerländern" wie Finnland oder Kanada auch erheblich häufiger im Unterricht eingesetzt als in Deutschland (vgl. o.V. 2004, S.19).
Übrigens wurden in der Untersuchung von Jackson et al. auch keine Unterschiede im Nutzungsverhalten von Mädchen und Jungen festgestellt (vgl. Jackson et al. 2006, S.433).
e) Es stellt ansonsten auch schlichtweg eine Leistungsverweigerung dar, wenn ein Schüler nicht dazu bereit ist, einen Lerninhalt zu betrachten. Wie würde Spitzer zum Beispiel einen Schüler bewerten, der mit Hinweis auf die religiösen Überzeugungen seines Vaters sich weigert, am Biologieunterricht teilzunehmen, wenn dort die Evolutionstheorie oder die menschliche Sexualität behandelt wird, oder beständig versucht, das Thema zu umgehen, indem er sich in Metadiskussionen ergeht?
4. Verallgemeinerungen. Oder: Eine Taktik.
Anläßlich einer jener „Expertenrunden“, die eigentlich alle nach dem erprobten Muster stattfanden, äußerte Manfred Spitzer im „Nachtcafe“ (SWR, 24.04.2009), in der trotz des Diskussionsthemas „Weg mit den Waffen – Schluß mit der Gewalt?“ die „Diskussion“ einmal mehr auf Computerspiele wie „Counterstrike“ kam, er habe eine E-Mail erhalten, in welcher ein Spieler ihm angedroht habe, ihm gegenüber könne er seine Tötungshemmung gegebenenfalls einmal vergessen. Spitzer nutzte diese Äußerung – ob sie nun stimmt oder nicht -, einmal mehr, um ein Urteil über Spieler im allgemeinen abzugeben.
Ich kann die Äußerung tatsächlich nicht gutheißen, zumal eben anzunehmen ist, daß ein Medienkritiker auch so reagiert. Dessen eigene ggf. auch nicht eben objektive Wortwahl gerät dabei viel zu leicht in den Hintergrund, und werden solche Ausfälle auch nur als eine weitere Bekräftigung von dessen Haltung wahrgenommen.
Tatsächlich aber mag man sie zum Teil durchaus nachvollziehen, da die Computerspiele(r) nicht zum ersten Mal die Angegriffenen waren. Computerspiele(r) wurden, seitdem Amokläufe von Jugendlichen stattgefunden hatten, immer wieder in ein negatives Licht gerückt, wobei sie beispielsweise als infantil, antriebslos, Drogensüchtige, Neonazis, Soziopathen, potentielle Amokläufer bezeichnet, mit Kinderschändern verglichen wurden. Damit versuchen Medienkritiker ziemlich systematisch, Computerspieler vor Anderen schlecht zu machen und ihre eigene Position aufzuwerten und gegen Kritik zu immunisieren. Egal, was „so jemand“ sagt, es kann ja nur falsch sein, es sei denn, dessen Äußerungen stützen die eigenen Argumente.
Es ist durchaus davon auszugehen, daß Menschen, die man permanent auf diese Weise tituliert und herabwürdigt, irgendwann beginnen, sich tatsächlich den Mustern gemäß zu verhalten, die man versucht, ihnen aufzuprägen.
Was bleibt jemandem, dem man absolut nicht zuhört, nicht zuhören will, weil er ja nicht sagt, was man von ihm hören will? Ohnehin ist aber eine Hexe sowieso schuldig, denn wer zu Aussagen schweige, stimme zu, wie der Lateiner weiß, so daß man dies als „Schuldbewußtsein“ interpretieren könne. Und will man dem Film „Das Leben der Anderen“ glauben, so gehörte es auch zum „Latein“ des „Staatssicherheitsdienstes“, daß Menschen, die jener Dinge, unschuldig sind, welche man ihnen vorwirft, sich lautstark wehrten. Allerdings wird eben auch jede Äußerung, die man entgegensetzen wollte, von den Medienkritikern mit rhetorischen Tricks zerredet, oder eben wieder darauf verwiesen, um was für kranke und armselige Menschen es sich bei den Computerspielern doch handele. „Argumentiert“ man schließlich auf einem ähnlichen Niveau wie die Medienkritiker, dann wird dies ebenfalls als Beweis dafür gesehen, daß Medienkonsum aggressiv mache. Offensichtlich kann man sich aber als Medienkritiker oder Politiker ebenfalls beliebig aggressiver Rhetorik bedienen, ohne daß dies als vermeintlicher Effekt des Medienkonsums ausgelegt wird, tritt die Aggressivität des Angreifers dabei sogar in den Hintergrund. Denn es handelt sich dabei um eine Hexenjagd.
2.1.14 Vertreter des „Kölner Aufrufs“
Neben der dezidiert konservativen Kritik gibt es aber auch Kritiker, die auf den ersten Blick „linke Positionen“ zu vertreten scheinen.. Ein Beispiel hierfür ist der „Kölner Aufruf“. Darin wird dezidiert herausgestellt, die Kriege in Afghanistan und Irak seien völkerrechtswidrig (vgl. ). Letztlich bleibt es allerdings bei klassischen „Kritikerargumenten“ und bei Allgemeinplätzen, bei denen nur der Eindruck erweckt wird, sie träfen nur auf Computerspiele zu. Schließlich gleitet es sogar ins Paranoide ab.
Ein Hauptpunkt hierbei ist hier die Behauptung, es gebe einen „militärisch-medial-industriellen Komplex“, der es darauf angelegt habe, die Soldaten für die nächsten Kriege zu produzieren (). Zusammenfassend würde ich wohl behaupten, daß gerade dieser Punkt letztlich wahnhaft erscheint.
Bestimmte andere Argumentationen aus dem "Kölner Aufruf" lassen sich auch Einzelpersonen zuordnen, die diese besonders vehement vertreten, beziehungsweise scheint es eine Vereinbarung zu geben, daß einzelne Mitzeichnende sich auf einen bestimmten Teilaspekt konzentrieren.
2.1.14.1 Sabine Schiffer
1. […] Wer angesichts von Titeln wie „Mobilmachung in den Kinderzimmern“ (Schiffer 2007) oder Untertiteln wie „Wissen, was wirklich gespielt wird!“ (Schiffer 2008) bestimmte Inhalte erwartet, wird dabei auch nicht enttäuscht.
2. „Helicopter Mission“
Als ein Beispiel für die „Propagandamaschinerie“ des vermeintlichen „militärisch-industriell-medialen Komplexes“ nennt Schiffer ein von der Bundeswehr verbreitetes Computerspiel mit dem Namen „Helicopter Mission“, mit dem versucht werde, Rekruten für das Militärische zu werben, wie dies die US-Armee mit „America's Army“ versucht habe (Schiffer 2007, S.57).
Verständlicherweise hatte Schiffer nicht erklärt, daß es sich bei „Helicopter Mission“ nicht um einen Egoshooter oder eines der verpönten „Killerspiele“ handelte, sondern um ein Spiel, das einen Hubschrauber und seine nahe Umgebung in isometrischer Perspektive darstellte, der im Jahr 1993 erschienen war und in dem der Spieler keine Gefechte, sondern nur Geschicklichkeitsübungen austrägt. Das Spiel wird dennoch noch heute als Propaganda angesehen (vgl. "Helicopter Mission", abgerufen am 27.04.2009). Jugendliche werden außerdem vergleichsweise wenig Interesse daran haben, einen solchen Uralt-Titel zum Laufen zu bringen, und auch hat meines Wissens die Bundeswehr keine Anstalten gemacht, weitere „Werbespiele“ herstellen und veröffentlichen zu lassen.
Letzten Endes ist aber dieser Einschub über das sogar gewaltfreie „Helicopter Mission“ nur der Aufhänger für eine weitere Verurteilung eines Großteils von Computerspielen und auch der Spieler. Die Spiele folgten angeblich alle dem gleichen Spielprinzip: „Wie die meisten Ballertrainer [seien] z.B. auch viele GameBoy-Spiele als Rennspiel konzipiert“, und man könne nicht nur durch Schnelligkeit gewinnen, sondern auch, indem man Hindernisse bzw. andere Figuren „aus dem Weg räum[e]“. Auch Strategiespiele seien keine Alternative, da auch in ihnen häufig Gewalt belohnt werde. Für „die positiven Beispiele unter den Computerspielen wie anspruchsvolle Rätselspiele und dergleichen“ würden sich leider nur diejenigen interessieren, „die gelernt haben, sich für Dinge zu interessieren, ausdauernd bei einer Sache zu bleiben und auch Schwierigkeiten nicht gleich aus dem Weg zu gehen“ (vgl. Schiffer 2007, S.58).
Allerdings ist dies offenbar nicht der Fall. In jedem dieser Spiele geht es um die Lösung einer Aufgabe, die ggf. recht fordernd sein kann. Die Aufgabe ist nur in anderer Hinsicht komplex. Um Strategiespiele, Rollenspiele, aber auch Taktikshooter wie „Counterstrike“ einigermaßen zu meistern, muß schon ein relativ großer Zeitaufwand investiert werden, der durchaus auch etliche Stunden ausmachen kann. Nun habe ich selbst primär Rollenspiel- und Strategieerfahrung, denke aber, daß man bezüglich Taktikshootern zu dieser Fehleinschätzung kommen kann, wenn man sich zum Beispiel nur einige Spielszenen auf Video ansieht. Was natürlich dann auch eine Aussage über die Gesamtexpertise der betrachteten Autorin darstellen würde.
Allerdings wird es ja auch gleich wieder bemängelt (siehe etwa Christian Pfeiffer), wenn ein Spiel einen zu großen Aufwand erfordert.
Letztlich ist offenbar ein Szenario, das in irgendeiner Form Krieg mit einbezieht, für Medienkritiker stets problematisch, weder wenn es hier aus relativ einfach dargestellten Geschicklichkeitsübungen besteht, noch wenn es realistisch ist (vgl. Hopf).
3. Schiffer beklagt generell die „kompetitiv-eliminatorischen“ Spiele. Tatsächlich aber ist ja eine ganze Menge von Spielen darauf ausgerichtet, den Gegner in irgendeiner Form zu „elimieren“, aus dem Spiel zu werfen oder genauer: zurückzusetzen. Bekannt ist, daß in „Counterstrike“ und ähnlichen Spielen, die hier wohl gemeint sein sollen, die Spieler häufig wieder an einen Startpunkt zurückversetzt werden (bzw. wenn ein Spielstand abgespeichert werden kann, auch wieder eine Situation vor dem Versagen hergestellt werden kann).
„Wäre
derjenige zu der Zeit in einer Blaskapelle gewesen, hätte er
wohl kaum einen anderen Jugendlichen totgetreten.“
(Klaus
Miehling)
Entscheidend für die Wirkung ist auch, wie eine Situation vom Spieler wahrgenommen wird (vgl. Fritz/). Für ihn spielt die „Eliminierung“ keine andere Rolle als das Werfen der Steine beim „Mensch ärgere Dich nicht“, und er nimmt sie auch nicht anders wahr. Bekannt ist andererseits, daß es bereits nach „Monopoly“-Spielen zu tödlichen Auseinandersetzungen kam. Letzten Endes kann man dann auch keine Unterschiede zwischen Computerspielen und realweltlichen Spielen feststellen, es sei denn vielleicht durch den Grad der Symbolhaftigkeit bei der Darstellung.
4. Die sogenannte „offene Diskussion“
„Urteile
nie über einen Menschen, bevor du nicht 4 Wochen in seinen
Schuhen gegangen bist.“
(Indianisches Sprichwort)
Schiffer beklagt, daß Kritikermeinungen wie die ihre in der Literatur deutlich unterrepräsentiert seien. So seien viele Publikationen darauf ausgerichtet, Computerspiele in einem möglichst positiven Licht erscheinen zu lassen, würden „kritische Meinungen“ darin nicht erscheinen.
Liest man aber in üblicherweise erhältlichen Zeitungen und Zeitschriften oder sieht sich politische Magazine oder Diskussionssendungen im Fernsehen an, treten dort fast nur Medienkritiker auf, die dann natürlich auch der genannten einhelligen Meinung sind, während Personen, die anderer Meinung sind, bestenfalls als Alibikandidaten auftreten, die von den anderen mit rhetorischen Tricks zerlegt werden. Nun ist dies zunächst nur eine subjektive Einschätzung, es könnte ja sein, daß man einfach nicht die richtigen Sendungen sieht oder die richtigen Zeitschriften liest. Allerdings läßt sich die Anwesenheit eines „Bias“ tatsächlich auch fachlich nachvollziehen, z.B. mit einer Metaanalyse von Ferguson und Kilburn (2009).
Gleichzeitig demonstriert Schiffer mit ihren Äußerungen, daß von ihrer Seite eine solche „Diskussion“ überhaupt nicht erwünscht ist, bzw. nur eine solche Diskussion erwünscht ist, in der man wieder einmal einhelliger Meinung über Computerspiele ist, daß diese eben schädlich seien und abgeschafft werden müßten. Zum einen werden doch so einige Wissenschaftler, durch Schiffers Darstellung in den Ruch versetzt, sie seien von den Herstellern von Computerspielen „gekauft“ worden, wird die Arbeit und Fachkompetenz aller jener Wissenschaftler, die nicht ihrer Meinung sind bzw. eine „differenzierte Herangehensweise“ anmahnen, konsequent durch Setzung in Anführungszeichen (also: „Wissenschaftler“ (Schiffer 2008, S.66), „Forschung“ (S.67) oder „Fachtagungen“ (S.69)) geleugnet bzw. in Frage gestellt. Zum anderen behauptet sie, daß Menschen, die diese “bösen“ Spiele spielen, ohnehin eine ganze Reihe von charakterlichen Mängeln hätten: Wer eines der bösen Spiele spiele, sei passiv, desinteressiert, zeige kein adäquates Problemlösungsverhalten, habe keine Ausdauer, könne sich keine längerfristigen Ziele setzen. Wer außerdem glaube, sich beim Medienkonsum entspannen zu können, sei letztlich auch süchtig nach diesen Medien (vgl. Schiffer 2008, S.58). Dies freilich ohne jeglichen Beweis, außer eben der „moralischen Autorität“. Hatte nicht bereits Platon Menschen kritisiert, die lasen und schrieben, weil diese seiner Meinung nach ihr Gedächtnis nicht adäquat ausnutzen würden? Diese Mängel können ebenfalls sogleich verwendet werden, um Personen als valide Diskussionspartner von vornherein auszuschließen.
Dies zeugt jedenfalls von einem denkbar schlechten Diskussionsstil, der das Gegenüber bereits vor einer etwaigen Diskussion herabsetzt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, daß eine Diskussion auch voraussetzen würde, daß man grundsätzlich bereit ist, das Gegenüber als ebenso rationalen Menschen anzusehen, der möglicherweise sogar gleichwertige oder bessere Argumente haben könnte. Man kann nicht von einer „offenen Diskussion“ ausgehen, wenn man von vornherein ohne Kenntnis der Person oder von deren Argumenten jemanden in die Minderheit setzt und nicht nur deren Position, sondern auch die Person selbst durch derartige Titulaturen abwertet. Letztlich kann man aber mit einer solchen Strategie auch – zumindest im Augenschein - die eigene Position stärken und immunisieren, weil sich um so viel weniger Personen bereitfinden werden, argumentativ zu widersprechen. Entweder, um nicht von einer einer Medien- und Kritikerwelt, die davon lebt, Computerspieler als gleichzeitig bemitleidens- und verachtenswerte Kreaturen darzustellen, persönlich niedergemacht zu werden, oder weil sie letzten Endes, weil gebetsmühlenartig die immer gleichen unbewiesenen oder längst widerlegten Medienmythen wiederholt werden und sich ohnehin eine absolute Resistenz gegen Gegenargumente und Widerlegungen aufgebaut hat, einfach entnervt aufgeben. Der Medienkritiker wird dies aber womöglich als Sieg darstellen, seine „Argumente“ als so „gut“ darstellen, daß Niemandem mehr eine Erwiderung gelingen könne, oder daß die Gegner nach diesem „Rundumschlag“ die „Falschheit“ ihrer Position nun endlich eingesehen hätten.
5. Die sogenannte „Differenziertheit“
[...]
„Differenziertheit“ heißt für Schiffer letztlich aber auch nur, daß man neben der theoretisierten Gewaltwirkung auch andere Punkte hervorholt, für die man Computerspiele verantwortlich machen kann – durchaus sogar mit der gleichen Rhetorik wie es mit allen Medien zuvor betrieben worden war: So dürfe man sich nicht nur mit der „Mediengewalt“ beschäftigen, sondern müsse auch die „viel weitreichendere[n] Konsequenzen für die Hirn- und Gefühlsentwicklung“ bedenken (vgl. Schiffer 2008, S.69) oder daß Medien „für ständige Unruhe und Nachdenklosigkeit sorg[t]en“ (S.71), daß man also letztlich darstellen wolle, daß der Horrorszenarien, welche man dort aufgerissen hatte, noch kein Ende sei.
x. Schiffer behauptet, daß auch vermeintlich harmlose Spiele wie „die Sims-Spiele“ „[s]ubtil“ „auf die zukünftige Militärkarriere vor[bereiteten]“. Denn man könne „nur erfolgreich werden und genügend Geld für den schönen Hausbau verdienen, wenn man zum Militär geh[e]“ (vgl. Schiffer 2007, S.57). Mit Betonung auf dem „nur“ ist dies zum einen ein Irrtum: Die Karriere des Soldaten stellt eine mögliche Berufswahl dar, die der Spieler für seine Spielfigur treffen kann. Sie ist im Vergleich zu anderen möglichen Karrieren auch nicht besonders ergiebig (vgl. "The Sims" Career Track Guide, abgerufen am 25.06.2009). Zum anderen offenbart Schiffer damit aber eine radikale Ablehnung des Soldatischen überhaupt, bis dahin, daß der Beruf des Soldaten für eine Lebensgestaltung überhaupt nicht als gültige Alternative angesehen wird.
Im Abschnitt über die „Schützenverein-Lobbyisten“ hatte ich bereits meinen Eindruck von konservativen Kritikern geschildert. Nun geben sich die Kritiker des „Kölner Aufrufs“ in ihrer Ablehnung des Militärischen zunächst dezidiert links. Nun betrachte ich als Wehrdienstverweigerer selbst das Soldatische mit Bauchschmerzen. Allerdings ist auch ihnen hiermit der Gedanke gemein, die Menschen dahingehend einschränken zu wollen, was eine valide Lebensweise ist. Dabei geht es nicht darum, verbrecherische Verhaltensweisen zu verfolgen, sondern Menschen in ihren grundsätzlich legitimen Möglichkeiten (das sind diejenigen, in denen sie keinem Anderen Schaden zufügen) zu reglementieren. Zum Beispiel für einen deutschen Soldaten ist es nämlich keineswegs sicher, daß dieser im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit auf einen Menschen schießen muß.
6. Ablehnung des Wettbewerbsgedankens
Zunächst einmal ist Sabine Schiffer sehr kreativ darin, immer neue abwertende Bezeichnungen für Computerspiele eines sehr weit definierten Zuschnitts zu finden. So ist sie der Meinung, daß die von ihr formulierte Medienkritik sich letztlich auf einen Großteil der Computerspiele erstrecke, nämlich auf alle jene Spiele, in denen es darum gehe „nicht nur durch Schnelligkeit, sondern auch dadurch, dass man Hindernisse aus dem Weg räumt, die […] oft andere Figuren sind“ zu gewinnen (vgl. Schiffer 2007, S.58). Die Aufzählung beginnt damit, daß diese als „Rennspiel“ (Schiffer 2007, S.58) bezeichnet werden, geht dann über „Strategietrainer“ (S.57), „eliminatorisch-kompetitive Varianten“ (S.58), „Ballerspiel(e)“ (S.56), „Tötungstrainer“ (S.56) oder „Metzelspiele“ (Schiffer 2008, S.67) bezeichnet werden, bis hin zu der Feststellung, daß der Begriff „Killerspiele“ eigentlich noch euphemistisch sei, „da Töten niemals ein Spiel [sei]“ (Schiffer 2007, S.57). Konsequent lehnt Schiffer damit auch jeden Wettbewerbsgedanken in einem Spiel ab.
Das Argument besteht dabei aus zwei Teilen: Zum einen seien damit letztlich so gut wie alle Computerspiele gewalthaltig, zum anderen wird aber der Wettbewerbsgedanke radikal abgelehnt.
Auch in „Panorama“ war ja behauptet worden, es „geh[e] in allen Computerspielen“ „immer nur ums Töten“. Wir wollen dieses „Argument“ mit einem weiteren Blick in die Geschichte beleuchten. Nun gehörte es tatsächlich zu den „elf Geboten“ für die Spieleentwicklung, die der Hersteller Atari aufgestellt hatte, daß in jedem Spiel die Idee des Todes vorkommen müsse. Allerdings stellte man längst nicht nur solche Spiele her, in denen dies „offensichtlich“ geworden wäre, sondern eben auch Autorennspiele et cetera. Das Töten ist allerdings weniger als solches relevant, sondern es läßt sich in der Diktion von Georg Seeßlen als „semantischer Akt“ (Seeßlen und Rost 1984, S.111, zit. nach Pias 2000, S.12f.) bezeichnen. Pias führt den Gedanken fort und räsoniert, daß es dabei nicht um einen konkreten Akt oder eine konkrete Darstellung (etwa: das „Töten“ virtueller Figuren), sondern vielmehr um allgemeine Fähigkeiten wie die Reaktionszeit und Adäquanz der Reaktion geht (Pias 2000, S.11f.).
Der Wettbewerbsgedanke kennzeichnet unser ganzes Wirtschaftssystem und wird auch dort schon verfolgt, wo die künftigen „Leistungsträger“ ausgebildet werden. Notenwettbewerb ist auch bei den Hochbegabten an der Tagesordnung (vgl. "Leistung, Leistung, Leistung", abgerufen am 22.05.2009), schon Drittklässler fürchten sich, sie dürften nicht das Abitur machen, wenn sie in einem Diktat schlecht abschneiden, und müssen wegen Managerkrankheiten behandelt werden. Andererseits wird Hauptschülern heute vermittelt, die einzige Zukunftsperspektive, die sie haben, seien Dauerarbeitslosigkeit und „Hartz IV“. Wie er also Wirtschafts- und Schulsystem kennzeichnet, so auch viele unserer Spiele: Ein Beispiel hierfür ist „Monopoly“, das zum Beispiel von Niall Ferguson als geradezu symptomatisch für eine aggressiv-kapitalistische Gesellschaft angesehen wird. Das Spiel habe bereits zur Zeit der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre Erfolg gehabt, weil auch der wirtschaftlich Erfolglose immerhin noch am Küchentisch sich in wirtschaftlichen Erfolg hineinphantasieren konnte. Die Vorstellung, die in „Monopoly“ formuliert wurde, sei in der Folge in der kapitalistischen Welt zum Leitgedanken geworden (vgl. "Geschichte der Krise", abgerufen am 24.06.2009). Letztlich wurde damit ein System glorifiziert, das die Probleme überhaupt erst verursacht hatte. Aufgrund solcher Vorstellungen war auch die Einfuhr des Spiels in die DDR verboten (vgl. Wikipedia: Monopoly, abgerufen am 24.06.2009).
Letztlich ist diese Ablehnung jeglichen Wettbewerbsgedankens aber damit ebenso wenig glaubwürdig. Auch hierfür kann man zuerst einen Blick in die Geschichte bemühen: Zwar war als einziges industrialisiertes Land die damalige Sowjetunion von der Weltwirtschaftskrise unbetroffen gewesen, was bei vielen Menschen in der damaligen Zeit auch die Vorstellung nährte, daß das kommunistische Wirtschaftssystem das „bessere“ sei (vgl. unkritisch "Die allgemeine Krise des Kapitalismus", abgerufen am 24.06.2009), und konnten auch in anderen Ländern die Folgen nur durch staatliche Eingriffe (vgl. Roosevelts „New Deal“ in den USA oder die Wirtschaftspolitik der Nazis) angegriffen werden, bevor der zweite Weltkrieg mit seinen dratischen Produktionssteigerungen vor allem von Kriegsgütern einen neuen Wirtschaftsaufschwung einleitete. Die Wirtschaftssysteme insbesondere der diktatorischen Staaten konnten allerdings auch nur durch Tricks funktionieren: So wurde in Nazideutschland etwa viel mechanische Arbeit auf manuelle Arbeit umgestellt, wurden die Arbeitsbeschaffungsprogramme, die etwa im Aufbau der Autobahnen bestanden, weitgehend mit Schulden (in Form sog. „Mefo-Wechsel“) finanziert, bei denen man darauf hoffte, sie mit den Erträgen aus den während des von Anfang an fest eingeplanten Krieges eroberten oder anderweitig annektierten Gebieten, anfangen mit Österreich, und mit von den Juden geplünderten Werten decken zu können. Auch die kommunistische Wirtschaftspolitik mußte sich mit Tricks behelfen, wie etwa einer Mißachtung des Arbeitsschutzes, Druck auf die Beschäftigten, massiver Repression, Zwangsarbeit, Hungersnöten (vgl. "Sowjetunion 1921-1939 - von Lenin zu Stalin", abgerufen am 24.06.2009). Letztlich hatten auch diese Systeme also nur Augenwischerei betrieben, keine Antwort geliefert oder war sogar gefährlich gewesen.
Auch die ganze Sprache ist doch durchsetzt von aggressiven Gedanken: Wenn jemand etwas durchsetzen will, dann heißt es, sie oder er „kämpfe“ dafür. Der Begriff des Kampfes impliziert aber, daß es eine „Gegnerschaft“ gibt – eine „Opposition“. Dabei geht es all zu oft nicht um „Überzeugung“, sondern vielmehr darum, den Gegner mit rhetorischen Tricks zu überfahren, auf die er nicht wechseln kann oder ihn zu marginalisieren, ihn zu „ächten“, d.h. auf eine bestimmte Art zu vernichten, nämlich „gesellschaftlich unmöglich“ zu machen. Auch die „demokratische Kultur“ ist also auf Kampf und eine gewisse Art der Vernichtung ausgerichtet.
7. Ihrer Meinung nach - zum Beispiel in Anlehnung an die Haltung von Manfred Spitzer - handelt es sich bei Computerspielen um gefährliche Drogen. Da es zum Beispiel auch beim Alkohol nicht Praxis sei, Jugendlichen Alkohol vorzusetzen, um ihnen einen "verantwortlichen Umgang" damit beizubringen, sei es eben auch nicht sinnführend, eine "Medienkompetenz" zu vermitteln (vgl. Schiffer 2008, S.). Nun hatte man Befunde zur "Computersucht" primär auch von Personen und Institutionen gehört, die bereits hinreichend als medienkritisch bekannt waren. Nehmen wir allerdings einmal grundsätzlich an, daß es möglich sei, "Computer(spiele)sucht" als eine Impulsstörung wie die (gleichfalls nicht in diagnostischen Manuals erscheinende) Glücksspielsucht festzustellen. Dann stellt sich allerdings die Frage, warum a. Alkohol nicht verboten ist, nachdem dieser doch als ein gefährliches Suchtmittel bekannt ist, der zu Autounfällen mit mehr als tausend Toten jährlich und nicht zuletzt auch zu Gewalttaten beiträgt, und b. ob es überhaupt Sinn ergeben kann, alles zu verbieten, wonach man süchtig werden könnte. Ein Beispiel hierfür ist etwa die "Kaufsucht".
8. Warum beurteilt man Computerspiele eigentlich anders als andere Spiele -- oder am Ende gar: die Realität?
Mir in dem Zusammenhang augenfällig war mir, daß Schiffer zwar die von ihr so getauften „eliminatorisch-kompetitiven“ Spiele ablehnt (vgl. Schiffer 2007, S.58), andererseits aber Spiele wie Monopoly nicht weiter kritisiert (vgl. Schiffer 2008, S.69). Dabei hatten jedoch .
Daraus ergeben sich daraus ganz andere Fragen: Warum macht man überhaupt Unterschiede zwischen Computerspielen und Nicht-Computerspielen? Wenn Spiele doch nur für Kinder und Jugendliche gedacht sind, um damit irgendwelche pädagogischen Zwecke zu verfolgen, warum spielen dann auch Erwachsene Fußball oder Schafkopf? Und was genau ist deren Zweck? Wenn man das Weltbild des „Kölner Aufrufs“ an Fußball anlegte, müßte die Antwort wohl lauten, daß man lernen könne, wie man einen Ball auf einer Wiese hin- und herschiebt. Tatsächlich aber soll man dabei irgendwie geartete strategische Fähigkeiten, Teamarbeit und ähnliche Dinge erleben, die sich im Leben in anderen Kontexten einsetzen lassen. Dies können so Dinge wie Koordination (vgl. ), Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit, Urteilsfähigkeit, Geduld bei der Durchdringung mitunter auch komplexer Kausalstrukturen (vgl. Pias 2000, S.4) und damit letztlich auch Weitsicht sein. Allein schon der Verweis auf die Geduld führt eigentlich auch Schiffers „Argumentation“ ad absurdum, daß Computerspieler ja Menschen seien, die nicht auf lange Sicht planen könnten. Pias (2000) geht dabei sogar soweit, daß Computerspiele nicht von ernsthaften Anwendungen zu unterscheiden seien und ganz ähnliche Erfahrungen vermitteln müßten: „Action“ sei demnach die Benutzung von Rechnern „an sich“, „Adventure“ die Navigation zum Beispiel in Datenbanken, und „Strategie“ bestehe beispielsweise in der Konfiguration oder der Erfassung von Daten (vgl. Pias 2000, S.6).
Eine andere Frage ist eben, ob nicht ein Großteil aller Spiele daraus ausgerichtet ist, den Gegner tatsächlich zu besiegen? Wenn man schon den Wettbewerbsgedanken so rundweg ablehnt, müßte man ja auch nämlichen Fußball verbieten. Denn auch dort geht es nicht darum, irgendeine abstrakte philosophische Selbsterkenntnis zu erlangen, sondern es geht um den Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb wird in dieser Gesellschaft schließlich nicht etwa abgebaut, sondern mehr oder weniger prominente Vertreter fordern, beklagen, daß „der Leistungsbegriff in den letzten 30 Jahren doch so ein bisschen untergegangen“ sei (Zitat: Peter Hattig in Schmies+Baltes 2009, S.15), und fordern entsprechend, diesen weiter auszubauen.
Selbst beim Boxen oder Fechten wird schließlich akzeptiert, daß Schläge und Hiebe, die gegen den Gegner gerichtet sind, „anders gemeint“ sind. Die Kontrahenten scheinen in der Regel zu akzeptieren, daß man sich außerhalb des Rings nicht für Schläge rächt, die man im Ring erfahren hat, weil diese nicht darauf ausgerichtet sind, das Gegenüber in seiner Existenz in der Realität zu beschädigen. Warum sollen diese bei Computerspielen anders bewertet werden, zumal die Blessuren auch noch deutlich geringer sind?
Letztlich scheinen wir es also hier mit einer prinzipiellen Ablehnung zu tun zu haben, die letztlich keine Argumente braucht.
9. Bizarre Querfront?
Schiffer ist natürlich „friedensbewegt“, kritisiert propagandistische Darstellungen über Kriege, was deren Rechtfertigungen (von den „Menschenrechten“ bis zur „Verteidigung Deutschlands am Hindukusch“), Bewertung („Friedenseinsatz“/“kriegsähnlicher Konflikt“) und Führung („Kollateralschäden“) angeht (vgl. Schiffer 2009). Um so interessanter ist, daß sie sich in ihrer Ablehnung von (nicht nur ausschließlich gewalthaltigen) Computerspielen in einer bizarren „Querfront“ mit frenetischen Befürwortern und Wiederholern oder gar erst Erfindern solcher Kriegspropaganda wiederfindet. (So zeichnete der „Kontraste“-Autor Steffen Meyer sowohl für Berichte verantwortlich, in denen eine Ausweitung der deutschen Militärpräsenz in Afghanistan gefordert wurde – auch mit Bildern und Erklärungen, wie böse die Taliban seien -, wie auch für einen Bericht, in dem Computerspiele als „Gebrauchsanleitung für den Amoklauf“ dargestellt wurden.)
Tatsächlich geht es aber dabei nicht so sehr um die Ablehnung von Propaganda als solcher, sondern um die Erkennung von deren Mustern und die Anwendung für die eigenen Zwecke. Dabei begibt sie sich allerdings auf schmales Gesimse – wenn sie etwa räsoniert, daß die „Atombombe in den Händen eines Mullahs“ auch nicht gefährlicher sein könne als in den Händen der USA (immerhin des einzigen Staates, der Atombomben im „Friedenseinsatz“ eingesetzt hatte, um damit Menschen zu töten), oder daß man „aus Gründen neuer Kleidungsvorschriften“ keine Militäreinsätze tolerieren dürfe (vgl. Schiffer 2009, S.4). Was wäre etwa mit Judensternen? Die Antisemitismus-Keule erschlägt nun beileibe alles, und einem Menschen, dem sie anhaftet, wird man nicht mehr glauben. Und genauso falsch ist es, jemanden aufgrund bestimmter Äußerungen mit Spott und Hohn zu überhäufen.
In der Medienkritik wurde aber eine „Computerspiel“-Keule erfunden. Nun berichten Computerspieler mittlerweile von Absonderlichkeiten, daß selbst wer seinen eigenen Eltern von seinem Hobby berichte, gleich mit dem Verdacht konfrontiert werde, auch Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu mißbrauchen, sich Kinderpornos anzusehen oder einen Amoklauf vorzubereiten. Dazu haben insbesondere die Medienkritiker beigetragen.
2.1.14.2 Else Ostbomk-Fischer
[…]
2.1.14.3 Reiner Fromm
Reiner Fromm, seines Zeichens Macher etlicher medienkritischer Berichte etwa im ZDF-Magazin „Frontal 21“, findet in der Betrachtung separate Berücksichtigung wegen eines Interviews, das trotz oder gerade wegen seiner Kürze meiner Meinung nach seine Denkhaltung und Argumentationsbasis deutlich illustriert. .
2.1.14 Klaus Miehling
Im selben „Nachrichtenbrief Nr.51" zitierte Miehling einen Bericht, nach dem ein junger Mann einem Forscher versichert habe, sein „Niedergang“ habe begonnen, als er im Alter von 12 Jahren angefangen habe, sich Musik von Barry Manilow anzuhören. Dies führe „zwangsläufig zu härterer Musik, Drogen, Alkohol und Gewalt“. Selbst wenn an Miehlings Pauschalkritik etwas dran sein sollte, dürfte er sich durch solche vermeintliche "Beweise" für die Gefährlichkeit moderner Musik höchstens lächerlich machen. Auch dies ein Beweis dafür, daß es Miehling eigentlich darum zu gehen scheint, eine universale Kritik an aller nicht-klassischen Musik zu formulieren.
Neben dieser Universalkritik dehnt Miehling seine Schelte auch auf das Internet aus. So hatte er aus einer Studie, die im Auftrag des des britischen Lobbyverbandes British Musical Rights (BMR), nach der seiner Angabe nach 96% der Jugendlichen sich illegal Musik zu kopieren oder aus dem Netz herunterzuladen. Daraus folgerte er, daß alle (jugendlichen) Internetnutzer kriminell seien (vgl. „Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr.54“ vom 20.02.2009).
Auch waren 80% derjenigen, die sich Musik illegal per kostenlosem Download besorgt hatten, bereit, für Musikdownloads zu bezahlen, wenn es zum Beispiel ein abonnement-basiertes System im Sinne einer "Musik-Flatrate" gebe. Auch beurteilt der Vorsitzende von "British Music Rights" es anscheinend bereits als illegal, Musik aus dem Radio mit einem analogen Gerät mitzuschneiden (vgl. "Average teenager's iPod has 800 illegal music tracks", "Study: digital music piracy is rampant among teens", abgerufen am 14.03.2009).
Im übrigen noch eine interessante Zahl, die sinnigerweise sogar von dem Medienkritiker Christian Pfeiffer höchst selbst hinterbracht wurde: So hatten 100% der Jurastudenten bei einer Befragung angegeben, sie hätten schon einmal Taten begangen, die streng genommen justiziabel seien. Meistens sind dies allerdings „läßliche Sünden“ (BR-Online 2009, S.13f.).
Wenn nun Jugendliche sich aber in diesem großen Anteil illegal Musik besorgen, könnte sich hierbei tatsächlich eine „Umwertung“ anbahnen...
Allerdings hören damit die Ressentiments auch nicht auf. In seinem „Nachrichtenbrief“ Nr. 64 vom 09.05.2009 kommentierte Miehling entgeistert darüber, daß in Parks in Amsterdam in Zukunft Schilder aufgestellt werden sollten, die homosexuelle Männer darauf hinwiesen, wo sie Sexpartner finden könnten. Darüber hinaus problematisierte er dabei auch die potentielle Erklärungsnot von Eltern auf Fragen ihrer Kinder. Er konstruierte daraufhin ein Szenario, daß eine Mutter zur Antwort geben könnte, dort könne man „Spaß haben“. Und sollte dieses Kind dies falsch verstehen und einen Mann, der sich dort aufhält, zu bitten, es wolle „Spaß haben“, würde dann auch sogleich einer der Männer mit ihm hinter einen Baum gehen... Dieses Problem hat offenbar verschiedene Ebenen: Gehen wir davon aus, daß derartige Orte zumindest unter Homosexuellen, die in der „Szene“ aktiv sind, hinreichend bekannt sind und nicht ausgeschildert werden müßten. Aber hier läßt sich sicherlich auch die Erklärungsnot von Eltern thematisieren. Und schließlich kann Miehling womöglich Homosexualität und Pädophilie auch nicht voneinander unterscheiden.
2.1.15 Gabriele Kuby und andere religiöse Kritiker
Weltanschauung: Mir gefällt etwas nicht, also darf es auch kein Anderer machen, selbst wenn er mich damit überhaupt nicht stört. Ein Anderer verhält sich nur dann tolerant, wenn er alles mitmacht, was ich ihm vorlebe. Wenn ein Anderer also etwas anders macht als ich, dann nötigt er mich damit, ebenso zu handeln.
[Ich bräuchte schon eine Reflexion darüber]
Life in Lubbock, Texas, taught me two things:
One is that God loves you and you’re going to burn in hell.
The other is that sex is the most awful, filthy thing on earth and
you should save it for someone you love.
(Butch Hancock)
Gabriele Kuby kritisiert nicht explizit Computerspiele. Allerdings sieht sie den modernen Menschen als Opfer einer breitangelegten Verschwörung des Satans, dessen Ziel des sei, den Menschen von seiner vermeintlich natürlichen Verfassung abzubringen. Um diese zu konstruieren, greift Kuby insbesondere auf "gut-katholische" Auffassungen zurück, die zum Beispiel mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu viel zu tun haben und ihr eigenes Weltbild ad absurdum führen. -->
2.1.14.1. Der Mensch als "Opfer des Satans"
[...]
2.1.14.1.1 "Ehe und Familie"
So sieht Kuby das sogenannte "Gender Mainstreaming" als "Strategie der UN, der EU und der Einzelstaaten, Deutschland an vorderster Front", "[d]ie Geschlechterdifferenzierung von Mann und Frau und die Heterosexualität als Norm" aufzuheben, und sieht darin die Ursache für den Leistungsabfall der Kinder in der Schule und für die herrschende Gewalt unter Jugendlichen. Kuby äußert daneben die Vorstellung, der Mensch, der seine Sexualität auslebe, unterwerfe sich der "eigenen Triebhaftigkeit". Der Sexualkundeunterricht sei ein Versuch von Staat und "Homoszene", Kinder und Jugendliche zu "Homosexualität und Bisexualität und Transsexualität" zu verführen (vgl. http://gabriele-kuby.de/brennpunkt.html; abgerufen am 09.10.2007). Kuby sieht ansonsten Jugendzeitschriften wie "Bravo" als "Pornoblätter" an, die zu "verbrauchende[r] Sexualität" trieben (vgl. http://aktion-leben.de/sexualitaet/Ehe%20und%20Familie/sld03.htm; abgerufen am 09.10.2007). Die Vorstellungen von Verfechtern kirchlicher Sexualmoral (vgl. etwa "Why the Orthodox Church is the Best", Wikipedia: Verhaltenskodex der Bob Jones University, abgerufen am 17.09.2008) sind dabei kaum mehr von der Satire (vgl. "Is Your Child a Godless Goth?" auf landoverbaptist.net, einer bekannten Satireseite, abgerufen am 17.09.2008) zu unterscheiden.
Nur daß man nicht zur Sexualität "verführt" werden kann: Untersuchungen haben längst aufgezeigt, daß Kinder, denen ein vernünftiger Sexualkundeunterricht erteilt wird, kaum früher sexuell aktiv werden als jene Kinder, denen im wesentlichen mit christlichen Parolen, die zum Beispiel einzig und allein Keuschheit bis zur Ehe als effektive Verhütungsmethode darstellen (vgl. dazu Schleifer et al. 2002), wohl aber andererseits eine deutlich niedrigere Rate an sexuell übertragbaren Krankheiten, ungewollten Schwangerschaften und Abtreibungen aufweisen. So sind die Raten von Schwangerschaftsabbrüchen und Ansteckungen mit sexuell übertragbaren Krankheiten pro Einwohnerzahl speziell dort, wo großflächig keine wahrhaftige Sexualerziehung stattfindet (etwa im US-Bundesstaat Texas, vgl. Human Rights Watch 2002), teilweise um Größenordnungen höher als in Ländern, wo im Rahmen des Sexualkundeunterrichts Verhütungsmittel als der Realität entsprechend einigermaßen wirksamer Schutz dargestellt werden (vgl. "The Failure of Abstinency Only Sex Education", abgerufen am 17.09.2008). Dies spricht dafür, daß eine "Sexualerziehung auf christlicher Grundlage" genau das Gegenteil von dem erreicht, was dort als Ziel propagiert wird. (Wenn man aber dermaßen dysfunktional handelt, liegt zumindest der Verdacht nahe, daß in fundamental-christlicher Vorstellung auch die Sexualmoral der von früheren Zeiten entsprechen soll. In früheren Zeiten waren Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes im Schnitt deutlich jünger und gebaren deutlich mehr Kinder als heute.) Auch Kinder, denen z.B. Homosexualität jahrelang durch ein gleichgeschlechtliches Elternpaar "vorgelebt" wurde, werden später nicht häufiger homosexuell als Kinder mit gegengeschlechtlichen Eltern (vgl. Eggen 2006). Bei solchen Kritiken schwingt insbesondere die fundamental-christliche und katholische Vorstellung mit, Dinge wie Verhütung - über die man im Sexualkundeunterricht erfährt - oder Sexualität an sich, die nicht in einer heterosexuellen Ehe erfolgt, seien "schwer sündhaft". Selbst die Ehepartner sind nach dem Katechismus der katholischen Kirche (KKK) zur "ehelichen Keuschheit" gerufen (vgl. KKK §). Insbesondere weicht aber die katholische Kritik etwa an der Homosexualität von der eigenen Vorstellung ab, den Menschen "ganzheitlich" zu betrachten (vgl. ), eben weil diese den Menschen, der sich vermeintlich "von der Norm abweichend" oder "gestört" verhält, auf gerade diese Abweichung reduziert und nicht mehr die Persönlichkeit oder die Fähigkeiten des Menschen betrachtet. Dies geht sogar bis dahin, daß etwa der "christliche Erziehungsratgeber" John Harvey Eltern rät, ihre Kinder nach den "klassischen Rollenbildern" zu erziehen bzw. "gefährliche" Hobbies und den Umgang mit "Außenseitern" und Einzelgängern zu verbieten, die sie zur Homosexualität verführen könnten (vgl. "Recognizing and treating same-sex attractions in children", abgerufen am 15.09.2008), und sie im katholischen Sinne zu indoktrinieren, daß ihre Neigungen krankhaft seien. Harvey sieht den Umstand, daß es keine definitiven Aussagen über die letztlichen Ursachen der Homosexualität gibt, als Beweis für die Korrektheit der Vorstellung an, man suche sich Homosexualität aus (vgl. "Familiäres Umfeld mitverantwortlich für homosexuelle Neigungen" (meint John Harvey); vgl. "Pastorale Begleitung von Personen mit homosexuellen Neigungen", abgerufen am 16.09.2008).
Nur wird sich kein Mensch eine Empfindungs- und Lebensweise auswählen, die noch immer in weiten Teilen der Welt zu Ausgrenzung und Verfolgung führt. Christen dementieren ja z.B. selbst auch, daß sie ihre Weltanschauung und Lebensweise wechseln könnten, für die sie noch in einigen Regionen der Welt verfolgt werden, oder sind ggf. der Meinung, daß Menschen "von Geburt an Christen" seien ("Ökumenischer Brief über Evangelisation", abgerufen am 18.09.2008). Gerade sie sollten also selbst wissen, . Daneben entsteht sexuelle Gewalt sinnigerweise viel eher in einem sexuell repressiven Umfeld, und Sexualtäter sehen sexuelle Handlungen eher als moralisch verwerflich an (vgl. Kutchinsky 1992, S.44).
Zum anderen stellen Blätter wie "Bravo" viel eher den Zeitgeist dar als daß sie diesen selbst prägen. Besonders gut nachzuvollziehen ist dies etwa an den Kolumnen der "Sexualberater": Beiträge des ersten Beraters "Dr.Vollmer" (Pseudonym der Trivialautorin Marie-Louise Fischer), in denen Selbstbefriedigung und Homosexualität als krankhaft bezeichnet wurden, waren doch viel eher von der repressiven Sexualmoral der Adenauer-Zeit geprägt (vgl. Schleich 2006). Und welche Antworten sollte man von Gabriele Kuby erwarten? So wurde "Bravo" letztlich zu dem Ansprechpartner, an den sich Jugendliche mit ihren Fragen wenden konnten, die sie zuhause oder dem Lehrer nicht stellen konnten. Jedenfalls erscheint es nicht sinnvoll, Jugendliche damit alleinzulassen oder sie mit klerikalen Sprüchen abzuspeisen.
In einer weiteren Einlassung geißelt Kuby Verhaltensweisen und Gesetzen, die ihrer Meinung nach "den Missbrauch der menschlichen Geschlechtlichkeit zur gesellschaftlichen Norm erheben". Darunter versteht sie etwa die Zulassung von Verhütungsmitteln, der Abtreibung, die Anerkennung von Prostitution als Beruf, von Verbesserungen der rechtlichen Stellung von Homosexuellen in der Gesellschaft oder auch die Sterbehilfe. Einmal mehr sieht Kuby einen "direkten Pfad" (vgl. hier und im folgenden http://aktion-leben.de/sexualitaet/Ehe%20und%20Familie/sld03.htm; abgerufen am 09.10.2007).
Sie stellt all jene Dinge, die etwa Gerechtigkeit herstellen oder Menschen in Not helfen sollen, stets als Zwang dar, der auf sie ausgeübt würde, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen.
2.1.14.1.2 Argumentationsmuster in kirchlichen Äußerungen in Schule und Öffentlichkeit
Zuletzt versteigt sich Kuby bezüglich der Sterbehilfe zu der Aussage, "[a]lte Menschen [würden] getötet, wenn sie nicht mehr arbeiten [könnten]". Den Beweis für diese Behauptung bleibt sie freilich schuldig.
Andererseits aber muß sie das auch nicht. Diese Äußerung ist so gewaltig, daß sie trotz ihrer Haltlosigkeit in den Köpfen verbleibt. Allein schon der Vorwurf reicht ja schon aus, und der solcherart zum "Feind" Erklärte kann rein gar nichts tun, um sich dagegen noch zu verteidigen. Zumindest ist anscheinend so die Denkweise, die da hintersteht. Damit liegt sie in einer Linie von ähnlichen polemischen Äußerungen, mit denen - nicht nur kirchliche Würdenträger - gedanklich gesehen bis aufs Blut reizen und Haß provozieren wollten. Sehr häufig bedient man sich auch eines Argumentationsmusters, das als "Strohmann" bezeichnet wird: Um hier die Position eines Gegners vermeintlich zu widerlegen, unterstellt man diesem Aussagen, die dieser gar nicht getroffen hat, widerlegt diese oder unterschiebt gleich Aussagen, die sich selbst diskreditieren.
Man mag argumentieren, Anwendungen dieser Techniken seien Einzelfälle. Diese Äußerungen finden sich aber bei zum einen sehr häufig bei denjenigen Vertretern kirchlicher Lehren, die medienpräsent sind, zum anderen aber auch in Konzeptionen für den Religionsunterricht, mit denen nicht nur Glaube gerechtfertigt, sondern auch anderer Glaube (oder in dem Falle des unten genannten Beispiels) Nichtglaube oder seine Träger als
(i) inadäquat -- So behauptete der "Legionär Christi" Thomas Williams, noch nie hätten Menschen Suchtkrankheiten überwunden oder hätten aufgehört, ihre Ehepartner zu betrügen, "weil sie den Atheismus entdeckt haben"; vgl. "Antworten auf die Religionskritik von Atheisten", abgerufen am 16.09.2008. Damit zeigt er allerdings auf, daß Religionen für Atheisten nicht bloß nicht die richtigen Antworten liefern, sondern ggf. auch nicht die richtigen Fragen stellen. So macht der Begriff der "Sünde" in seiner religiösen Interpretation für einen Atheisten keinen Sinn. Weiterhin wäre auch die Frage, in wieweit das Angehen gegen Alkoholismus etwas mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Atheisten, die sich mit tief gläubigen Menschen auseinandergesetzt haben, berichten manchmal davon, diese wirkten ebenfalls die Drogensüchtige, die nur ihren Gott anstelle zum Beispiel des Alkohols bräuchten (vgl. ). Entspricht dies der Wahrheit, so hätte man die Sucht in Wahrheit nicht bekämpft, sondern nur gegen eine andere Sucht ersetzt.
(ii) böswillig -- So bezeichnete Kuby Anders(nicht)gläubige als "Feinde"; Williams, "die Atheisten stütz[t]en sich eher auf Lügen als auf rationale Argumente", oder befürworteten, Menschen, die an bestimmte religiöse Sachverhalte glauben, zu töten; Kuby und Williams jeweils, Atheisten würden Menschen "indoktrinieren" oder "(zur Sünde) verführen"). In den USA kam es weiterhin schon vor, daß Unternehmen Atheisten diskriminieren und Politiker behaupten, Atheisten hätten eine niedrigere Moral als Gläubige, hätten kein Recht auf öffentliches Gehör und auf politische Vertretung (vgl. "Elizabeth Dole's Anti-Atheist Senate Campaign", abgerufen am 05.11.2008).
Es gilt heutzutage nun zu Recht als entsetzlich, z.B. Juden oder Schwarze auf diese Art anzugreifen, erscheint es andererseits aber fast hoffähig, dies mit Atheisten zu versuchen. So stürzte der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann über eine Rede, in der er -- auch mit Hilfe eines antisemitischen Textes von Henry Ford -- eine krude Argumentation konstruiert hatte, die ihm den Vorwurf einbrachte, die Juden im Zusammenhang mit dem bolschewistischen Terror als "Tätervolk" bezeichnet zu haben. Im nächsten Satz hatte er diese Aussage freilich zurückgenommen, und dann aber "die Gottlosen mit ihren gottlosen Ideologien" als ein solches "Tätervolk" bezeichnet. Allerdings schlug der Vorwurf des Antisemitismus angesichts der Geschichte bedeutend höhere Wellen als sein Versuch, den Atheisten die Verantwortung für faschistischen und kommunistischen Terror zu geben (Wikipedia: Martin Hohmann, abgerufen am 05.11.2008). Ähnlich hatte sich auch schon Joachim Meisner geäußert, Menschen, die nicht an einen (insbesondere den christlichen) Gott glauben, seien "Genossen des Antichrist" und "brutale Bestien" (vgl. "Menschlichkeit ohne Gottesglauben verkommt in Brutalität", abgerufen am 05.11.2008). Gerichte leisteten zumindest insofern Rückendeckung für derartige Tiraden, als eine Klage gegen Meisner mit der Begründung abschläg beschieden wurde, daß es sich bei Atheisten nicht um eine schützenswerte Gruppe handle (). Atheisten, die sich gegen derartige Einlassungen wehren, werden schließlich regelmäßig , ja Christen wähnen sich sogar regelrecht durch böse Atheisten verfolgt, die zum Beispiel nicht wollen, daß der christliche Schöpfungsmythos auf einmal im Biologieunterricht gelehrt wird ("Die westliche Christenverfolgung beginnt", abgerufen am 05.11.2008) oder im Religionsunterricht unter 14jährige qua "Religionsunmündigkeit", d.h. deswegen, weil ihre Eltern dies beschlossen haben, durch "spirituelles Erleben" zu der spezifischen Religion hinmissioniert werden (vgl. zu diesem Anspruch Scharer 2000).
(iii) schließlich auch als dumm diskreditiert werden soll.
Andererseits verbreiten Politiker und Nutznießer auch Fehlinformationen über den Nutzen oder die Rolle des Glaubens. So meinte Williams, schließlich hätte die christliche Kirche und hätten nicht die Atheisten Einrichtungen wie Waisen- oder Krankenhäuser gegründet. Allerdings rekurriert er hier auf eine Zeit, als es ggf. sogar ausgesprochen gefährlich war, seinen Unglauben zu gestehen. Betrachten wir ansonsten den Fall des heutigen Deutschlands, so täuscht der Eindruck, die Kirche unterhalte unter ihrem Dach aus eigener Tasche viele soziale Einrichtungen. Der Anteil der Kirche an der Aufbringung der Kosten für "kirchliche" Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen etc. zwischen 2.5 und 5 Prozent liegt, daß also der größte Teil der Kosten vom Steuerzahler aufgebracht wird, ganz unabhängig von seiner Religion.
Schließlich ein drittes Beispiel für solche Fehlinformationen ist die Behauptung von Ursula von der Leyen, das deutsche Grundgesetz subsumiere die zehn Gebote. In einem Kommentar schrieb dazu der Michael Schmidt-Salomon, daß von der Leyen dann offenbar entweder das Grundgesetz oder die zehn Gebote nicht kenne. Denn folgte die Verfassung tatsächlich den zehn Geboten, bestünde keine Religionsfreiheit (allerdings schreiben viele Verfassungen und Gesetze tatsächlich als Erziehungsziel die „Ehrfurcht vor Gott“ vor, so als gäbe es nicht das Recht auf ein Leben ohne Glaube an einen Gott) und würden Frauen mehr oder weniger als Besitz ihrer männlichen Verwandten angesehen. Von anderen Konsequenzen einer wahrhaftig christlichen Gesetzgebung noch gar nicht zu sprechen (vgl. Schmidt-Salomon 2009). Auch dies womöglich ein grundsätzliches Problem, nämlich die Unkenntnis über die Inhalte der eigenen Religion, die nach Auffassung einiger ihrer Kritiker (vgl. etwa Buggle) kaum mit unserem heutigen Verständnis zum Beispiel von den Menschenrechten in Einklang zu bringen sind.
Vielfach ist es auch einfach Mode, gängige Klischees über Atheisten immer wieder anzubringen und sie als Bedrohung für die Gesellschaft darzustellen:
(i) (Buswerbung „God probably does not exist“) (vgl. „Kulturkampf in Großbritannien? Sekularisten (sic!) gegen in die Offensive“ (Audio), in: „Kultur heute“, DLF, 03.02.2009).
Nun ist es sicher übertrieben, eine Krankenschwester zu einem „Diversitätskurs“ zu schicken, weil sie einer 79jährigen Atheistin angeboten hatte, mit ihr zu beten. Nun allerdings Atheisten und Andersgläubigen, die auch um die Berücksichtigung ihrer Rechte, um ihre Anerkennung als Weltanschauung gekämpft haben, „Haß auf prägende kulturelle Traditonen“ zu unterstellen, halte ich für perfide. Nicht nur waren andere Weltanschauungen in diesen wunderbaren Traditionen jahrhundertelang bekämpft worden. (Und wenn man mit diesen Traditionen und Wertvorstellungen das Bild einer demokratischen und menschenrechtlichen Gesellschaft gesehen hatte, ist es gleich doppelt perfide, nämlich Menschen, die eben dafür kämpfen, als Feinde eben dieser Werte darzustellen.)
Sondern auch heute nutzen Kirchenvertreter und konservative Christen öffentliche Foren, um Andersgläubigen unter die Nase zu reiben, daß sie angeblich nicht „in der Wahrheit leben“, „Gottesleugner“ seien (vgl. "Anti-Gott-Kommandos" an britischen Hochschulen, abgerufen am 25.02.2009 – mit dem Begriff versuchen sie ja zu implizieren, daß, vergleiche den Begriff des „Holocaustleugners“, die Existenz eines – nämlich mit Exklusivität des christlichen – Gottes zweifelsfrei erwiesen sei und Menschen nur in geradezu verbrecherischer Selbstgerechtigkeit dies nicht anerkennen könnten), kein Recht auf gleichberechtige Anerkennung hätten (so erklärte die römisch-katholische Kirche auch bei neulichen Gelegenheiten, daß es sich bei protestantischen Kirchen nicht um „Kirchen“ handle), daß schließlich Mitglieder dieser Anschauungen oder Nichtmitglieder ihrer eigenen für alle Übel in der Welt verantwortlich seien – bis hin zur ultimativen Keule, der Zuweisung der Verantwortung für den Holocaust an den Juden während der NS-Zeit, die z.B. der damalige CDU-Politiker Martin Hohmann getroffen hatte (vgl. Wikipedia: Martin Hohmann, abgerufen am 09.02.2009). Noch heute werden grausame und unverständliche Taten mitunter als „gottlos“ bezeichnet. Immer wieder erhalten Menschen dann auch die gerichtliche Bestätigung, daß derartige Äußerungen nicht beleidigend oder das (Nicht-)Bekenntnis von Atheisten verächtlich machend seien, weil es sich bei Atheisten – absehen von dem fehlenden Glauben an einen Gott – nicht um eine Gruppe mit einer hinreichend einheitlichen Weltanschauung handle ().
Nun ist allerdings schwer nachzuvollziehen, wie eine Beschriftung „Gott existiert womöglich nicht“ von Christen als „Angriff auf ihre Gefühle“ gedeutet werden können. Schließlich fühle ich mich auch nicht von Kirchenglocken, die am Sonntag läuten, oder von Werbeblättern und -tafeln wie „Jesus Christus auch für Dich“, die auch in Deutschland in Briefkästen wandern, an Plakatwänden oder an den Außenwänden von Andachtsräumen prangen, bedroht.
(ii) Ein weiteres Beispiel dazu ist etwa eine Kritik von Tom Goeller über Neuerscheinungen, die sich mit Leben und Werk des Naturforschers Charles Darwin befaßte. So sind heute anscheinend viele Menschen überzeugt, Atheisten könnten keine moralischen Werte haben, werden Sterbehilfe, Abtreibung etc. als vermeintlich atheistische Anliegen dargestellt und in den Kontext von Programmen zur „Höherzüchtung“ der Menschheit.gestellt, wie sie etwa von den Nazis propagiert wurden, damit gedanklich vermeintliche „ideologische Vordenker“ des Atheismus auch in deren Nähe gerückt und damit – wiederum ebenso vermeintlich - „entlarvt“ (vgl. "Vom Pantoffeltierchen bis zum Menschen", in „Andruck“, DLF, 09.02.2009).
Allerdings eben auch längst nicht, sondern existierten sog. „eugenische“ Programme, bei denen zum Beispiel Behinderte oder psychisch Kranke auch gegen ihren Willen sterilisiert wurden, auch in durchaus demokratischen Ländern. Die Kritik der Kirche an solchen Programmen war nicht etwa, daß man Menschen nicht gegen ihren Willen.
Wer sich aber nicht anderweitig informiert - und wer tut
das zum Beispiel als Jugendlicher über ein Thema, über
das er zuvor nicht groß nachgedacht hat? - erhält man
hier bloß einseitige Informationen. Zu einer echten
Gewissensentscheidung, einem "Ja zum Glauben" gehört
allerdings auch eine adäquate Information über, welche
Inhalte andere Glaubens- oder auch "Nichtglaubens"-Systeme
haben. Mir ist nat¨rlich klar, daß die
römisch-katholische Kirche die festgefügte Vorstellung
hat, daß alle, die sich nicht in ihr befinden und ihren
Moralvorstellungen folgen, - wie es in der Bibel so schön
heißt - "verworfen" sind. Dann kann sie allerdings
auch nicht erwarten, daß ihre Anhänger "loyal"
bei der Sache sind, sondern nur aus der Furcht heraus, sie könnten
nach ihrem Tod "verdammt" werden.
2.1.14.1.2.1 "Was glauben die, die Gott, den Schöpfer, ablehnen?"
„Interessant übrigens, daß A-Theisten
angeblich Gottesleugner sein sollen, A-Sexuelle aber nicht
entsprechend Sexualleugner sind, sondern Menschen ohne sexuelles
Verlangen.“ (Kommentar
einer Nutzerin im „Freigeisterhaus“, 19.04.2005
(Link))
In
einer Unterrichtskonzeption von Josef Bürger zum Thema "Was
glauben die, die Gott, den Schöpfer, ablehnen?" heißt
es etwa (in dem Sinne noch korrekt, natürlich über die
Sichtweise hinaus, daß es keine Götter gebe) daß
es keine offizielle Instanz gebe, die die Weltsicht des Atheismus
festlegen würde. Daraus wird (aus meiner Sicht illegitim) nun
aber gefolgert, es sei daher sinnvoll, sich irgendeine Sicht
herauszupicken, etwa die der DDR (vgl. Bürger 2006, S.1).
Damit wird letztlich wieder unterstellt, daß Atheisten der
DDR-offiziellen Weltsicht des "dialektischen Materialismus"
(auch: "Diamat", vgl. ebd. S.2) anhingen. Mit etwaigen
Widerlegungen wird dann aber nicht der Atheismus getroffen,
sondern lediglich diese Weltsicht. Eigentlich wäre damit die
Diskussion über den Unterrichtstext bereits erledigt. Jedoch
werden dort einige Konstruktionen gemacht, die aus meiner Sicht
problematisiert werden müssen:
(a) In der Unterrichtskonzeption wird hier eine wissenschaftliche Weltsicht ihrerseits auch wieder auf einen Glauben reduziert, indem hier ein vermeintlicher Wissenschaftler mit der Einlassung zitiert wird, "[d]ie sog. letzten Fragen führ[t]en immer auf eine Antwort, die nicht naturwissenschaftlich zu beweisen [sei]" (vgl. ebd., S.2). Um also überhaupt den Glauben als "Alternative" zur Erschließung von Fragen wie etwa um die Existenz der Welt erscheinen zu lassen, muß der Glaubenslehrer zunächst einmal die naturwissenschaftliche Weltsicht auf das Niveau der vorwissenschaftlichen Welterklärung "aus Glauben" herunterbringen. Man darf dabei nicht vergessen, daß diese zu einer Zeit ersonnen wurde, als von einer "wissenschaftlichen" Welterschließung im heutigen Sinne noch nicht die Rede war. Die Schöpfer des christlichen Glaubens und die Autoren der christlichen Quellen lehnten jedenfalls recht deutlich die damals in der antiken Welt betriebene quasi-empirische naturwissenschaftliche Forschung und auch die philosophischen Gedankenexperimente ab, waren nicht an Wissen interessiert. Die christliche Lehre bezog ihre "Erkenntnisse" in den ganzen fast 2000 Jahren ihrer Existenz letztlich immer aus demselben "Urstoff", der sich seither nicht verändert hat, der Bibel, während die naturwissenschaftliche Weltsicht sich - zumindest seitdem die Kirche nicht mehr darüber befindet, was "wahr" und "richtig" zu sein hat - um zumindest ein paar Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Andererseits "glaubt" Wissenschaft nicht, sondern bezieht Erkenntnisgewinn aus Theoriebildung und deren empirischer Bestätigung oder nach Popper vielmehr noch deren Widerlegung. Ein christliches Weltmodell ist in dem Sinne auch nicht "wissenschaftlich", als es diese Widerlegung auch nicht erlaubt: man kann eben genauso wenig beweisen, daß es keinen Gott gibt. Also ist letztlich die Diskrepanz zwischen einem christlichen und einem naturwissenschaftlichen Weltmodell um so größer, was deren wissenschaftlichen Erklärungswert angeht.
(b) Bürger räsoniert, daß die Frage nach der Existenz der Welt nur aus einem Glauben heraus beantwortet werden könne, und entsprechend der Mensch dazu verpflichtet sei, eine Wahl zu treffen, woran er glaube: entweder an den christlichen Gott - und damit, wie er im Text vermittelt, an "Ursprung, Ursinn und Urwert", die "Geborgenheit" vermitteln sollen (Bürger 2006, S.4) -, oder an die Vorstellung aus dem "Diamat", "die Materie sei ewig" (vgl. Bürger 2006, S.2). Hier wird ein Argumentationsfehler gemacht, der als "falsche Dichotomie" bezeichnet werden kann, nämlich hier die Wahlmöglichkeit auf zwei Alternativen eingeschränkt. Der Autor rekurriert ansonsten hier auf den "Gottesbeweis" der Aristoteles, der konstruiert hatte, daß alle Bewegung ihren Anfang in einem "unbewegten Beweger" haben müsse (vgl. Bürger 2006, S.2). Diese Vorstellung wurde im Mittelalter von Thomas von Aquin im sog. "kosmologischen Gottesbeweis" ausgeführt (vgl. Röder 2001, S.2f.).
Allerdings ist diese Vorstellung fehlerhaft. Nach Kants "Kritik
der reinen Vernunft" begeht jemand, der durch eine solche
Methode die Existenz eines Gottes beweisen will, einen sog.
Kategorienfehler, indem hier versucht wird, erdachten
(Ideal-)Vorstellungen Realität zu geben (vgl. Röder
2001, S.5). Auch widerspricht das Gottesbild des kosmologischen
Gottesbeweises sowohl dem Gottesbild der damaligen Griechen und
erst recht dem christlichen, indem Aristoteles das Universum als
ewig ansieht, dieser Gott entsprechend nicht kausale Ursache von
dessen Existenz und damit kein Schöpfergott sein kann; und
dieser Gott auch auf andere Weise letztlich keine Empfindungen und
keinen Bezug zu dem Universum hat, dem er als "unbewegter
Beweger" zugeordnet wird. Es ist ihm gleichgültig, ob
wir ihm opfern oder ihn anbeten (vgl. Roth 2006, S.11f.).
Andererseits sieht aber die aktuelle Kosmologie - die "materielle
Weltsicht" - unser Universum gerade nicht als ewig an,
sondern geht - in einer Sicht - davon aus, daß es im Zuge
eines Anfangsereignisses entstanden sei, das als Urknall
bezeichnet wird [- wobei allerdings während des Urknalls auch
die Zeit entstanden sein soll, so daß auch dieses Modell
nicht so richtig auf die christliche Sicht paßt, bevor die
Welt entstanden war, sei Gott schon gewesen (vgl. Johannes 17,5),
weil "vor dem Urknall" dann keine sinnvolle Aussage
wäre, und wird die Zeit im Glaubensbuch auch nicht als
zwingend lineares Phänomen begriffen (vgl. Prediger 3,15) -]
(vgl. Wikipedia:
Urknall, abgerufen am 21.06.2008). Nach Bürger war ja
gerade die Vorstellung abzulehnen, das Universum sei ewig (vgl.
Bürger 2006, S.2). Der Autor hatte zwar von Beginn an nur
eine unechte Entscheidungssituation aufgespannt - da sich ja
niemand dazu entscheiden würde, "unmoralisch" zu
sein -, aber philosophisch gesehen sinnigerweise in der falschen
Richtung, indem hier die Grundlage des Gottesbeweises in dem Sinne
gar keine andere Vorstellung war als die des "Diamat".
(c)
Vielleicht aber ist auch das ominöse "Kausalitätsgesetz"
ein Strohmann. So wird der Neurobiologe Martin Heisenberg damit
zitiert, die Physik habe bewiesen, "dass in der Natur ständig
Dinge ohne Grund passieren, dass es Zufälle gibt" (vgl.
Wolff 2006). Ein Gegenstand der Physik, auf die sich diese Aussage
beziehen mag, könnten sogenannte virtuelle Teilchen sein.
Dabei handelt es sich um eine Vorstellung von kurzlebigen
Teilchen, die - obwohl sich darin "eigentlich" keine
Teilchen befinden - innerhalb eines Vakuums entstehen und i.a.
nicht beobachtet werden können. Virtuelle Teilchen entstehen
in Paaren eines Teilchens und eines dazu korrespondierenden
Antiteilchens, die sich innerhalb eines äußerst kurzen
Zeitraums gegenseitig wieder vernichten. Manifestiert sich aber
ein virtuelles Teilchen in der Nähe eines schwarzen Loches,
kann es passieren, daß die beiden Teilchen auf verschiedenen
Seiten von dessen Ereignishorizont erscheinen. Dies führt
dazu, daß sich diese beiden Teilchen nicht gegenseitig
vernichten können. Dieses Phänomen liefert ein Modell
zum Verständnis der Strahlung, die schwarze Löcher
abgeben (vgl. Possaner 2000, S.55f.). Virtuelle Teilchen müssen
sich - je nach Interpretation - wegen ihrer kurzen Existenzdauer
nicht an den Energieerhaltungssatz halten (vgl. ).
(d) Weiterhin findet aber hier eine begriffliche Verquickung statt, die hier den Eindruck erweckt, die religiöse Weltsicht könne Dinge erklären wie auch die Naturwissenschaft, und wer einer naturwissenschaftlichen Weltsicht anhänge, die nicht für jede Leerstelle "Gott" einsetzt und antwortet, habe keine Werte und keinen Sinn im Leben (vgl. Bürger 2006, S.2). Dies wird mit einer Ausführung plausibel zu machen versucht, nach der vermeintlich das "Zerbröckeln[...]" der "Institutionen" - hiermit natürlich insbesondere die Kirche gemeint - letztliche Ursache dafür sei, daß im Osten Deutschlands so viele junge Männer Gewalt gegen Ausländer verübten. Hier wird weiterhin der Eindruck erweckt, daß Atheisten gewalttätiger seien und auch eine Neigung zum Neonazismus hätten. Nicht zuletzt aber hätten Hans Küng und Jacques Monod genialisch die Konsequenzen aus der "materialistischen und atheistischen Glaubensentscheidung" durchdrungen, indem sie festgestellt hätten, daß der Atheist nun einmal "letzte Haltlosigkeit, Wertlosigkeit, Ziellosigkeit [und] Sinnlosigkeit" verspüre (vgl. ebd., S.2+4).
"Geist gibt es nicht deshalb in der Welt, weil wir ein Gehirn haben. Die Evolution hat vielmehr unser Gehirn und unser Bewußtsein allein deshalb hervorbringen können, weil ihr die reale Existenz dessen, was wir mit dem Wort Geist meinen, die Möglichkeit gegeben hat, in unserem Kopf ein Organ entstehen zu lassen, das über die Fähigkeit verfügt, die materielle mit dieser geistigen Ebene zu verknüpfen."(Hoimar von Ditfurth, "Der Geist fiel nicht vom Himmel", Hamburg 1976, S.318; zitiert nach Bürger 2006, S.3)
(e) Nun würden beispielsweise Augen keinen Sinn machen, wenn es kein Licht gebe, das wahrgenommen werden könnte. Allerdings ist die Frage, ob notwendigerweise Gedanken oder eine immaterielle Ebene außerhalb der denkenden Lebewesen existieren muß: Bürger bringt mit einem Zitat von Hoimar von Ditfurth einen Rekurs auf einen weiteren klassischen Gottesbeweis, den sogenannten "ontologischen Gottesbeweis" nach Anselm von Canterbury. Anselm hatte den Begriff "Gott" als etwas definiert, "worüber hinaus nichts Größeres (Vollkommeneres) gedacht werden kann". Dieses müsse notwendig existieren, da über allem nicht Existierenden wieder etwas Größeres gedacht werden könne. Bereits von Zeitgenossen und auch in den Jahrhunderten danach wurden verschiedene Kritiken an diesem "Beweis" formuliert. So argumentierte bereits Anselms Zeitgenosse Gaunilo (und ähnlich etwa Bertrand Russell), daß nach der gleichen Logik ja auch die Existenz jeder anderen phantastischen Vorstellung beweisen könne, bloß weil man sich eine solche denken könne. Immanuel Kant schließlich hielt in seiner "Kritik der reinen Vernunft" fest, daß Anselm in seinem Beweis hier wiederum einen Kategorienfehler machte, indem er dem grammatischen Begriff "sein" wie eine Eigenschaft verwende, und er die Definition eines vollkommenen Wesens bereits voraussetze, sich damit also letztlich in einem Zirkelschluß ergehe (vgl. Wikipedia: Der ontologische Gottesbeweis, abgerufen am 18.06.2008).
Zusammenfassend erscheint es entsprechend problematisch, Jugendliche, die in dem Sinne noch keine Durchdringung von philosophischen Begriffen haben bzw. sich mit diesen Sachverhalten und ihren Gegenargumenten noch nicht beschäftigt haben, hier ohne Präsentation dieser Gegenargumente auf eine bestimmte Geisteshaltung zu "polen". Auch dies ist, wenn man so will, aber möglicherweise ein übliches Verhalten. Anekdotisch kann ich berichten, daß ich selbst seinerzeit in meinem Relgionsunterricht mit "Pascals Wette" konfrontiert wurde, einem in dem Sinne "statistischen Gottesbeweis", die bei oberflächlicher Ansicht - wer an einen Gott glaubt, könne ja höchstens gewinnen, aber nichts dabei verlieren (vgl. Wikipedia: Pascalsche Wette, abgerufen am 18.06.2008) - zunächst einen Nutzen des Glaubens impliziert, allerdings in tieferer Betrachtung auch wieder Probleme aufwirft, die ich - wenn ich meine damaligen Unterlagen aufgreife - damals nicht reflektieren konnte.
Pascal wirft etwa nur die beiden Möglichkeiten auf, daß es entweder keinen Gott gebe oder aber den in der Bibel beschriebenen Gott. Da es aber abseits davon noch viele andere einander noch dazu häufig widersprechende Gottesvorstellungen gibt, wäre die Wahrscheinlichkeit letztlich trotzdem ziemlich hoch, dafür bestraft zu werden, einer bestimmten Vorstellung angehangen zu sein. Andererseits implizieren diese Widersprüche, daß möglicherweise keine der Gottesvorstellungen tatsächlich die "wahre" ist, für deren Glauben man belohnt wird. Pascal geht weiter davon aus, daß Glaube nichts koste. Allerdings kann es aber Kosten geben, können etwa wissenschaftliche Erkenntnisse verhindert werden, die den "geoffenbarten Glaubenswahrheiten" widersprechen. Und schließlich ist es moralisch falsch, nur deshalb an einen Gott zu glauben, weil man für diesen Glauben belohnt werden würde, wenn es diesen Gott gebe. Vermutlich würde man, wenn man nur um des Gewinns willen an einen Gott glaubt, im Falle der Existenz dieses Gottes auch nichts gewinnen, sondern viel eher als scheinheiliger Pharisäer abgeurteilt werden. Es läßt sich schließlich sogar die Position formulieren, daß ein Gott, so er existierte und daran interessiert sei, über die Moral von Menschen zu urteilen, einen ehrlichen Atheisten, der sich aber moralisch verhält (aber ggf. auch aus moralischen Gründen den Glauben an einen Gott ablehnt), besser beurteilen würde als einen solchen Pharisäer (vgl. dazu auch Wikipedia: Pascalsche Wette, abgerufen am 18.06.2008).
"[Der Mensch] weiß nun, daß er
seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für
seine Musik taub ist und gleichgültig für seine
Hoffnungen, Leiden und Verbrechen."
(Jacques Monod,
zitiert nach Bürger 2006, S.3)
(f) Schließlich fällt besonders noch das Zitat von Jacques Monod ins Auge. Die Implikation, die der Autor der Unterrichtskonzeption daraus zieht, ist aber aus philosophischer und/oder moralischer Hinsicht problematisch: Der Mensch, der sich hier auf einen Gott bezieht, mag sich zwar dadurch in irgendeiner Form geborgen fühlen (vgl. ebd., S.4). Allerdings werden Dinge ja nicht allein dadurch wahr, daß man an sie glaubt. So ist ihm genausowenig klar, ob es das gibt, worin er sich birgt. Damit könnte es sich auch um eine Illusion handeln, durch die - außer durch das eigene Einreden - nichts gewonnen ist. Andererseits schafft dieses Einreden letztlich die Voraussetzung dafür, an der Welt letztlich nichts zu ändern, im Universum nichts zu schaffen, das den Menschen in seinem Leiden auffängt. Der Glaube kann damit letztlich auch als Rechtfertigung angesehen werden, an den Mißständen in der Welt nichts zu ändern.
2.1.14.1.2.2 Joachim Meisner
Der schon für solche Äußerungen gebuchte Kölner Erzbischof Joachim Meisner äußerte gewohnt süffisant, daß Kunst, die nicht der Darstellung des Religiösen diene, "entartet" sei (vgl. Kardinal-Predigt: Meisner warnt vor "entarteter" Kultur; Wikipedia: Joachim Meisner, abgerufen am 09.06.2008). Dieser Begriff, mit dem die Nationalsozialisten Werke jüdischer und oppositioneller Künstler bezeichneten, ist offensichtlich vergällt und liegt der geistigen Brandstiftung nahe (vgl. Wikipedia: Entartete Kunst, abgerufen am 09.06.2008). Nicht zuletzt setzte Meisner damit auch die Katholiken auf einen rutschigen Grat: Die Nazis hatten in ihrem Kunstverständnis die Galerien "gereinigt" und gleichzeitig in ihrem Tun einen derartigen Verlust von Kultur und Menschlichkeit demonstriert, daß diese eigentlich am wenigsten das Recht dazu hatten, Kunstwerke als "Verfallserscheinungen" zu bezeichnen.
2.1.14.1.2.3 Gerhard Ludwig Müller
Bischof Gerhard Ludwig Müller schrieb in einer Kritik zu Michael Schmidt-Salomons Kinderbuch "Wo bitte geht's zu Gott?" (vgl. "Wo Gott geleugnet wird, fällt Menschenwürde", abgerufen am 09.06.2008), der Autor sehe Gläubige oder Menschen, die nach Gott suchten, auf dem Niveau von Schweinen. Mit keinem Wort hatte der Autor jedoch diese Gleichsetzung betrieben, sondern lediglich lustige Tiere als Protagonisten seines Buches gewählt. Auch impliziert Müller damit wiederum, Schweine seien als Lebewesen weniger wert und dürften zum Wohl des Menschen benutzt werden - dies eine durchaus katholische Vorstellung (vgl. KKK 2415,2417+2418).
Müller konstruiert in das Buch nunmehr hinein, es stelle Menschen so dar, als hätten diese keinen freien Willen und handelten nur von ihren Genen gesteuert. Andererseits hatte Gabriele Kuby diese Vorstellung ja auf Harry Potter und seinen bösen Verwandten angewandt und daraus konstruiert, Harry könne gar nichts Gutes wollen, da er ja durch die Verwandtschaft gewissermaßen vergiftet sei (s.o.). Auch dies eine biblische Vorstellung: Da heißt es nämlich - in Wort und Praxis -, daß der Mensch für die Taten seiner Vorväter zu bezahlen habe (vgl. 4.Mose 14,18; 1.Mose 9,25; 1.Samuel 15,1f.). Auch bringt Müller das Argument, der Nationalsozialismus sei ein "aggressiver Atheismus" gewesen. Dies wird im folgenden Abschnitt kurz beleuchtet.
Schließlich behauptet Müller, diese Sichtweise erlaube schließlich auch Abtreibungen, die von ihm hier polemisch als "Kindstötungen" bezeichnet werden, weil dies natürlich eher verfängt. Schließlich müßte man aber fragen, in wieweit es "moralisch" ist, daß Christen die Perspektive haben, Anders- und Nichtgläubige zu "mit eisernem Stabe" zu weiden oder sie zu "zerschmeißen wie irdene Töpfe" (Offenbarung des Johannes 2,26f.). Dies natürlich ein "tu quoque" ("Du doch auch"). Schmidt-Salomon hatte in seiner Darstellung die biblische Sintflutgeschichte als Ansatzpunkt für die Religionskritik des kleinen Ferkels angeführt, in der sich die Gerechtigkeit des biblischen Gottes insbesondere daran zeigen sollte, daß dieser bis auf Noah und seine Familie alle Menschen tötete - inklusive der Kinder, deren "Trachten" ja auch "nur b&oouml;se" gewesen sei (vgl. 1 Mose 6,5-8). Bezeichnend auch das Versprechen dieses Gottes, solches nicht wieder zu tun (vgl. 1 Mose 8,21), das allerdings in "Prophezeiungen" in der "Offenbarung des Johannes" (vgl. Offb 6,12-17; 8,7-13 etc.) widerspricht. Andererseits hatte Schmidt-Salomon die Frage, ob Abtreibungen ethisch vertretbar sind, überhaupt nicht thematisiert, da sie in einem Kinderbuch dann doch deplaziert ist. Und übrigens wäre es auch ein moralischer Wert, wenn man Menschen ab einem Alter, in dem sie genügend einsichtsfähig sind, mit korrekten Informationen die verschiedenen Aspekte darzubringen. Die Unterrichtskonzeption von Bürger erinnert da doch sehr an frühere Zeiten, in denen Atheisten nur dumm oder böse sein konnten (vgl. Sprüche 1,22; Psalm 139,19).
2.1.14.1.3 "Die gottlosen Mörder von Auschwitz"?
Um die Leichenberge von Auschwitz kommen konservative Glaubenskritiker, so auch Gabriele Kuby, auch nicht herum, wenn es darum geht, Menschen zu geißeln, die sich als Atheisten "von ihrem Schöpfer los[ge]sagt" hätten. Daß das Nazi-Regime "gottlos" gewesen sei, ist ein beliebtes "Argument", mit dem religiöse Menschen versuchen, Atheisten als unmoralisch und im Gegenteil die Religion als lebensnotwendig darzustellen und die Verantwortung der eigenen Religion für das Regime und seine Untaten zu leugnen. Der Antisemitismus der Nazis war nun aber nicht ein Phänomen, das plötzlich - so behaupten fundamentalistische Christen etwa, wegen des "bösen" "Darwinismus", den sie gleichzeitig auch als "Gottleugnung" ansehen (vgl. ) - aufgetreten oder in der Geschichte - wenn man einmal von der Größenordnung absieht, mit der er in die Tat umgesetzt wurde - singulär gewesen wäre.
Viele prominente Nazis hatten ein Gottesbild, das nicht unbedingt dem von den Kirchen vertretenen Bild entsprach (vgl. Mihr 2008, S.2). Tatsache ist allerdings, daß keiner von ihnen eine atheistische oder humanistische, viele von ihnen aber eine devot christliche Erziehung genossen hatten und ihren Glauben nicht minder devot übten (vgl. ). Ralph Giordano dokumentiert in seinem Buch "Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte" (Giordano 2004) nun auch einige Ausbrüche gegen die Kirche. So hatte Alfred Rosenberg den Kampf gegen das Christentum als "Seelenkrieg" bezeichnet und mit seinem Buch "Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts" einen "rassenideologischen Katechismus" geschrieben. Laut Rosenberg soll Hitler den Plan gehabt haben, die Macht des Katholizismus durch die Erhebung mehrerer nationaler Gegenpäpste zu brechen und im (verpflichtenden) Religionsunterricht das Christentum nach und nach durch diesen "Katechismus" zu ersetzen (vgl. S.283f.). Hitler habe - so äußert Giordano - genauso den Plan gehabt, die Kirche mit Hilfe von Geldzuwendungen für die Zwecke des Regimes einzunehmen. Hitler hatte tatsälich auch keine hohe Meinung von den Geistlichen, die er als in erster Linie am Geld interessiert sah (vgl. Giordano 2004, S.284-286). Allerdings ist aus diesen Ausführungen auch wieder nicht klar, inwieweit Hitler diese Phantasien tatsächlich teilte. So soll Adolf Hitler - abgesehen von der gemeinsamen Ideologie - Rosenberg nicht sehr ernst genommen haben ("Emotionale K„lte gepaart mit der Bereitschaft zu t”ten", abgerufen am 31.10.2008). Auch war Himmler damit nicht im eigentlichen Sinne "gottlos", bloß weil er die christliche Religion ablehnte oder ihr nicht folgte. In einem rein binären Denken waren natürlich Alle, die nicht der allein seligmachenden Weltanschauung folgten, "gottlose Heiden". In diese Kategorie wurden allerdings die Anhänger der alten griechisch-römischen, der keltischen oder der germanischen Kulte, oder Neuheiden, die sich nicht als "gottlos" sahen. Auch Himmler sah sich womöglich nicht als "gottlos" an. Dann wäre die Behauptung, die Mörder von Auschwitz seien im atheistischen Sinne "gottlos" gewesen, ziemlich haltlos. Sah er sich aber als Atheisten, so ist er in seiner Haltung auch nicht repräsentativ für alle Atheisten. Schließlich hatten die Nazis freigeistige Organisationen ebenso vehement bekäpft. Zuletzt erschiene es nicht einmal plausibel, daß sie zuerst alle Deutschen als "gottgläbig" vereinnahmt hatten und die religiöse Bildung verstärkten, um dann und damit eine atheistische Weltanschauung zu verbreiten. Daß Atheisten schließlich wenigstens den Teufel, oder wie es im NT heißt, "den Gott dieser Welt" verehrten, ist wiederum ebenfalls fundamental-christlicher Mythos.
Auch war die NSDAP eine Partei, die sich zu christlichen Werten bekannte und auch die Ideologie von der Volksgemeinschaft christlich zu rechtfertigen verstand (vgl. Kuessner 2001, S.). Daneben waren die Nationalsozialisten zunächst einmal auch bemüht, aus Deutschland wieder ein zutiefst christliches Land zu machen, "die Sittlichkeit [zu heben] und [den] Kampf gegen Bolschewismus und Gottlosigkeit mit Energie" zu führen (vgl. Müller 1963, S.117; zit. nach Ranke-Heinemann 2000, S.533). In der NSDAP erkannten z.B. die Bischöfe der römisch-katholischen Kirche entsprechend den Partner, mit dem "keusche Jugenderziehung" durchgesetzt und "Ausschreitungen im Badeleben" und "die Pest der schmutzigen Literatur" bekämpft werden konnte (vgl. Heer XXXX, S.409; zit. nach Ranke-Heinemann 2000, S.533). So bekannten sich bald nach der "Machtergreifung" die Kirchen freiwillig zum Nazi-Regime und wurden die "völkischen" Ideale der Nazis wie die "Rassengesundheit" und die "Volksgemeinschaft" religiös verbrämt (vgl. Ranke-Heinemann 2000, S.534), was zu einer wachsenden Loyalität ihrer Gläubigen gegenüber diesem führte (Wikipedia: "Mit brennender Sorge", abgerufen am 22.06.2008), wurden freigeistige Vereine verboten, der Religionsunterricht wieder als Pflichtfach eingeführt, nachdem es in der Weimarer Zeit auch bekenntnisfreie Schulen gegeben hatte, und wurden alle Nichtmitglieder der beiden christlichen Kirchen - sofern es sich bei ihnen nicht um Juden handelte - als "gottgläubig" vereinnahmt (vgl. hier und im folgenden "Die evangelische Kirche und der Holocaust", abgerufen am 22.06.2008). Auch gab es eine ganze Reihe von faschistischen Staaten, in denen insbesondere der Katholizismus eine wichtige Stütze des Regimes darstellte und sich zum Teil Geistliche in verantwortlichen Positionen fanden (vgl. Wikipedia: Klerikalfaschismus, abgerufen am 09.11.2008): So der "Ständestaat", der in Österreich in den letzten Jahren vor der Besetzung durch das deutsche Reich herrschte (vgl. Wikipedia: Austrofaschismus, abgerufen am 09.11.2008), das Franco-Regime in Spanien (vgl. Wikipedia: Franquismus, abgerufen am 09.11.2008), das Ungarn des Reichsverwesers Horthy, das Regime der Priester Hlinka und Tiso in der Slowakei (vgl. Wikipedia: Andrej Hlinka; Wikipedia: Jozef Tiso, abgerufen am 09.11.2008) und das kroatische Ustascha-Regime, das systematischen Massenmord an Juden, Roma und den mehrheitlich andersgläbigen Serben betrieb (Wikipedia: Ustascha, abgerufen am 09.11.2008). In wieweit dahinter eine Systematik zu sehen ist, daß etwa der Vatikan den Völkermord unterstützt hätte, ist dabei seit Jahrzehnten eine heftig diskutierte Frage. Zum Teil hatten sich Geistliche, etwa in den Niederlanden, gegen Repressalien und Deportationen ausgesprochen, allerdings handelt es sich bei den Geistlichen, die die Faschisten unterstützten, offenbar nicht um "bedauerliche Einzelfälle" oder Menschen, die sich in einem "Irrtum" befanden, wie hier ggf. zur Verteidigung angebracht wurde.
Die SS, die auch die Konzentrationslager betrieb, war ebenfalls ein besonders religiöser Verein: So konnten Atheisten gar nicht erst Mitglieder der SS werden. So heißt es in einem Buch namens "50 Fragen und Antworten für den SS-Mann" schon zu Beginn: "Wir schwören dir, Adolf Hitler, [...] Treue und Tapferkeit [...], Gehorsam bis in den Tod. So wahr uns Gott helfe!", und auf die Frage "Was hältst Du von einem Menschen, der an keinen Gott glaubt?" gibt es die Antwort "Ich halte ihn für überheblich, größenwahnsinnig und dumm; er ist nicht für uns geeignet" ("Die SS - ein esoterischer Orden", abgerufen am 16.11.2007).
Die Kirchen leisteten gegen solche Maßnahmen nicht etwa Widerstand, sondern schalteten sich alle mehr oder weniger bereitwillig gleich, selbst die sogenannte "Bekennende Kirche", die so häufig als Opposition gegen die Nazis dargestellt wird. Die Kirche als letzte große Organisation, die das Volk zum Widerstand gegen die Nazis hätte aufrufen können, verhielt sich diesem gegenüber entsprechend weitgehend positiv. Kritik an Maßnahmen des Regimes kamen von Seiten der Kirche wenn überhaupt
(a) nur punktuell - so lieferten viele Theologen längst nicht nur zur Nazizeit nur zu bereitwillig Rechtfertigungen für die Verfolgung und Vernichtung der Juden (vgl. "Aussprüche und Zitate von echten Christen", abgerufen am 22.06.2008); kritisierte Bischof von Galen zwar eine von den Nazis als "Euthanasie" bezeichnete Mordaktion an Behinderten, feierte aber gleichzeitig frenetisch den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, warnte nach der deutschen Kapitulation eindringlich vor Kooperation mit den Besatzungsmächten und setzte sich für eine Rehabilitierung von Nazitätern ein (vgl. Wikipedia: Clemens August von Galen, abgerufen am 22.06.2008),
(b) im Rahmen der Naziideologie - so war man zwar gegen die Zwangssterilisierung sogenannter "Erbkranker". Allerdings nicht aus dem Grunde, daß dies eine unmenschliche Maßnahme gewesen wäre - vielmehr hielt dies Kardinal Faulhaber sogar für "gerechte[.] Notwehr" - Menschen, die sich darob nicht mehr fortpflanzen konnten, sich danach ungehemmt ihren Trieben hätten ergeben können, was katholischerseits schlechterdings nicht geduldet werden könnte. Nach der Auffassung des "Moraltheologen" Tillmann und des Kardinals Faulhaber sei es moralisch besser gewesen, "diese Schädlinge" lebenslang zu "internieren", womit in der Interpretation von Ranke-Heinemann nur Konzentrationslager gemeint sein konnten (vgl. Ranke-Heinemann 2000, S.535f.),
(c) oder äußerst vorsichtig - so benannte Papst Pius XII. "gewisse Vorgänge in Deutschland", die ihn beunruhigten, nicht explizit.
Widerstand gegen die Nazis leisteten auch unter den deutschen Kirchenmännern nur Einzelpersonen, für die man sich damals nicht einsetzte und die allzu häufig im Konzentrationslager endeten, die aber heute als leuchtende Beispiele für den Mut "der Christen" im Kampf gegen die Nazis dargestellt werden. Zwar hatte Hitler auch geäußert, er wolle auch mit Galen abrechnen (vgl. Giordano 2004, S.286). Tatsächlich aber passierte dies nie. Als ein Grund dafür wurde genannt, daß dies die "unpolitische" Bevölkerung schließlich gänzlich gegen die Nazis aufgebracht hätte.
Zwar mag es nun aus moralischer Sicht positiv sein, daß heutige Christen sich nicht mehr vorstellen können, wie der Holocaust mit christlichen Wertvorstellungen zu vereinbaren sei. Allerdings war die Nazizeit auch nicht so "gottlos", wie so häufig kolportiert wird.
Zur damaligen Zeit waren sehr viel weniger Menschen nicht Mitglied einer der christlichen Kirchen. Die "christlichen Moralvorstellungen", die ihnen dort vermittelt wurden, hatten allerdings auch die "Machtergreifung" nicht verhindert: Nun haben christliche Theologen mitunter versucht, den christlichen "Antijudaismus" von dem "Antisemitismus" der Nazis zu unterscheiden. Tatsächlich wäre aber ohne den Antisemitismus, der von Seiten der Kirchen jahrhundertelang gepflegt wurde, auch der Antisemitismus der Nazis in dieser Größenordnung nicht möglich gewesen, weil dieser auf einem geistigen Fundament von Vorbehalten und Vorurteilen aufbauen mußte, die abrufbereit in noch so vielen Menschen anerzogen wurden. So werden die Juden im Neuen Testament als "Jesusmörder" dargestellt, predigten und schrieben christliche "Geistesgrößen" wie Johannes Chrysostomos oder Thomas von Aquin gegen die Juden. Das Vorgehen gegen Andersgläubige, so auch gegen Juden, schien durch Jahrhunderte hindurch geradezu ein selbstverständlicher Teil christlicher Identität zu sein. So vermerkte etwa der Bischof Ambrosius als Kritik an einem Edikt des weströmischen Kaisers Magnus Maximus, in dem die Christen der Stadt Rom für die Zerstörung einer Synagoge verurteilt wurden, daß der Kaiser ja wohl ein Jude geworden sein müsse, daß er deren heilige Stätten schützen wolle (vgl. Wikipedia: Magnus Maximus, abgerufen am 27.07.2008). Juden wurden im Mittelalter irrationalerweise als "Hostienschänder" gelyncht - etwas, das auch nur dadurch zu erklären ist, daß gemäß des Dogmas der Transsubstantiation (die Wirkungskraft/das "Agens" des) Jesus Christus in einem Stück Backoblate gegenwärtig sei (- noch heute erhalten Menschen Morddrohungen, die mit "konsekrierten" Hostien nicht im katholischen Sinne "adäquat" umgehen).
In einer Diskussion mit fundamentalistischen Katholiken wurde mir einmal angeführt, daß ja seit dem "Toleranzedikt" des Papstes Martin V. (R 1417-1431), der Pogrome gegen Juden verbot, nicht mehr von einer kirchlichen Judenfeindschaft zu sprechen sei. Allerdings war dieses Edikt weitgehend wirkungslos geblieben, und auch nachher fanden viele Drangsalierungen der Juden von kirchlicher Seite statt (vgl. Wikipedia: Martin V., abgerufen am 27.07.2008). Nach der Zeit Martins V. schrieb etwa Martin Luther - der ja zunächst nicht die Spaltung der Kirche zum Ziel gehabt hatte - gegen die Juden, und wurden noch bis zur Aufhebung des Kirchenstaates dem Ende des 19.Jahrhunderts zu die Juden dort in Ghettos gezwungen, durch Bewegungseinschränkungen und Berufsverbote drangsaliert (vgl. Kertzer xxxx). Noch dazu war es ja bereits beschämend für die Christen, daß überhaupt erst ein Kaiser oder Papst explizit Angriffe gegen die Juden verbieten mußte und daß dies nicht selbstverständlich klar war.
Kirchenvertreter hatten zudem auch all zu häufig keine
Kritik für das Leid der Opfer übrig, sondern bliesen
noch selbst in dasselbe Horn, indem sie etwa die Verfolgung der
Juden als gerechte Strafe für vermeintliche Untaten in der
Vergangenheit darstellten. In dieser Argumentationslinie geht auch
Kuby vor, indem sie das Verhalten der Spanier im Land der Azteken,
wobei diese "Hunderttausende nieder[gemetzelt]" hatten,
weil sie durch die religiösen Praktiken der Azteken, die auch
Menschenopfer beinhalteten, "[s]chockiert" gewesen seien
(vgl. http://gabriele-kuby.de/empfehlungen_buecher.html;
abgerufen am 09.10.2007). Nur waren an den konkreten Opferritualen
nur einige wenige Priester beteiligt gewesen. Wie gut aber, daß
die Schuld für eine Behandlung immer den solcherart
"Behandelten" zugeschrieben werden konnte.
Das
konnte womöglich auch keine Begründung sein: Das
europäische Mittelalter und die frühe Neuzeit hatten
bekanntermaßen eine besondere Beziehung zu menschlichen
Körperteilen. Häufig zu finden sind etwa das „memento
mori“, d.h. bildliche Darstellungen, die Menschen an ihre
eigene Sterblichkeit erinnern sollten. Dies ging von kleinen
Darstellungen für die Hosentasche (vgl. Wikipedia:
Memento mori, abgerufen am 05.02.2009), bis dahin, daß
ganze Einrichtungen von Kirchen aus menschlichen Knochen geformt
oder Nachbildungen davon geformt wurden.
Ein kaum bekannter
Umstand in der europäischen Medizingeschichte scheint es aber
zu sein, daß bereits seit der Antike menschliche Körperteile
auch als Heilmittel bei vielerlei Beschwerden angesehen wurden.
Damit war längst nicht nur die sprichwörtliche
„zerstoßene Mumie“ gemeint, die man bisweilen
einnahm, sondern galten Körperteile von Hingerichteten oder
gewaltsam Gestorbenen, „Menschenfett“ oder
Muskelfleisch als Therapiemittel, oder in besonderem Maße
auch das Blut. Von den Römern wurde das Blut von Gladiatoren
zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt (fraglich, ob es gewirkt
hat). Als im Jahr 1492 der Papst Innozenz VIII. im Sterben lag,
versuchten seine Leibärzte, ihn zu retten, indem sie ihm Blut
zu trinken gaben, das sie zuvor drei Jugendlichen abgenommen
hatten, wobei auch der Tod der Jugendlichen in Kauf genommen wurde
(vgl. The
Aztecs, cannibalism and corpse medicine (1), The
Aztecs … (2) abgerufen am 05.02.2009).
Und noch ein Nachsatz: Tatsächlich gab es ja auch unter den vermeintlich "gottlosen" Kommunisten - immerhin ist der Kommunismus aber auch eine andere "Religion" - antisemitische Ausfälle. Die DDR-Staatssicherheit sah die Neonazis als weniger gravierendes Problem an, da sie ihrer Auffassung nach eine positive Arbeitsmoral und Einstellung zum Wehrdienst - dies zentrale Werte der DDR-Staatsideologie - hatten (vgl. Auerbach 2002, S.85f.). In Aktionen in diversen Staaten des Ostblocks wurden Juden direkt als Oppositionelle angegriffen und mundtot gemacht (vgl. Wikipedia: "Wurzelloser Kosmopolit", abgerufen am 22.08.2008) bzw. unter Druck gesetzt, zu emigrieren (vgl. Mark 2000, S.146). Mit antisemitischen Hetzkampagne versuchte die DDR-Staatssicherheit im Jahr 1961, die Bundesrepublik zu diskreditieren (vgl. Knabe 2002, S.122f.). Süffisanterweise werden in solchen Pamphleten allerdings auch häufig Bibelsprüche und kirchliche Würdenträger zitiert (vgl. Mark 2000, S.146).
2.1.14.1.4 Kirche, Menschenwürde und Moral - einige weitere Testfälle
2.1.14.1.4.1 "Die moralisch[.] richtige[.] Geburtenrate"
Auch ansonsten hatte sich die römisch-katholische Kirche in besonderer Weise um die Würde des Menschen verdient gemacht. Um die "widergöttliche" Onanie zu bekämpfen, beließ man es nicht bei den üblichen Warnungen, wer sich nicht beherrschen könne, der werde geisteskrank oder mißgestaltig oder bekomme ebensolche Kinder (vgl. Ranke-Heinemann 2000, S.208f.), sondern man vollzog bisweilen Operationen an Kindern, bei Mädchen etwa Beschneidungen oder die Verbrennung mit glühenden Eisen, bei Jungen Teilamputationen des Penis, die häufig ohne Betäubung vorgenommen wurden (vgl. ebd., S.485-489).
Noch in den 1980er Jahren zitierte man heiratswillige Männer zum "Penis-Test", wo sie demonstrieren mußten, nicht "beischlagunfähig" zu sein, was nach kirchlicher Vorstellung ein Ehehindernis sei (vgl. ebd., S.380f.), und der verstorbene Papst Johannes Paul II. warnte im Jahr 1984 Ehepaare davor, "aus unredlichen Gründen" die Zahl ihrer Kinder "unterhalb der für ihre Familie moralisch richtigen Geburtenrate zu halten" (ebd., S.130). Nach römisch-katholischer Lesart ist der einzige Grund, warum Menschen die Ehe eingehen und Sex haben sollten, die Zeugung von Kindern. Konservative Teile der römisch-katholischen Kirche, so etwa das Opus Dei, sind ferner heute noch immer der Meinung, auch im Rahmen dieses Beischlafs dürfe keinerlei Leidenschaft oder sexuelle Erregung empfunden werden (vgl. ), und sind Menschen, die diese Empfindungen von sich abspalten, ggf. sogar stolz auf sich, dieses "Ideal" verwirklicht zu haben.
Ein typisches Argument religiöser Gegner der Sexualaufklärung ist es auch, daß dieser zur Sexualität erst verführe (vgl. ). Dies wird als Rechtfertigung angeführt, um entweder keine Aussagen über Sexualität anzubringen oder aber solche, die bewußt falsche Informationen verbreiten, etwa daß Kondome nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen könnten (vgl. Human Rights Watch 2002). Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit der Sexualaktivität von Jugendlichen auseinandersetzen, zeigen tatsächlich aber, daß Jugendliche, die keinen oder nur einen nicht sachrichtigen Aufklärungsunterricht genossen haben, kaum später sexuell aktiv werden als bei einem sachlichen Aufklärungsunterricht. Für sie ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, sich eine sexuell übertragbare Krankheit (STD) zuzuziehen oder schwanger zu werden, erheblich größer (vgl. ). Eine Begründung dafür ist die an und für sich paradoxe Beobachtung, daß Jugendliche, denen erzählt wurde, Kondome könnten sie nicht schützen, darauf von vornherein verzichteten (vgl. ). Auch in einem internationalen Vergleich fällt auf, daß in jenen Staaten, die hinsichtlich Sexualerziehung von Jugendlichen als besonders liberal gelten, auch die Ansteckungsraten mit STDs und die von Teenager-Schwangerschaften am geringsten ist. Dort ist entsprechend auch die Rate der Abtreibungen am geringsten ( ). Entsprechend läßt sich daraus ableiten, daß das von den "Lebensschützern" propagierte Ziel nur dann zu erreichen ist, wenn sie die jugendliche Sexualität als gegeben annehmen, aber den Jugendlichen soviel Wissen an die Hand geben, daß sie damit verantwortlich umgehen können.
2.1.14.1.4.2 Das Verhalten der Kirche im spanischen Bürgerkrieg und dessen konsistente Bewertung bis heute
.
2.1.14.1.5 Ein Exkurs zum "Sozialdarwinismus"
Die von Charles Darwin geprägte Evolutionstheorie wird von konservativ-fundamentalistischen Christen sozusagen als "ultimative Abkehr vom Christentum" gesehen und dementsprechend vehement bekämpft. Um ein Argument in die Hand zu bekommen, wird von ihnen insbesondere versucht, die Evolutionstheorie als ursächlich für die Verbrechen der Nationalsozialisten darzustellen. Als vermeintliche Schnittstelle für die Verbindung zwischen beiden haben sie den "Sozialdarwinismus" identifiziert, der ihrer Meinung nach auf die von Charles Darwin geprägte Evolutionstheorie zurückgehen und andererseits die "wissenschaftliche" Grundlage der nationalsozialistischen Rassentheorie bilden soll.
Im Kern des Sozialdarwinismus steht die Vorstellung, daß sich menschliche Gesellschaften nach denselben Mechanismen entwickelten wie biologische Systeme. Die Individuen stünden zueinander in einem Wettbewerb, der Wesen bevorzuge und ihnen die Fortpflanzung ermögliche, die "stärker", beispielsweise kulturell überlegen seien ("Survival of the fittest"). Spencer dachte seine Theorien tatsächlich "atheistisch", d.h. Systeme würden sich ohne äußere Einwirkung nach diesen Mechanismen weiterentwickeln. Spencer selbst war allerdings tief im Liberalismus verwurzelt und stand zumindest nicht im Ruch, antisemitisch eingestellt zu sein (vgl. Herbert Spencer, abgerufen am 12.05.2008). Allerdings wurden diese Vorstellungen im Rahmen des "Sozialdarwinismus" aufgegriffen und um eine Skala vermeintlicher biologischer Wertigkeiten erweitert. Diese wurde um die Wende zum 20.Jahrhundert in verschiedenen Kontexten ausgenutzt:
(a) Im Rahmen des Kolonialismus. So teilten die Kolonialherren in Ruanda die dortigen Bewohner entlang der Art ihres Lebensunterhaltes bzw. ihres sozialen Status in "Rassen" ein und konstruierten über die Sprachfähigkeiten (- vermutlich werden allein schon Menschen mit einem höheren sozialen Status ein größeres Vokabular und bestimmte grammatikalische Konstruktionen häufiger anwenden; ein sinnfälliges Beispiel im Deutschen ist etwa der Gebrauch des Genitivs -) eine vermeintliche Wertigkeit dieser "Rassen" konstruiert (vgl. Richter 2006b). Andererseits gruppierten die Kolonialherren Menschen auch anhand ihrer Hautfarbe. Hellhäutigere wurden als wertvoller angesehen und dementsprechend mit Privilegien gegenüber Dunkelhäutigeren ausgestattet. Die Theorie, auf der diese Gruppierungen beruhten, die sog. "Hamitentheorie", war ihrerseits allerdings wieder ein Versuch, einen biblischen Mythos "wissenschaftlich" zu verlängern: So steht im 1.Buch Mose zu lesen, daß der mythische Urvater Noah drei Söhne hatte, von denen Einer, Ham, seinen Sohn verspottet habe, indem er seinen Brüdern erzählte, daß er seinen Vater nackt schlafend vorgefunden habe, nachdem er sich betrunken hatte. Ham sei dafür von Noah verflucht worden [vgl. 1.Mose 9,18-27]. Von Theologen wurde später weiter assoziiert, er sei mit einer schwarzen Hautfarbe gestraft worden. Nach der Lehrmeinung sollte sich dieser Fluch auch auf die Fähigkeit zu kulturellen Leistungen erstrecken und es aufgrund des Bibeltextes erlaubt sein, Menschen mit schwarzer Hautfarbe zu versklaven (vgl. Richter 2006a; Wikipedia: "Menschenrasse"; Wikipedia: "Hamitentheorie", jeweils abgerufen am 12.05.2008).
(b) Die Rechten sahen in diesem Gemenge eine Möglichkeit, die schon seit Jahrhunderten bestehenden Vorurteile gegen die Juden in eine vermeintlich wissenschaftliche Weltsicht hinüberzuretten. Zum einen zogen die "Sozialdarwinisten" ihre Lehren weniger aus der Theorie von Charles Darwin, sondern aus schlecht verdauten Versatzstücken der Theorie von Lamarck (vgl. Wikipedia: Sozialdarwinismus, abgerufen am 12.05.2008). Lamarck wiederum hatte sich in seiner Theorie allerdings weniger mit biologischen als vielmehr mit kulturellen Sachverhalten beschäftigt, die nicht auf die Entwicklung biologischer Arten übertragen werden können. Seine Theorie gilt - die Rückübertragung durch die "Sozialdarwinisten" ohnehin - deshalb als falsch (vgl. Wikipedia: Lamarckismus, abgerufen am 12.05.2008).
Schließlich sind die biologischen Mechanismen ganz andere:
(a) Erstens die Überlebensfähigkeit anläßlich der konkreten Lebensumstände. Beispielhaft sei genannt, daß die Sichelzellenanämie, eine vererbliche Erkrankung des Blutbildes, gegen Malaria resistent macht und dementsprechend in malariaverseuchten Gebieten einen Selektionsvorteil bedeutet. Tatsächlich ist der Anteil von Menschen mit Sichelzellenanämie in Malariagebieten größer (vgl. Wikipedia: Sichelzellenanämie, abgerufen am 12.05.2008). Wäre es nach dem Mechanismus der Überlebensfähigkeit gegangen und hätten die Vorurteile gegen die Juden gestimmt - tatsächlich hatten die Nazis aber genauso Millionen Juden ermordet, die in den gleichen Verhältnissen lebten wie ihre nichtjüdischen Mitbürger -, so hätten diese tatsächlich ja eine höhere "Überlebensfähigkeit" gegenüber der Weltwirtschaftskrise gezeigt, die die Nazis letztlich nach oben spülte. So hätten die Nazis letztlich sogar ihre eigene ideologische Vorstellung ad absurdum geführt, indem sie versucht hätten, durch den millionenfachen Mord an den Juden einer weniger überlebensfähigen "Rasse" zum Sieg zu verhelfen.
(b) Zweitens ist es aber doch sehr fraglich, ob das behauptete "Überleben des Stärkeren" innerhalb von Arten überhaupt relevant ist. So sind viele Lebewesen am Fortkommen ihrer Artgenossen interessiert und zeigen entsprechend altruistische Verhaltensweisen (vgl. Wikipedia: Sozialdarwinismus, abgerufen am 12.05.2008). Zum Beispiel ist bekannt, daß Fledermäuse bei Jagderfolg ihre Beute mit Artgenossen teilen. Individuen, die sich daran nicht beteiligen, wird ggf. von Seiten ihrer Artgenossen ein Anteil an deren Beute verweigert, wenn bei ihnen selbst der Jagderfolg einmal ausbleibt (vgl. Wikipedia: "Gemeiner Vampir", abgerufen am 12.05.2008). Mit Anderen zu teilen, kann also entsprechend die eigenen Überlebenschancen vergrößern.
(c) Schließlich hatten die Urheber der Evolutionstheorien an keiner Stelle propagiert, daß es Aufgabe des Menschen sei, das vermeintlich Minderwertige aus seiner Mitte zu entfernen. In der Natur gibt es allerdings keine Entität, die Lebewesen eine Wertigkeit zuordnen würde. Dies ist immer noch eine Vorstellung aus dem Kontext des Glaubens.
(d) Und nicht zuletzt mußten sich die Nazis zur Erklärung vermeintlicher "Rassenunterschiede" pseudowissenschaftlicher Methoden bedienen: So gab es letztlich gar keine andere Möglichkeit, Menschen als "Arier" oder "Juden" zu bezeichnen und zu diskriminieren, als über deren Religionszugehörigkeit. Ein Mensch, der ansonsten "arisch" gewesen wäre, konnte allein durch Konversion zum Judentum zum "Juden" im Sinne der Nazi-Rassegesetze werden und den Diskriminierungs- und Austilgungsmaßnahmen anheimfallen. Ansonsten wurde von den Nazis die Religionszugehörigkeit der Vorfahren bis zu den Großeltern herangezogen. Eine Person, deren Urgroßeltern der jüdischen Religion angehört hatten, galt als "Nichtjude", sofern die Großeltern christlich getauft worden waren. Waren die Großeltern nicht christlich getauft - dies kann zum Beispiel auch vorkommen, weil die Urgroßeltern nicht religiös gebunden waren -, wurden dieselben Personen als "Juden" eingestuft (vgl. Wikipedia: Ariernachweis, abgerufen am 12.05.2008). Letztlich zog man sich also auf das gleiche Kriterium zurück wie Jahrhunderte zuvor die spanische Inquisition, als sie den Begriff der vermeintlichen "Blutreinheit" (limpiezza de sangre) definierte, um zu verhindern, daß Juden oder ihre Abkömmlinge kirchliche Ämter übernehmen konnten (vgl. Wikipedia: Tomas de Torquemada, abgerufen am 09.10.2007). Was bereits oben angeführt wurde, gilt nun auch hier: Warum hätten die - vermeintlich "gottlosen" - Nazis Vorfahren, die nicht an den christlichen Gott glaubten, als Minuspunkte bei der Beurteilung von Menschen jüdischer Abstammung zählen sollen, wenn doch angeblich die Gottlosigkeit so hochgehalten wurde?
(e) Was die Gene angeht, so sind diese allerdings auch kein vernünftiges Differenzierungskriterium für irgendeine "Rasse". Zwar konnte mit Hilfe von DNA-Analysen bewiesen werden, daß die Kohanim, die nach jüdischer Tradition als Priesterkaste gesehen werden (typische Nachnamen sind etwa Kohen, Kagan oder Kahane), die in männlicher Linie von Aaron, dem Bruder des Moses, abstammt, tatsächlich wahrscheinlicher als z.B. Nicht-Kohen die Zugehörigkeit zu einer bestimmten "Y-chromosomalen Haplogruppe", d.h. eine Ähnlichkeit des vom Vater zum Sohn weitergegebenen Erbmaterials, aufweisen, wobei aufgrund dieser Aussage eine gemeinsame genetische Abstammung von einem Mann gemutmaßt wurde, der vor etwa 3000 Jahren lebte. Allerdings handelt es sich dabei eben nur um eine Wahrscheinlichkeitsaussage, und aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Haplogruppe kann auch umgekehrt nicht auf die Zugehörigkeit zu einer hypothetischen "Menschenrasse" geschlossen werden (vgl. Wikipedia: Y-chromosomal Aaron; Wikipedia: Haplogroup J1; Wikipedia: "Y-DNA haplogroups by ethnic groups", abgerufen am 13.05.2008). Im Einzelfall kann es sogar sein, daß ein Mensch z.B. trotz unterschiedlicher Hautfarbe genetisch enger mit einem Bewohner eines anderen Kontinents verwandt ist als mit seinem Nachbarn (vgl. Wikipedia: Menschenrasse, abgerufen am 12.05.2008).
2.1.14.1.6 Protestanten vs. Orthodoxe vs. Katholiken
Aber auch innerhalb der Religiösen werden zuweilen durchaus Fronten aufgebaut.
(a) So wird in vielen Quellen ausgeführt, in protestantischen Gegenden seien die Nationalsozialisten erheblich früher und erheblich beliebter gewesen, während der Katholizismus - auch aufgrund dessen, daß es zwei dezidiert "katholische" und staatstragende Parteien gab, nämlich das "Zentrum" und die Bayerische Volkspartei - die Menschen länger vor den Verlockungen der NSDAP geschützt gewesen seien (vgl. z.B. "Franken unter dem Hakenkreuz. Der Nationalsozialismus in Bayerns Norden", BR, 31.03.2008). Allerdings besteht das Risiko, einem ökologischen Fehlschluß anheimzufallen, sehr viel von der Varianz der Wahlergebnisse der NSDAP zur Zugehörigkeit zu der einen oder der anderen Konfession zuzuschreiben. Ein großer Teil der Varianz der Wählerstimmen wird durch unterschiedliche ökonomische Bedingungen erklärt. Vergleicht man etwa die ökonomische Situation mehrheitlich "protestantischer" und "katholischer" Wahlkreise miteinander, so stellt man fest, daß die "katholischen" Wahlkreise im Schnitt eine geringere Arbeitslosigkeit aufwiesen als die "protestantischen" Wahlkreise. Stärker aber als die Arbeitslosen selbst, die eher den Kommunisten zuneigten, neigten sog. "working poor", die insbesondere selbständige Arbeit leisteten, die sich durch ihre ökonomische Situation massiv vom sozialen Abstieg bedroht fühlten, den Nazis zu (vgl. King et al. 2004, S.13+25f.). Wenngleich nicht ihre Anzahl - so machten die Einwohner der "katholischen" Wahlkreise nur etwa 29% der Gesamtbevölkerung aus -, so mag der Anteil von zunächst einmal derart ängstlichen Menschen in "katholischen" Wahlkreisen damit sogar größer gewesen sein. Im Endeffekt mochten sich die beiden Konfessionen nicht viel tun, was die Unterstützung für die Nazis anging.
(b) Auch Christen einer Konfession sind mit Christen einer anderen Konfession durchaus nicht einträchtig, sondern haben ggf. eine Neigung, die Anderen zu verketzern oder als "unmoralisch" darzustellen (vgl. "Why the Orthodox Church is the Best", abgerufen am 17.09.2008).
2.1.14.2. "Vergiftung durch Bilder"
Schließlich kommt Kuby in "Vergiftung durch Bilder" auch auf Gewaltdarstellungen in Medien zu sprechen. So führt sie an, daß moderne Medien verstörende Bilder erzeugten, die sich tief in die Psyche des Menschen eingrüben.
a) Allerdings ist dies auch nicht das Privileg der modernen Medien: So waren Darstellungen wie das "memento mori" während des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit sehr häufig, bis dahin, daß ganze Kirchen aus Gebeinen errichtet wurden. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden Nachrichten über neue Greueltaten der verschiedenen Heere, die Deutschland mit schöner Regelmäßigkeit umpflügten, auf illustrierten Flugblättern verbreitet. Und noch aus dem Jahr 2000 ist ein Fall eines Jungen dokumentiert, der wegen Mißbrauchsvorwürfen gegen seine Eltern in einem katholischen Kinderheim untergebracht wurde. Der Junge, der von seinen Eltern ohne religiöse Unterweisung erzogen worden - die Vorwürfe gegen sie stellten sich übrigens kurze Zeit später als haltlos heraus - und eigentlich immer fröhlich gewesen war, zeigte sich kurze Zeit später extrem verstört durch die verpflichtende religiöse Unterweisung, der er unterzogen wurde, machte sich etwa erstmals in seinem Leben Gedanken über seinen Tod und sein "Seelenheil" (vgl. Schedel 2000). Dies sind wohl kaum Gedanken, mit denen sich ein sechsjähriger Junge beschäftigen sollte, und empfehlen nicht gerade Kubys Weltvorstellungen als "Hoffnung entzündend[.]".
b) Zum anderen gebraucht Kuby selbst entsprechend verstörende Bilder und versucht sinnigerweise damit, religiöse Hochgefühle zu produzieren. So feiert sie die vermeintlich "segensreiche Wirkung" eines "Gnadenbildes" in der Seeschlacht von Lepanto, daß "[d]as Blut von 40000 Menschen [...] an jenem 7.Oktober 1571 das Meer rot[färbte]" (vgl. http://gabriele-kuby.de/empfehlungen_buecher.html; abgerufen am 09.10.2007).
Nun könnte man zum einen Kubys Interpretation, damals sei durch die sog. "Heilige Liga" das "Abendland [...] gerettet" worden, als etwas überzogen kritisieren. Tatsächlich wurde das Osmanische Reich am Ende des 16.Jahrhunderts von "christlichen Nationen" durchaus als gleichwertiger Staat anerkannt. So hatte das "Heilige Römische Reich" sich an der Rüstung gegen die Türken nicht beteiligt, war Frankreich sogar mit den Osmanen verbündet und kalkulierte mit einer Schwächung Spaniens und der italienischen Staaten durch die Türken. Schließlich hatte die "Heilige Liga" trotz Aufbietung aller ihrer Kräfte nur ein Teilziel erreicht, wurde zwar grundsätzlich die Interessensphären der Staaten im Mittelmeer abgesteckt, hatten aber die Türken das bis dahin venezianische Zypern durch die Türken erobert, hatte der Seesieg von Lepanto mangels einer Landarmee keine "christliche" Rückeroberung Griechenlands zur Folge, und hatten die Türken ihre Verluste aus dieser Schlacht binnen kurzem wieder ausgeglichen (vgl. Wikipedia: Heilige Liga (1571); Wikipedia: Seeschlacht von Lepanto, abgerufen am 11.07.2008). Nun ist es vielleicht der persönlichen Interpretation überlassen, in wieweit der Sieg von Lepanto also eine strategische Bedeutung hatte.
Gravierender ist allerdings der Gebrauch dieses verstörenden Bildes, der bei Kuby in einen größeren Kontext eingebettet ist: Gabriele Kuby verteidigte in einer Talkshow, in der sie eingeladen war, auch einmal die Ermordung Giordano Brunos durch die frommen katholischen Herren, weil dieser ja religiöse Dogmen verleugnet habe (vgl. Wikipedia:Giordano Bruno, abgerufen am 27.12.2007), und nannte einen atheistischen Gast einen "Feind" (vgl. "Gott und die Welt bei Sandra Maischberger", abgerufen am 27.12.2007). [Und man darf auch nicht vergessen, daß man noch Jahrhunderte nach Giordano Bruno hingerichtet werden konnte, wenn man vor einer Prozession nicht den Hut gezogen, "verbotene Bücher" gelesen oder ein Kruzifix verschrammt hatte. Damals wurde übrigens Voltaire für diese "schwersten Verbrechen" verantwortlich gemacht, derer sich die verurteilten Jugendlichen schuldig gemacht hatten (Wikipedia: Jean-Francois Lefebvre, abgerufen am 27.12.2007).] Auch diese Beispiele zeigen, daß man vor lebenden Menschen letztlich weniger Respekt hat als vor vermeintlichen "moralischen Werten" oder fiktiven Darstellungen in Filmen oder virtuellen Darstellungen im Computer, und läßt dann letztendlich jeden fragen, ob eine Welt, wie sie sich Gabriele Kuby ausmalt, denn soviel lebenswerter und besser wäre als die heutige vermeintlich "entwertete" Welt. Das Bild des realen Horrors, das Kuby gebraucht, zeugt exemplarisch auch eher von einer Abstumpfung gegenüber dem realen Leiden, einer von Kuby selbst - für die Medien - propagierten "Abkopplung der Gefühle von der Wahrnehmung" (vgl. http://www.aktion-leben.de; abgerufen am 09.10.2007). Tatsächlich zeigen Studien, daß Menschen vermeintlich "gottgewollte" Gewalt eher als gerechtfertigt ansehen (siehe II.3.2). Dort schwingt die Vorstellung mit, daß Gott entweder über der Moral stehe oder daß alles, was er tue, nur ein Akt der Liebe sein könne.
2.1.14.3. Harry Potter
Auf ebenso bizarre und abenteuerliche Weise kritisiert Kuby die Jugendbuchreihe "Harry Potter". So bezeichnet sie diese als "umfassendes Projekt zur Umgestaltung unserer Kultur". Allerdings hat sie sich bei ihrer Aburteilung von "Harry Potter" auch konsequent bemüht, alle Punkte in möglichst schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Kubys Angriffe gehen letztlich sogar soweit, daß sie aller Kunst und Kultur die Existenzberechtigung abspricht, die nicht im Dienste der Religion steht (vgl. o.V. 2005, S.9). Der ewig polternde Kardinal Meisner gebrauchte für solche Kunst den verbrannten Begriff der "Entartung" (vgl. ):
(a) Kuby behauptet zum Beispiel, die Darstellung von Okkultismus animiere dazu, selbst okkulte Handlungen durchzuführen. Allerdings hat Kuby dann auch nicht verstanden, wie Literatur funktioniert: Ein Krimi kann zum Beispiel nicht ohne Leiche funktionieren, ein Problemroman auch nicht ohne Problem (vgl. o.V. 2005, S.4f.).
(b) Da in den Büchern das katholische Gottesbild nicht vorkommt, behauptet Kuby gleich, darin werde "der Glaube an einen liebenden Gott systematisch zerstört" (vgl. o.V., S.7).
(c) Eine weitere Absurdität ihrer eigenen Logik ist auch, daß da Harry mit "Voldemort, dem ganz und gar Bösen" verwandt sei, er gar nicht gut sein könne (vgl. ebd., S.7). Der Mensch wird also aus ihrer "christlichen Sicht" nicht für sich selbst bewertet und hat letztlich keinen freien Willen und keine Möglichkeit, sich von dem abzugrenzen, was Andere in seinem Namen getan haben. In der Bibel hieß es ja, der Nachkomme sei verantwortlich für die Taten seines Vorvaters (AT ; [Stelle "Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder"]) . Sinnigerweise konstruieren Kuby und ihre Glaubensgrundlage damit selbst gerade die vermeintliche Unentrinnbarkeit und Zwangsläufigkeit von Geschehnissen, die sie "Harry Potter" explizit vorgeworfen haben.
(d) Andererseits mag ein Punkt, warum Kuby "Harry Potter" derart diffamiert, auch in der Medienkritik begründet sein. So kommt auch die mittelalterliche Welt von Hogwarts nicht ohne Substitute für die modernen Medien aus. Medienkritik, die sich in Forderungen nach einer Abschaffung erschöpft, ist offenbar zu einfach. Sondern die Benutzung von Medien erfordert die Herausbildung von Medienkompetenz (vgl. o.V. 2005, S.5).
(e) Schließlich ist das "Argument" auch fraglich, wonach im Märchen grundsätzlich die Hexe/der Zauberer der Böse sei und deshalb auch in "Harry Potter" niemand das Gute wollen könne (vgl. o.V. 2005, S.). In den verschiedenen Mythologen gibt es sehr wohl auch "gute Hexen/Zauberer", so in der englischen Sagenwelt etwa den Merlin, der seine Zauberkräfte in den Dienst des Königs Arthur stellt. Betrachtet man andererseits die Darstellung von Hexen in Volksmärchen nach ihren Herkunftsregionen, so fällt auf, daß diese um so negativer dargestellt werden, je intensiver in der frühen Neuzeit der "Hexenwahn" in einer Region gewütet hatte (vgl. die Märchen- und Sagenforscherin Sigrid Früh in "vivo: Wozu Märchen?", 3sat, 08.11.2008). Da nun der Hexenwahn weniger mit dem Vorhandensein tatsächlicher Hexen als vielmehr mit dem religiösem Wahn zu tun hatte, kann man davon ausgehen, daß die Darstellung der Hexen bereits Konsequenz des damals herrschenden Glaubens ist. Die negative Bewertung ist entsprechend wohl eher aus dem in der christlichen Tradition besonders ausgeprägten Glauben motiviert, "die Zauberin" dürfe nicht am Leben gelassen werden (vgl. ), da sie grundsätzlich zerstörerische Kräfte ausübe. Hier liegt also ein Zirkelschluß vor, der als Argument gegenstandslos ist.
(Schließlich könnte Kuby auf die gleiche Weise - „Beweis qua Märchen“ - natürlich auch beweisen, daß häßliche Menschen grundsätzlich böse und schöne Menschen grundsätzlich gut sind. Was nun vollauf an den Haaren vorbeigezogen ist.)
Weiterhin betreibt auch das Christentum beständig Umwertungen. So wurden im Katholizismus die Götter der vorchristlichen Religionen, die er verteufelte und zu ersetzen suchte, mehr oder weniger zu Heiligen umgewidmet, zu denen man weiterhin beten konnte. Zu guter Letzt gibt es auch ein Kirchenlied mit dem Titel "Wie schön leuchtet der Morgenstern", womit der mythische Religionsstifter Jesus Christus gemeint wird (vgl. "Wie schön leuchtet der Morgenstern"; abgerufen am 02.11.2007). Im Alten Testament wird allerdings der Teufel mit dem Morgenstern assoziiert (vgl. Jesaja 14,12).
2.1.16 Der Kampf um die Deutungshoheit
[...]
2.1.15.1 "Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg"
Allerdings ist Gabriele Kubys energische Beschäftigung mit den vermeintlich kulturvernichtenden "Harry Potter"-Romanen nur ein Beispiel für die Beschäftigung der Politik mit den Ausflüssen unserer Kultur. In ihrem Versuch, mit diesen Gegenständen umzugehen, verlor die Politik gewissermaßen chronisch den Bezug zur Realität. Häufig genug log man sich selbst selbst in die Tasche.
Für mich ist der Film wichtig, da er den
Untergang sehr deutlich im Bild zeigt. Um die unglaubliche
Dimension dieser Katastrophe zu begreifen, ist es auch wichtig,
die Schreie zu hören und den Überlebenskampf zu sehen.
Von Nächstenliebe war damals nicht viel zu spüren.
(Heinz
Schön, Überlebender und Autor eines Buches über den
Untergang des "Kraft durch Freude"-Dampfers "Wilhelm
Gustloff", über den "sehr harten" Fernsehfilm
"Die Gustloff" (ZDF(!)))
Es ist ja nachgerade absurd, ein Stück nicht zu geben, weil die Gesellschaft, in der es entstanden war oder die dort dargestellt wird, nicht der eigenen entspricht. Trotzdem weigerte sich in den 1970er Jahren etwa der Bayerische Rundfunk (wieder einmal!), die "Sesamstraße" auszustrahlen, weil sie die Lebenssituation von Kindern in Bayern nicht adäquat darstelle, es in Bayern keine unterprivilegierten Kinder gebe (vgl. Wikipedia: Sesamstraße, abgerufen am 31.12.2007). Dies zeugt darüber hinaus nicht nur von einer Ignoranz gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen im eigenen Land, sondern letztlich auch von einer Arroganz gegenüber anderen Kulturen, die nach dieser noch dazu irrigen Vorstellung von den eigenen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen und Werten beurteilt werden. Auch Spartacus, Robin Hood, die französische Revolution oder der gescheiterte Hitler-Attentäter Georg Elser sind entsprechend heute nicht mehr historisch relevant und dürfen deshalb nicht mehr thematisiert werden. Zumal darüber hinaus sonst auch jemand erkennen könnte, daß viele Menschen sich heute durchaus so fühlen mögen wie die Menschen, die damals zur Selbstjustiz griffen, weil die Autoritäten kein Interesse daran hatten, ihr Verhalten wunschgemäß zu ändern. Aber schließlich muß man sich ja auch mit dem Möglichen bescheiden (s.o.).
Im Rahmen der Betrachtung der "Sozialisation von Kindern" beschäftigte sich die Bundeszentrale für politische Bildung mit der Wirkung von Kinderhörspielen auf das politische Bewußtsein (Strohmeier 2005).
1. [...] Kinder und Jugendliche werden andererseits vermutlich Referenzen auf Dinge, zu denen sie noch keinen Bezug haben, auch nicht ausdeuten.
2. Süffisant ist auch Strohmeiers Fazit. So würden Hörspiele suggerieren, "[d]ie 'richtigen' politischen Positionen bzw. Verhaltensweisen sind ökologisch, postmaterialistisch, basisdemokratisch, kritisch, zivilcouragiert, pazifistisch, sozial, antikapitalistisch, egalitär, tendenziell anarchisch bzw. antistaatlich, antihierarchisch, antiautoritär und antikonservativ; mit anderen Worten: 'links' der politischen Mitte (linksliberal bis linksalternativ)". Man lasse sich einmal auf der Zunge zergehen, welche Wünsche hier - in freilicher Überspitzung - von seiten des Autors geäußert werden: Man solle gefälligst ein bißchen mehr Befehl und Gehorsam üben und gefälligst auf das hören, was "oben" beschlossen wird; mehr konsumieren und Müll produzieren; sich nicht darum kümmern, wenn drei Meter weiter jemand zusammengeschlagen wird oder verhungert; den oberen Schichten ein bißchen weniger Verantwortung für die Gesellschaft abverlangen; und auch ein wenig kriegsbegeisterter sein.
Auch wurde schon thematisiert, ob Ernie und Bert aus der "Sesamstraße" oder die "Teletubbies" homosexuell seien (Wikipedia: Teletubbies, abgerufen am 31.12.2007). Man möchte sich natürlich fragen, ob dies wichtig sei, da ja tatsächlich eine sexuelle Neigung nicht durch Medien erworben wird. Die Macher der "Sesamstraße" selbst hielten übrigens fest, daß es keine sexuellen Bezüge in der Sendung gibt, zumal auch Kinder im Zielgruppenalter diese nicht erkennen könnten (vgl. ). Und auch die Erfinderin von "Benjamin Blümchen" wollte keine politische Weltsicht entwerfen, sondern wurde viel mehr dafür beklagt, daß ihre Geschichten zu wenig pädagogischen Inhalt hätten (vgl. ). Andererseits aber ist diese Kritik tatsächlich von der Vorstellung getragen, es handle sich bei Medieninhalten um Projekte zur Umgestaltung unserer Kultur - ganz so, als seien sie nicht erst Produkte unserer Kultur. Diese Inhalte verbieten zu wollen, zeugt also ebenfalls davon, die Haltungen und Probleme unserer Kultur nicht sehen zu wollen. Ohne Kriegsfilme wird es jedenfalls keinen Krieg weniger geben. Wenn auch vielleicht weniger Wehrdienstverweigerer;
2.1.15.2 "Sofortprogramme" und andere Katastrophen
Die Verweigerungshaltung sei nicht
jugendtypisch, erklärte die Staatsanwaltschaft"
(o.V.,
"Bundeswehr/Staatsanwaltschaft mit Jugendstrafe nicht
einverstanden. Totalverweigerer kommt wieder vor Gericht",
Bietigheimer Zeitung vom 16.12.2007)
Es gibt nach den Forschern, auf deren Studie man sich bezieht, zwar keine wissenschaftlich haltbaren Beweise für eine Schädlichkeit von Computerspielen -- deshalb müssen Computerspiele verboten werden!
Am 19.12.2007 beschloß die deutsche Bundesregierung einen Entwurf zur weiteren Verschärfung des Jugendschutzgesetzes. Danach sollen automatisch "gewaltbeherrschte" Computerspiele und andere Medien indiziert - d.h. "mit weitreichenden Abgabe-, Vertriebs- und Werbeverboten" belegt und insbesondere Jugendlichen nicht mehr zugänglich gemacht werden -, die "besonders realistische, grausame und reißerische Gewaltdarstellungen und Tötungshandlungen beinhalten, die das mediale Geschehen selbstzweckhaft beherrschen". Dieser Entwurf knüpft an das von Ursula von der Leyen propagierte "Sofortprogramm" an, dessen Ziel es war, "den Jugendschutz entscheidend zu verbessern". Darunter sollten Medien bereits dann indiziert werden, wenn sie "gewalthaltig" sind (vgl. "Gewalt in Videospielen: Killerspiel-Gesetz noch in diesem Jahr", abgerufen am 22.12.2007). Bei ihrer Beurteilung beruft sich die Regierung auf ein Gutachten des Hamburger Hans-Bredow-Institutes (Brunn et al. 2007), das angeblich entsprechende Empfehlungen enthalten soll (vgl. heise.de, abgerufen am 21.12.2007).
Tatsächlich hatte die federführende Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen ihr "Sofortprogramm" aber aufgelegt, bevor die Studie des Hans-Bredow-Institutes überhaupt vorlag (vgl. golem.de, abgerufen am 21.12.2007), so daß auch dieser Vorstoß einmal mehr den Eindruck erweckt, "daß man ja schon immer wußte". In der Studie findet sich schließlich der bedeutungsschwere Satz, "[e]in eindeutiger empirischer Nachweis, dass violente Bildschirmspiele aggressive Emotionen fördern, konnte bislang nicht erbracht werden" (Hans-Bredow-Institut 2007, zitiert nach Lindemann 2008).
Wenn man ansonsten die Kriterien untersucht, unter denen Computerspiele automatisch indiziert würden - so sollen künftig Spiele indiziert werden, in denen - nach Ursula von der Leyens eigenen Worten - "die Spieler für Folter und Gewalt, die sie selbst ausüben, eigens belohnt werden, also einen Bonus erhalten, zum Beispiel in den nächsten Level gehen können" (Deutscher Bundestag 2008, S.107 [bzw. Gesamtprotokoll S.16209]). Nun ist mir kein einziges Spiel gegenwärtig, in dem der Spieler eine virtuelle Figur foltern könnte. Andererseits werden - ganz wertfrei - nun tatsächlich nicht nur Egoshooter, sondern auch Rollenspiele, Echtzeitstrategiespiele etc. von einer Indizierung bedroht. Es sei zum Vergleich nur einmal daran erinnert, daß man in Rollenspielen ganz ohne virtuelle Gewaltanwendung auch nicht weiterkommt. Ein einigermaßen aktuelles Rollenspiel, das natürlich auch seine Kämpfe deutlich darstellt, ist "Elder Scrolls: Oblivion". Das bisher "ab 12" freigegebene Spiel (vgl. Wikipedia:The Elder Scrolls, abgerufen am 21.12.2007), wäre danach nur noch für Erwachsene unter dem Ladentisch erhältlich.
Als ein weiteres Indizierungskriterium für Medien wird angeführt, wenn in ihnen "Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahe gelegt wird" (vgl. "Stigma Videospiele", abgerufen am 21.12.2007). Auch dieses Kriterium ist allerdings so schwammig, daß darunter auch Themen wie "Spartacus" oder "Robin Hood" fallen, die in ihrer Lebenswelt keine Gerechtigkeit erfuhren und daher zur bewaffneten Selbsthilfe griffen. Die Vorstellung, der Sklave Spartacus hätte damit Erfolg gehabt, hätte er seinen Herren darum gebeten, ihn und seine Mitsklaven doch menschlich zu behandeln oder freizulassen, ist wohl als blauäugig einzustufen. Hier wird wohl angenommen, daß alle dargestellten Kontexte im Licht des heute Erreichten bewertet werden müßten. Demnach wären der reale Spartacus und der legendäre Robin Hood, die ja für ihre Freiheit gekämpft hatten, verachtenswerte Massenmörder (vgl. dazu die Darstellung zu Pfeiffers "Weltbild auf christlicher Grundlage", s.o.).
Aber auch die von Pfeiffer so geschätzten Prügelfilme von Eddie Constantine (vgl. "Der will nur Killer spielen": Jugendgewalt und Medien, abgerufen am 22.12.2007) oder Bud Spencer und Terence Hill, in denen Gewalt mit Humor verknüpft wird und bei den Beteiligten nicht zu ernsthaften Verletzungen führt, oder auch die Filme mit den sympathischen und leicht dümmlichen Ganoven der Olsen-Bande, könnten dem neuen "Jugendschutz" unterfallen.
Verständlicherweise, wie bereits auch die von mir kursiv gesetzten Begriffe aufzeigen, kritisierte umgehend auch der Branchenverband Bitkom die Schwammigkeit der Gesetzesvorlage, die letztlich nur mehr Rechtsunsicherheit schaffe (vgl. heise.de, abgerufen am 21.12.2007).
Auch ist festzuhalten, daß bereits die bestehenden Jugendschutzbestimmungen in Deutschland die schärfsten in einem demokratischen Land sind. Es ist einfach die Frage zu stellen, ob die deutschen Jugendlichen (und was das betrifft, auch die Erwachsenen) besonders sensibel sind.
2.1.15.3 "Dulce bellum inexpertis"?
"Nur denen, die ihn nicht erfahren haben,
scheint der Krieg schön."
(Erasmus von Rotterdam
in Anlehnung an Pindar)
Im Anschluß an den Humanisten Erasmus von Rotterdam könnte man nun außerdem die These äußern, es gebe ein Bestreben, den jungen Menschen die Darstellung der Konsequenzen von Gewalt zu "ersparen", um die Akzeptanz weiterer Waffengänge zu erhöhen. Jedenfalls paßt dazu, daß die deutsche Bundesregierung ihrerseits bestrebt ist, Szenarien zu erschaffen, in denen die Anwendung von Gewalt vermeintlich akzeptabel ist.
Nach einer Untersuchung von Brady und Matthews (2006) zeigen Personen, die Erfahrung mit Computerspielen haben, wahrscheinlicher eine Ablehnung gegenüber Gewalt (r = -0.13 bzgl. Befürwortung von Gewalt als Lösungsweg bei Problemen)(vgl. S.345, Tabelle 2). Und tatsächlich sind die meisten derjenigen, die gewalthaltige Computerspiele spielen, Wehrdienstverweigerer (vgl. www.counter-strike.de, abgerufen am 02.01.2008). Es ist wohl eher nicht davon auszugehen, Spieler seien besonders militäraffin oder müßten ein geringes Selbstwertgefühl kompensieren, da sie sich ja bewußt gegen den Wehrdienst entschieden haben und es vielleicht auch ein wichtiger Schritt ist, darüber zu entscheiden, daß man nicht zehn Monate seines Lebens dort verbringen will, wo der Staat einen lieber hinhätte. Man sollte vielleicht fragen, ob - wenn gewalthaltige Computerspiele angeblich die Denkhaltungen beeinflussen - sie nicht Menschen eher die Denkhaltung vermitteln mögen, es vermeiden zu wollen, Derartiges in der Realität erleben zu müssen, wo sie als Soldaten von ihren Vorgesetzten in tatsächlich existenzbedrohliche Situationen versetzt werden, die vielleicht von vornherein schon einkalkuliert haben, daß Einige von ihnen auf der Strecke bleiben werden.
2.1.15.4 Das Nicht-Wissen-Wollen
Nun will die Politik vielleicht aber auch gar nicht wissen, warum Jugendliche gewalttätig werden oder ggf. amoklaufen (vgl. Reichert 2007, S.18). So kann man entsprechend aber auch keine zielführenden Lösungsansätze entwickeln, sondern kann letztlich nur intuitive Urteile abgeben oder in unnützen Aktionismus verfallen. Es reicht eben nicht einfach aus, Maßnahmen damit zu begründen, "Robert Steinhäuser habe".
Bezeichnenderweise wurde aber gerade dies getan. Nachdem bekannt geworden war, daß Steinhäuser eine "Pumpgun" besessen und mit einem Pistolengriff umgebaut hatte (vgl. etwa Gasser et al. 2004, S.326f.), war im Nachhall von dessen Amoklauf diese eine solche Waffe verboten worden (vgl. ebd., S.326f.; Wikipedia:Vorderschaftrepetierflinte, abgerufen am 21.12.2007), trotzdem Steinhäuser diese Waffe bei seinem Amoklauf gar nicht verwendet hatte (er hatte nur mit seiner Pistole um sich geschossen) (vgl. Wikipedia:Amoklauf von Erfurt, abgerufen am 21.12.2007; Gasser et al. 2004, S.54+327). Der Besitz einer "normalen" "Pumpgun" ist allerdings mit Waffenbesitzkarte weiterhin erlaubt. Allerdings dürfte es einem Amokläufer ohnehin ziemlich gleichgültig sein, ob seine "Pumpgun" je nach dem verwendeten Griff 20 cm länger oder kürzer ist, wenn er diese zum Einsatzort transportiert.
Aus den Ausführungen in Gasser et al. (2004) wird übrigens eine deutliche Umwertung deutlich. So werden Steinhäusers Handlungen während der Vorbereitung seines Amoklaufs im Jahr 2002 in den Kontext des Waffengesetzes von 2003 gesetzt, das diese Bestimmungen enthält. Obwohl die Bestimmung in diesem Kontext letztlich keinen Sinn hatte, da mit der genannten Waffe nicht geschossen wurde, wird darauf gepocht, daß, hätte es diese Bestimmung schon vorher gegeben, Steinhäuser seine Waffe auch nicht hätte umbauen können. Also hätte man nur schon vorher wissen müssen, was man ohnehin schon immer wußte, nämlich daß der zuvor legale Umbau einer "Pumpgun" mit einem Pistolengriff eigentlich das Kennzeichen einer illegalen Waffe sei (vgl. S.327). Nun hätte Steinhäuser seinen Amoklauf nicht begehen können, hätte er keine Möglichkeit gehabt, an Waffen zu gelangen. Allerdings verändert die Form des Griffs nicht den Schaden, der durch die Waffe verursacht wird, und ist einem Amokläufer vermutlich gleichgültig, ob der Besitz seiner Waffe legal ist, so daß die "besondere Gefährlichkeit" eines Pistolengriffs nicht so ganz nachzuvollziehen ist. Auch geht man hier anscheinend von einem gewissen "Rechtspositivismus" aus, daß nämlich durch eine Gesetzgebung für alle Zeiten - und vor allem auch rückwirkend - entschieden werden könnte, welches Verhalten "schon immer" unmoralisch oder ungesetzlich gewesen sei.
Vielleicht steht aber auch ein "magisches Denken" dahinter. In einer derart magischen Vorstellung von der Welt, wie sie in diesem Kontext gepflegt wurde, mag bereits die Aura des Täters auf den Gegenstand unwiderruflich übergegangen sein, auch wenn dieser Gegenstand tatsächlich keinen weiteren Bezug dazu hat. Seine Verwendung ist damit auf alle Zeiten suspekt. Ein Beispiel dafür ist das Hakenkreuz, das in Deutschland insbesondere als Logo der NSDAP bekannt ist. Das Hakenkreuz war allerdings lange vor dem Nationalsozialismus bekannt. So gilt es in Asien als Glückssymbol, wurde auch im Christentum verwendet, und ist dort jedenfalls nicht als Sympathiebekundung für die Ideologie Hitlers zu verstehen (vgl. Wikipedia:Hakenkreuz, abgerufen am 21.12.2007). Ebenso suspekt sind natürlich dann das Computerspiel und Goethes Werther... .
2.1.15.5 Immer weniger Verbrechen
Zum anderen aber ergehen sich Menschen gerne in Hexenjagden, in denen sie immer wieder leichte "Schuldige" und "Lösungen" ausmachen wollen. Nachdem zu Weihnachten 2007 einmal ein Fall auf einem Überwachungsband dokumentiert worden war, daß zwei Jugendliche einen Rentner schwer verletzten, suchten die Medien und nicht zuletzt auch die Reflexpolitiker wieder einmal zu suggerieren, es gebe eine kritische Häufung von brutalen jugendlichen Gewalttätern. Tatsächlich gibt es seit Jahren immer weniger jugendliche Straftäter. Der Anstieg kann vielmehr durch eine Erhöhung der Anzeigequote erklärt werden (vgl. "Immer mehr Straftaten durch Jugendliche?", abgerufen am 04.01.2008). Auch ist zu bedenken, daß die Polizeiliche Kriminalstatistik, auf die man sich da beruft, zu allererst einmal eine Tatverdächtigenstatistik ist (vgl. Blumentritt 1998). Wenn man also von einem Anstieg der "Kriminalit„t" bei den Jugendlichen spricht, so k”nnte das auch daran liegen, daá Jugendliche heute ein Stチckweit indiskriminiter verd„chtigt werden als vorher. Allerdings greifen viele Politiker gerne Statistiken auf, verkürzen diese im Sinne ihrer ideologischen undgesellschaftspolitischen Vorstellungen und verkünden, wo sie zuvor die Menschen nicht ernstnahm (vgl. ), genauso schizophren, sie nehme deren Rufe ernst und "tue etwas". Sprich, man schlägt mit Vernichtungskriegsrhetorik auf einen der "üblichen Schuldigen" ein oder propagiert Radikallösungen. Dabei scheinen viele Politiker seltsam unzurechnungsfähig zu sein, daß sie sich nicht vor der Perversität ihrer eigenen Vorschläge erschrecken. Und gerade diejenigen Politiker, deren Freizeitbeschäftigungen vielleicht Anderen als besonders pervers erscheinen oder besonders große Kriegsredner sind, stellen sich dort immer als besonders moralisch dar.
Auch paßt ja nicht ganz zusammen, daß einerseits immer wieder Statistiken oder Bilder präsentiert werden, mit denen suggeriert wird, daß die Jugendkriminalität dramatisch angestiegen sei (vgl. ), während andererseits anders gelagerte Untersuchungen für den gleichen Zeitraum aufzeigen, daß die Jugendkriminalität seit mindestens Ende der 1990er Jahre beständig zurückgegangen ist. Auch war dabei festgestellt worden, daß gewalthaltige Medien nur für "übertrieben streng oder gewaltsam erzogene[.] Jugendliche[.]" ein Problem bedeuten (vgl. "Trend: Jugendkriminalität in Deutschland nimmt ab" ("Die Welt" vom 06.09.2007), abgerufen am 21.05.2008). Also besser verschweigen und Bilder von Jugendlichen zeigen, die dann doch zugeschlagen haben. Es ist schließlich billiger, Verbote für Millionen Spieler zu erlassen als das Recht der Jugendlichen auf eine gewaltfreie Erziehung durchzusetzen. Nach der gleichen Logik konnte man allerdings auch Alkohol und Autos verbieten. Denn massiver Alkoholkonsum mit der damit verbundenen Enthemmung und dem Kontrollverlust ist der wichtigste Auslöser für Gewalttaten (vgl. ), und manche Menschen halten sich auch nicht an die Verkehrsregeln.
2.1.15.6 Hauptsache ist die Suggestion einer Wirkung
Dabei ist der Wahrheitsgehalt von Äußerungen ziemlich gleichgültig, sondern es wird zuerst abgerufen. Im Nachhall eines "Holzklotzattentats", bei dem durch einen von einer Autobahnbrücke geworfenen sechs Kilo schweren Holzklotz eine Frau getötet wurde, wurde zunächst propagiert, dies sei die Tat von Jugendlichen gewesen, denen dann auch massenhaft DNA-Proben abgenommen werden sollten (vgl. "Fahnder erwägen Gentest mit 1200 Jugendlichen", abgerufen am 21.05.2008). Hubert Maessen, ein Kommentator beim WDR-Radio, forderte entsprechend die Eltern auf, doch genauer nachzuprüfen, was ihre Kinder denn auf dem Computer so spielten (vgl. "Todeswürfe auf der Autobahn - was tun?", abgerufen am 21.05.2008). Ganz unabhängig davon, daß schon (im Rahmen des Verstandes) auf die Alterseinstufung geachtet werden sollte. Allerdings suggerierte die Einlassung an dieser Stelle einmal mehr, daß das Spielen von gewalthaltigen Computerspielen ein Auslöser oder Indikator für eine Gewalttätigkeit von Jugendlichen in der Realität sei. (Ist der Konsum von gewalthaltigen Computerspielen tatsächlich ein Indikator, wie die Vorstellung der Selektion impliziert, so nähme man sich mit einem Verbot einfach nur ein allerdings grobes Meßinstrument.) Fast zwei Monate später stellte sich dann heraus, daß ein 30jähriger Drogenabhängiger die Tat aus allgemeinem Frust begangen hatte (vgl. "Junkie gesteht Holzklotz-Wurf: Aus Frust gehandelt", abgerufen am 21.05.2008).
Allerdings war es den Medienkritikern völlig gleichgültig gewesen, ob ihre Einlassungen denn faktisch zu rechtfertigen waren. Sondern es wurde erst abgerufen und eine Suggestion aufgebaut, die eigene Intentionen plausibel machen sollte. So sollen die gewalthaltigen Computerspiele nun indiziert werden, die man als Verursacher von Gewalt "festgemacht" hatte, obwohl in anderen Studien der Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt sich letztlich als Scheinkorrelation darstellte (vgl. Kristen 2006, S.72), und sinnigerweise die besonders gewalttätigen Jugendlichen besonders wenig Computerspiele spielen (vgl. ). Auch sollten "Experten" wie Weiß, Hopf und Pfeiffer vielleicht einmal erklären, welche Faktoren denn in den vergangenen Jahren sich so positiv entwickelt haben, um die vermeintlich immer zerstörerischere Wirkung der vermeintlich Gewaltexzesse auslösenden "Killer- und Metzelspiele" derart überzukompensieren, daß dennoch die Gewaltprävalenz sinken konnte.
Eine andere in dieser Hinsicht dysfunktionale Statistik befaßt sich mit der Häufigkeit von bullying-Aktivitäten in der Schule (). So berichteten in den Jahren 1997/1998 mehr als zwei Drittel der befragten deutschen 13jährigen, sie hätten im vergangenen Jahr (Cave: explizite Zeitangaben in Schätzfragen können zu einer Verfälschung, insbesondere Überschätzung führen) an solchen Aktivitäten teilgenommen, acht Prozent sogar jede Woche. Der Anteil der befragten 13jährigen englischen Jugendlichen, die an solchen Aktivitäten teilgenommen hatten, betrug allerdings nur 14.8%, wobei nur 1.2% jede Woche teilgenommen hatten. Für Wales und Schottland betrugen die Anteile der mobbenden Schüler mit 21.4% bzw. 26.1% (vgl. Mercy et al. 2002, S.30). Zum Vergleich sollte bemerkt werden, daß in Großbritannien eine Einstufungsinstanz wie die FSK nicht existiert (vgl. ), daß zum Beispiel Spiele weniger häufig unter den Ladentisch gedrängt oder geächtet werden.
Aber der Eindruck einer "zunehmenden Gewaltproblematik" war nun einmal geschürt. Schnell äußerten entsprechend Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch andere CDU-Politiker, sie seien sehr für Verschärfungen des Jugendstrafrechtes, etwa für die Einführung von "Warnschußarresten" oder von "boot camps" (vgl. ). Von den US-Lagern ist bekannt, daß die dortigen "Betreuer" mit vernachlässigbarer pädagogischer Qualifikation Jugendlichen mit militärischem Drill vermitteln, daß die wichtigste Tugend einer "freien Gesellschaft" es ist, das zu tun, was Andere Einem sagen, sie massivst demütigen und Epileptiker und Herzkranke als vermeintlich "renitente Fälle" besonders hart, zum Teil bis zum Tod, schleifen (vgl. ). Aber auch der Leiter des deutschen "Vorzeigelagers" "Gut Kragenhof", der Boxer Lothar Kannenberg, bedient sich nicht gerade "pädagogischer" Methoden (vgl. "Jugendhilfe zwischen Märchenmühle und Wahnhausen", abgerufen am 05.01.2008). Es ist nicht logisch nachzuvollziehen, daß es nützen würde, einen Jugendlichen einzusperren, der sich schon in "Freiheit" fühlt wie in einem Gefängnis (siehe vgl. "Schulschwänzer - Abschreckung wirkt nicht", abgerufen am 30.10.2007). In den USA stiegen ansonsten die Verbrechensraten besonders dort an, wo man aus Furcht vor vermeintlich immer häufiger werdendem Verbrechen auch die Strafen immer weiter erhöht hatte. Denkbar ist etwa, daß ein jugendlicher Handtaschenräuber - zwar dysfunktional, da die Aufklärungsrate bei Tötungsdelikten deutlich höher ist -, der dann für seine Tat doch nicht für fünf Jahre im Gefängnis verschwinden will, die Beraubte erschlagen wird, um zu verhindern, daß diese ihn beschreiben oder identifizieren kann.
2.1.15.7 Paradoxien
Allerdings ist es fraglich, ob diese "Revolution" der Betrachtung von Gewaltdarstellungen zu einer Abnahme von Gewaltakten führen wird (zum Letzteren siehe Abschnitt V.3). So gibt es sehr wohl die Feststellung, daß besonders gewalttätige Menschen qua ihres Lebensstils besonders wenige dieser Medien konsumieren (vgl. ). Und Jugendliche aus der Unterschicht, die den größten Teil der Klientel der angeblich besonders gewalttätigen Hauptschüler ausmachen, spielen auch eher wenig diese vermeintlich amoklaufauslösenden Spiele (s.u.). [Die einzige aus wissenschaftlicher Sicht gesicherte Wirkung solcher Maßnahmen wäre wohl der "komfortablere[.]" Konsum von Gewaltdarstellungen, da hier die Folgen nicht mehr dargestellt werden, verbunden mit einer Vergrößerung des Risikos sozialschädlicher Effekte (vgl. Kimm 2005, S.110f.).] Ansonsten gibt es auch keine nennenswerte "Präventivwirkung des Nicht-Wissens" (Birkel und Thome 2004, S.7), haben Überregulierungen im Gegenteil sogar schädliche Wirkungen (siehe V.2.3). Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, so sind Zeugnisse für gewalttätiges Handeln Jahrtausende älter. Irgendwann mußte also jemand mit der Gewalt begonnen haben, dem diese zuvor nicht gezeigt worden war, und der sie trotzdem anwandte (vgl. dazu die These von Pfeiffer, es brauche schon ein gewalthaltiges Computerspiel, bevor jemand, der jahrelang im Elternhaus verprügelt oder in der Schule gemobbt wurde, gegen seine Umwelt gewalttätig werde).
Wie ansonsten Matthias Dittmeyer festhält, beträfe eine Indizierung auch gerade die falsche Zielgruppe. Vordergründig wird als Zweck der Indizierung angegeben, daß Jugendliche nicht über für sie als gefährdend eingestufte Medien informiert werden und diese entsprechend nicht unter ihnen zu Kultobjekten werden könnten. Für Erwachsene sollten solche Spiele weiterhin erhältlich bleiben, wenn "unter dem Ladentisch". Allerdings könnte damit genau das Gegenteil erreicht werden. Jugendliche haben die Möglichkeit, sich spätestens in der Clique über Neuerscheinungen von Spielen zu informieren. Bei Erwachsenen ist dies jedoch seltener der Fall (vgl. "Stigma Videospiele", abgerufen am 31.12.2007).
2.1.17 Der Versuch eines Fazits
2.1.17.1 XXXX
In den vorangegangenen Abschnitten wurden nun eine ganze Reihe von Medienkritiken dargestellt und auch ein Stückweit analysiert. Dabei wurde deutlich, daß viele Medienkritiken und Kritikerargumente der Vergangenheit wie der Gegenwart nach einem bestimmten Muster aufgebaut sind.
(1) Ein erster Schritt ist die Definition eines vermeintlichen gesellschaftlichen "Wertes" oder "Geschmacks", der von allen kulturellen Artefakten und Entäußerungen einzuhalten ist. Alles, was davon abweicht, wird als falsch oder schlecht dargestellt. Beispiele hierfür sind etwa Klaus Miehlings Darstellung, daß von allen Musikformen allein die klassische Musik als wertvoll zu betrachten sei (vgl. Codex flores Kritiken, abgerufen am 29.09.2008), oder Joachim Meisners Begriffsbildung, Kunst, die nicht der Gottesverehrung diene, sei "entartet" (vgl. Kardinal-Predigt: Meisner warnt vor "entarteter" Kultur, abgerufen am 09.06.2008). Wie insbesondere diese Vorstellungen zeigen, die – im Unterschied zur Hetze gegen Computerspiele(r) - kaum mehrheitsfähig sind, müssen derartige Forderungen kaum dem „gesunden Menschenverstand“ entsprechen, von dem sie aber glauben, daß sie diesen abbildeten. Genauso wenig wie mit Miehlings Begriff von „musikalischer Kultur“ oder Meisners Begriff von „Kunst“ muß man aber zum Beispiel mit Schünemanns Vorstellung von einem „gesunden Menschen“ einverstanden sein – daß man zum Beispiel zu Jagd und Schützenvereinen durchaus geteilter Meinung sein kann, wurde schon herausgearbeitet.
(Nur kommt es, wie die Gästeauslese bezüglich Computerspielen zeigt, eben letztlich nicht darauf an, wie die Realität beschaffen ist – sofern man bei wie auch immer gearteten Kulturerzeugnissen von Realitäten sprechen kann -, sondern lediglich auf die Geisteshaltung der Macher, welches Meinungsbild transportiert und als „gesunder Menschenverstand“ suggeriert wird.)
(2) Die Rolle eines kulturellen Erzeugnisses wird im Rahmen dieser Darstellung monokausal definiert. Auf Basis dieses Kulturverständnisses erfolgt dann die Darstellung der vermeintlichen Konsequenzen der Existenz bzw. des Konsums des entsprechend bemängelten Gegenstandes. Beispielhaft genannt sei hier die Sichten von Meisner und Kuby, daß Kunst generell dazu verpflichtet sei, die Menschen "zum rechten Glauben" zu führen, oder die Auffassung der Spielekritiker Hänsel und Hänsel, daß das Spiel seinen Spieler auf eine bestimmte zukünftige Rolle vorbereite, oder Pfeiffers Auffassung, daß etwas, das man tut, grundsätzlich einen Zweck zu verfolgen habe (jeweils s.o.).
(3) Alles, was in die abgewertete Kategorie fällt, wird der denkbar schlechtesten Interpretation unterzogen, um diesen "Verriß" zu rechtfertigen. Dies wird geleistet, selbst wenn man sich damit selbst in Widersprüche manövriert. Dazu zählen auch Kommentare von Nutzern dieser Medien, die grundsätzlich so interpretiert werden, als seien sie der dargestellten Verderbnis bereits anheimgefallen. Als Beispiele genannt seien hier etwa die bereitwillige Aufnahme von Kommentaren von Spielern, die sich selbst als "süchtig" oder "aggressiv" darstellen, zur Bekräftigung der eigenen Argumentationen, während andererseits Menschen, die gegen Äußerungen auftraten, die sie als Hetze betrachteten, als ignorant, abgestumpft, dumm oder rechtsradikal dargestellt werden. Auf die Argumente von Menschen, die mit solcherart rhetorischen Keulen bedacht wurden, mußte man noch niemals hören, und so kann man sie auch hier getrost ignorieren. Außer eben, wenn sie die eigenen Argumentationen stützten.
Aber auch gegen Argumentationen, in denen etwa Gegenbeispiele präsentiert werden, hat der Medienkritiker seine „Kritik“ „immunisiert“, indem nämlich auch diese Gegenbeispiele bzw. ihre Eigenschaften als Beispiele der „Entartung“ dargestellt werden. Dabei macht es dem Medienkritiker ggf. auch nichts aus, genau das Gegenteil von dem auszusagen, was er zuvor erklärt hatte. So hatte Christian Pfeiffer etwa darauf hingewiesen, mit Hilfe eines Computerspiels könne zuckerkranken Kindern dabei helfen, den richtigen Umgang mit ihrer Krankheit zu erlernen (s.o.). Die Einwendung, daß auch ein Kind zunächst einmal eingewiesen werden müßte, wenn es sich Insulinspritzen setzen muß, steht natürlich diametral Pfeiffers Position gegenüber, ein Jugendlicher könne allein durch das Computerspiel die Bedienung einer Schußwaffe erlernen. Angesichts der technischen Details, die sich zu einem guten Teil auch in einer einübungsintensiven Wartung und Bedienung von Waffen niederschlagen (vgl. Wikipedia: AK-47, abgerufen am 20.08.2009), und der damit auch noch immer nicht begriffenen und gemeisterten Physik von Waffen, die sich nur am echten Exemplar einüben läßt, ist dies aber kaum nachzuvollziehen.
Andere Beispiele sind der Dualismus zwischen Postman, der ein Medium als zu oberflächlich und informationsarm, und Spitzer, der es als zu informationsreich kritisiert hatte (s.o.). Serien wie „Star Trek“ oder „Raumpatrouille“ wurden von der Kritik als „zu anspruchsvoll“ - und damit auch das Fernsehen als Medium zur leichten Unterhaltung - angesehen (vgl. Wikipedia: The Cage (Star Trek: The Original Series; Wikipedia: Raumpatrouille, abgerufen am 19.08.2009), gleichzeitig aber immer die „Verblödung durch das Fernsehen“ behauptet und gerade Unterhaltungssendungen als Vorreiter dieses Phänomens angeprangert. Nach heutigem Verständnis werden diese Serien ggf. aber als zu eindimensional angesehen (vgl. "Commander McLane allein im All", abgerufen am 19.08.2009), hier wird also im Gegenteil formuliert, daß der Anspruch heute höher sei.
Manchmal findet sich hierin auch eine „Qualifizierung“ insofern, daß ja nicht alle Erzeugnisse dieses Mediums rundweg abzulehnen seien, worunter dann bestimmte Bedingungen formuliert werden, die aber einerseits unter der oben genannten Rollenbindung stehen und andererseits ggf. so überzogen sind, daß das Medium sie gar nicht leisten kann. Im Endeffekt stellen diese damit rhetorische Tricks dar, mit denen umgekehrt bekräftigt werden soll, daß das Medium auch das, wofür es einsetzbar sei, nicht leisten könne. Beispiele hierfür sind etwa die „Qualifikation“ Christian Pfeiffers, man könne für Jugendliche, die anders nicht zu erreichen seien, ja Lernspiele entwickeln – dies natürlich von der Vorstellung getragen, daß Computerspiele nur etwas für Jugendliche seien, da sich wohl ernsthaft kein Erwachsener das Einmaleins beibringen lassen wollte -, oder die Äußerung von Sabine Schiffer, man könne mit dem Computer Kindern das Schreiben im Zehn-Finger-System beibringen.
Ggf. wird diese widersprüchliche Universalkritik als Beweis dafür dargestellt, daß man sich mit dem Medium schon „ganzheitlich“ auseinandergesetzt habe, auch wenn häufig andere Äußerungen eine andere Sprache sprechen.
(4) Schließlich wird mit Hilfe der Argumentation die "Entartung" jenes kulturellen Gegenstandes als entscheidende Ursache für bestimmte tatsächliche oder vermeintliche Mißstände in der Geselschaft dargestellt. Um dies tun zu können, wird jede andere Ursache konsequent "wegdiskutiert". Beispiele für diesen Vorgehensschritt sind etwa die Argumentation Pfeiffers, Jugendliche, die psychisch krank oder exzessive Waffennarren sind oder sich sonst schon psychopathisch verhalten, würden erst dann zu einer Gefahr für die Gesellschaft, wenn es dann noch Computerspiele gebe (ob sie diese gespielt hatten oder nicht), oder auch Klaus Miehlings Versuch, den Konsum von Technomusik für das technische Versagen des deutschen Autobahn-Mautsystems verantwortlich zu machen (vgl. Codex flores Kritiken, abgerufen am 29.09.2008).
Dabei fällt auch weiterhin das Muster auf, daß Medienkritiker sich kaum mit dem von ihnen kritisierten Medium auseinandergesetzt haben, sondern die Informationen, auf die sie sich stützen, ihnen aus anderer Hand "kolportiert" und "hinterbracht" wurden oder sie sich diese "intuitiv" erschlossen haben, so daß er nun – zumindest in seiner Weltsicht – argumentieren kann, seine Auffassung sei doch „ganz offensichtlich“.
(5) Die Fundamentalkritik an einem Medium läßt sich auch anhand der Begrifflichkeiten und Formulierungen nachweisen, die von Medienkritikern benutzt werden. So sind diese unscharf bzw. nachgerade allumfassend oder auch verallgemeinernd. Der Begriff des „Killerspiels“ ist schon nicht präzise definiert. In den Äußerungen von „Frontal 21“ tauchte dann aber auch der Begriff der „Metzelspiele“ auf, unter die nicht nur die „Killerspiele“, sondern auch Spiele definiert wurden, die Gewaltanteile haben, aber nicht unter die ominösen „Killerspiele“ zu fassen seien ().
Schließlich werden die Angriffe auf das ganze Medium ausgedehnt. So gehe es „in allen Computerspielen“ „immer nur ums Töten“ oder machten sie alle süchtig („Panorama“), seien eigentlich alle Computerspiele nach dem gleichen Muster aufgebaut (Schiffer ), oder wird auch die These aufgestellt, daß Computerspiele „per se“ aggressive Kognitionen hervorrufen (vgl. Narveaez+Metton 2006) – als Forschungsfrage mag diese eben in Ordnung sein, und die Autoren sagen auch deutlich, daß es für diese These keine Beweise gibt, jedoch werden zum Teil auch Thesen, die gar nicht aufgestellt oder gar bewiesen werden, als die entscheidendenden „Erkenntnisse“ von Studien dargestellt (vgl. )--, seien alle (jugendlichen) Internetnutzer kriminell (vgl. Miehling), und sieht Michael Spitzer eine E-Mail, die er erhalten haben will, als Beweis für seine These, daß alle Computerspieler potentielle Mörder und Amokläufer seien.
Manchmal wird andererseits auch mit Gemeinplätzen gearbeitet, die in der Sache zwar richtig sein mögen, aber keinen praktischen Wert haben, weil sich diese Aussage ebensogut auch auf andere Sachverhalte übertragen läßt: Beispiele hierfür sind etwa Gerald Hüthers Äußerung, Computerspiele (seien gefährlich, weil) sie das Gehirn umstrukturierten, und dann finde man sich nicht mehr in der Realität zurecht (). Diese Aussage ist natürlich aber auf jede andere Tätigkeit anwendbar, da grundsätzlich alles, was man tut, das Gehirn umstrukturiert, und andererseits dürfte auch eine Person, die ihr ganzes Wissen über die Welt oder über Frauen aus der Bibel oder aus Texten von Petrarca bezogen hat, mit falschen Vorstellungen herangehen. Auch kann wohl grundsätzlich alles süchtig machen, was im Gehirn zu einer Ausschüttung von Endorphinen führt. Und auch die Aussage, Computerspiele führten wegen des dabei erlebten Stresses zur Ausschüttung von Adrenalin, und dies führe zu Herz-Kreislauferkrankungen (vgl. ), relativiert sich beispielsweise dadurch, daß erklärt wird, daß Männer, die mit ihren Partnerinnen einkaufen gehen, in diesen Situationen ein Ausmaß an Streß empfänden wie Kampfpiloten im Einsatz (vgl. ).
(6) Nun sind die meisten Thesen der Medienkritiker auch nicht neu, sondern man bedient sich seit Jahrhunderten immer wieder der gleichen Argumentationen. So war etwa Dave Grossmans plakative Reklamation, es gebe eine neue Krankheit („AVIDS“), die von anderen Medienkritikern aufgegriffen wurde (Computerspiele als „Landminen für die Seele“ bzw. „die müssen irgendwann einmal herauskommen“), nicht etwa neu, sondern wurde schon von Goethes „Werther“ behauptet, wer jenes Buch lese, müsse unweigerlich vom Glauben abfallen oder sich umbringen. Auch in diese Kategorie einordnen würde ich Behauptungen wie etwa vom „Kölner Aufruf“, es gebe einen „militärisch-industriellen Komplex“, der Computerspiele produziere, um damit die Soldaten für die Kriege von morgen zu schaffen (vgl. ). In der Vergangenheit war beispielsweise behauptet worden, daß Rockmusik von den Kommunisten lanciert worden sei, damals sinnigerweise, um die Jugend zu verweichlichen und psychisch krank zu machen (vgl. ), sie vom Christentum weg und zur Anbetung des Teufels zu führen (vgl. ), oder behauptete Gabriele Kuby desgleichen von den „Harry Potter“-Romanen (vgl. ).
Nun war der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten in der Vergangenheit äußerst gering, und die bloße Wiederholung dieser Thesen, wenn vielleicht auch mit anderen Akteuren, macht sie auch nicht wahrer. Indessen sind Medienkritiker natürlich bestrebt, diese Kritiken als völlig neuartig erscheinen zu lassen. So hatte Christian Pfeiffer schon mit Rückgriff auf Goethe erklärt, daß die Lektüre von Büchern ja keine negativen Wirkungen habe (vgl. "Offene Diskussion (sic!): Kriminelle Jugend dank PC und Fernseher?", abgerufen am 02.06.2009). Eben deswegen hatte man wohl in der Vergangenheit auch über Bücher Schreckensszenarien heraufbeschworen, angefangen von Platons Kritik, wer etwas aufschreibe, schade damit seinem Geist (vgl. ), über die „Lesesucht“ über den „Schund“ bis hin zum „zersetzenden Gift“ heraufbeschworen, das damit verbunden sei, und sind bestimmte Bücher bis heute nicht oder nur auf Umwegen zu bekommen. Die prominentesten Beispiele für derartige Zensurbestrebungen sind natürlich der katholische „Index librorum prohibitorum“ („Liste der verbotenen Bücher“), der bis vor wenigen Jahrzehnten festschrieb, welche Bücher Katholiken nicht lesen dürften, oder auch die Bücherverbrennungen der Nazis, denen zum Beispiel Bücher mit linker oder pazifistischer Haltung zum Opfer fielen – weil man nämlich der Meinung war, diese könnten dafür sorgen, daß man der Weltsicht dieser Organisationen nicht mehr so ganz glaubte. Andererseits war man von dem Gegenentwurf zu „Im Westen nichts Neues“, Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ speziell nach dem zweiten Weltkrieg der Meinung, das Buch habe seinen Beitrag dazu geleistet, (vgl. Wikipedia: "In Stahlgewittern", abgerufen am 02.06.2009). Und nicht zuletzt verbreiten Druckwerke wie die „Bild-Zeitung“, durchaus auch schon einmal vermeintlich seriöse Zeitungen wie „Die Welt“ und versuchen damit, die Meinung der Bevölkerung zu beeinflussen, sie etwa gegen Computerspiele einzunehmen, und scheint dies auch in soweit zu verfangen.
Zumindest, wenn sie darauf angesprochen wurden, mußten Medienkritiker dann auch darstellen, daß man sich damals zwar verschätzt habe, man aber heute Recht habe, Computerspiele entsprechend deutlich gefährlicher seien als alle Medien, die bisher so als „Untergang des Abendlandes“ kritisiert worden waren (vgl. etwa ). Zu diesem Zwecke wurden dann auch andere Zahlen gerne einmal kleingerechnet (vgl. Ferguson xxxx). In Untersuchungen, in denen beide Medien verglichen wurden, wurde allerdings kein nennenswerter Unterschied aufgezeigt (vgl. Kimm 2005).
(7) Vielleicht ist der Medienkritiker selbst auch ein Getriebener seiner Sache. Nicht nur fühlt er sich verpflichtet, einer Sache schon von ihrer Motivation her den Strick zu drehen. Sondern er muß gleichzeitig versuchen, einerseits, selbst mit den hergeholtesten Argumenten immer im Gespräch zu bleiben, um der Medienwelt gebetsmühlenartig seine Thesen im Gedächtnis zu halten, andererseits aber nicht als „Gewinnler“ oder „Katastrophentourist“ von Amokläufen und ähnlichem zu erscheinen, der dies mit diebischer Freude tut, sondern noch ein Mindestmaß an Betroffenheit darstellen. So (s.o.), oder mußten als Beweise für die Gefährlichkeit und die Gesellschaft zerstörende Kraft von nicht-klassischer Musik Mißachtungen des Rauchverbotes, im Hotel gestohlene Kissen und Barry Manilow herhalten (siehe bei Miehling).
In dieser Engführung und häufig genug damit allgemeinen Ablehnung eines Mediums stiehlt sich allerdings der Medienkritiker selbst aus seiner Verantwortung. Wo er nun den Eklat provoziert hat und medienwirksam geworden ist, hätte er die Aufgabe, doch einmal zu sagen, wie er sich selbst denn ein Medium vorstellt, das seinen kulturellen Ansprüchen genügt. Damit, daß doch in Zukunft um 20:15 auf ProSieben die "Buddenbrooks" gezeigt werden oder daß es in Zukunft doch mehr Schießkinos geben sollte, in denen man mit echten Waffen auf simulierte Tiere schießen kann, würde nun sicher die Qualität der Medien Fernsehen und Computerspiel nicht verbessert. Die Menschen würden im ersteren Fall zwar abschalten, nicht aber ein Buch lesen oder ins Theater gehen, sondern sich im Wirtshaus betrinken wie je, und nachdem schon bei den letzten Amokläufern die ach so gute "soziale Kontrolle im Verein" nicht gewirkt hatte, gäbe es vielleicht sogar mehr Menschen, die sich im Umgang mit einer Waffe hinreichend sicher fühlen.
Andererseits muß natürlich klar sein, daß ein Medienkritiker davon ausgeht, daß Computerspieler regelmäßig die Handlungen, die in der fiktionalen Umgebung dargestellt werden, in die Realität übertragen, da sie selbst nicht in der Lage zu sein scheinen, zwischen fiktionalen Darstellungen und der Realität zu unterscheiden (vgl. etwa Dave Grossman, s.o.; Regine Pfeiffer unter "Im Gespräch mit Spielekritikerin Regine Pfeiffer"; Joachim Herrmann unter "Dr. Rainer Fromm und die Killerspiele im Heute Journal: 'Sadismus pur'", abgerufen am 01.05.2009). Auch atmet seine Darstellung ja fast immer die Meinung, seine Haltung sei „gesunder Menschenverstand“, und da braucht es dann eben keine „Beweise“ für eine prinzipielle Ablehnung.
2.1.17.2 „The Psychology of Genocide“
Die Argumentation der Medienkritiker hinterläßt allerdings auch noch auf andere Weise ein ungutes Bild: So vermittelt sie den Eindruck, daß man, um eine Position durchsetzen oder zumindest besonders medienwirksam werden zu können, eine These nur lautstark wiederholen muß. Gegenmeinungen kann man von vornherein verhindern, indem man Personen, die anderer Meinung sind oder anderslautendes Wissen haben, mit aggressivster Rhetorik niedermacht und diffamiert, indem man ihnen also von vornherein Angst macht, präsent zu werden. Dies ist eine Diskussionskultur, die weit von den – übrigens häufig auch von den Medienkritikern angemahnten - Werten demokratischer Kultur entfernt ist. Damit demonstrierte man, daß man selbst auch nicht an einer „Auseinandersetzung“ interessiert war. Schließlich ist auch an fälschlichen Behauptungen wie über den Einsatz von „digitalen Tötungstrainern“ nichts diskutierbar.
[Kandidaten wie Schiffer, Herrmann, Schünemann im Kontext der Erklärungen in (Baum 2008).]
Gehen wir davon aus, daß keiner der Medienkritiker ehrlich eine Rhetorik in den Mund nehmen wollte, die dafür plädiert, daß Computerspielern erst die Fensterscheiben und später die Schädel eingeschlagen werden sollten. Man wollte ja „nur“ die Spiele auf dem Marktplatz öffentlich verbrennen und der Welt kundtun, wie schädlich diese für die Moral seien. Sondern bei der Welt der Computerspieler handelte es sich um eine für sie unverständliche und Angst machende Welt, die – wie üblich – um jeden Preis kontrolliert werden mußte, einfach auf den Verdacht hin, daß dort Aktivität ablaufen, die den „gesellschaftlichen Werten“ zuwiderlaufen – wobei man natürlich die Definitionshoheit über diese „Werte“ für sich reklamiert hatte. Aber indem sie hier vergleichbare Arguementationsmuster und eine vergleichbare Rhetorik gebrauchen, besteht die Gefahr, daß dadurch auch vergleichbare Denk- und Handlungsmuster abgerufen werden.
2.1.17.3 XXXX
Schließlich erscheinen auch die Ratschläge, die Medienkritiker geben, höchst kritisierbar. So scheint ihr wesentlicher Ratschlag zu sein, die gesellschaftlichen Probleme seien zu lösen, indem ein Medium abgeschafft wird. Fragen wie die richtige Handhabung oder auch sogenannte „konstruktive Inhalte“ werden dann nicht mehr thematisiert. Dann kann man sich weder mit dem Medium noch überhaupt weiter mit den gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen, da man sich doch den einzigen Erklärungsansatz selbst aus den Händen genommen hat:
(1) Lief etwa ein Endfünfziger Amok, so wurden jedenfalls mit Sicherheit nicht Halb- oder Unwahrheiten über dessen Medienkonsum verbreitet oder dieser sogar für die Tat verantwortlich gemacht, obwohl er sich mit Sicherheit schon einmal einen Western mit John Wayne, einen Gangsterfilm mit Jean-Paul Belmondo, oder auch „Ein Fall für zwei“ angesehen haben mag, wo sich Gangster dann durchaus mal an öffentlichen Orten den Weg freischossen. Sondern es wurden psychische Probleme oder eskalierende Streitigkeiten dafür verantwortlich gemacht, allenfalls beiläufig erwähnt, daß es sich bei dem Amokläufer um einen Schützenbruder, Mitglied eines Schießclubs oder ähnliches handelte. Selbst einer weiblichen Jugendlichen, deren Amoklauf in letzter Minute verhindert werden konnte, wurde zugestanden, sie habe psychische Probleme gehabt, sei in der Schule gemobbt worden, ihr Elternhaus habe – selbst für die Einserschülerin – überzogene Leistungsansprüche an sie gestellt. Dies zumindest, bis man Aussagen über ihren vermeintlichen Medienkonsum kolportieren konnte. Letztlich wurde aber immer behauptet, Amokläufe von Jugendlichen seien letzten Endes immer auf deren Medienkonsum zurückzuführen – ob sie diese Medien überhaupt konsumiert hatten oder nicht.
Wenn man nun dies aber tut, Amokläufe von männlichen Jugendlichen auf deren Medienkonsum zurückführt, dann heißt dies letzten Endes, daß man ihnen derartige psychische Probleme oder Streßsituationen, aus denen sie keinen Ausweg mehr wußten, nicht zugestehen will. Aus der Erziehung bekannt ist ja das bekannte Beharrungsparadigma „Uns hat es doch auch nicht geschadet“. Das stimmt allerdings nicht. Schon vor vierzig Jahren haben sich Jugendliche umgebracht, weil sie den Druck nicht mehr ertragen konnten, und auch zu meiner Schulzeit wurde ein Mitschüler wegen streßbedingter gesundheitlicher Probleme für ein halbes Jahr beurlaubt. Heute werden mittlerweile schon Drittklässler wegen früher typischen „Managerkrankheiten“ behandelt, und würde ich mir persönlich angesichts von Faktoren wie „Abitur nach 12 Jahren“ oder neuen Studienordnungen (mit dem schon sprichwörtlichen „Bulimie-Lernen“) selbst sehr überlegen, ob ich noch einmal das Gymnasium besuchen oder ein Studium anfangen wollte.
Andererseits offenbart sich auf diese Weise ein Generationskonflikt. In der Vergangenheit stellte die jüngere Generation häufiger die Wertvorstellungen der älteren in Frage und praktizierte Vergnügungen, die es zu der Zeit noch nicht gegeben hatte, als die ältere Generation jung gewesen war, und andererseits vertrat die ältere Generation in der Regel die Haltung, ihre eigenen Wertvorstellungen seien gut und richtig. Ältere Menschen, die sich für die Belange der Jugend einsetzten, wurden ebenfalls nicht selten verfemt. So gibt es aus dem antiken Athen auch den Ausspruch, der Philosoph Sokrates – der anscheinend trotz einiger überlieferter Zitate, in denen er die Respektlosigkeit der „heutigen Jugend“ beklagt und das Ende der Zivilisation habe kommen sehen – habe die Jugend mit seinen Reden verdorben und zu Vandalismus und Ausschweifung erst angestachelt (vgl. ). Derartige Angriffe finden sich etwa in den Äußerungen von Sabine Schiffer, nach denen Erwachsene, die derartige Spiele – man beachte, daß sie selbst behauptet hatte, fast alle Computerspiele funktionierten nach demselben Muster wie die immer wieder gescholtenen „Killerspiele“ - am Computer spielten, keine Beharrlichkeit hätten bzw. nicht altersadäquat entwickelt seien (vgl. ).
Wahrscheinlich ist nicht einmal die Form der „medialen Hinrichtung“ neu, bei der heute im Fernsehen als Alibi-Gäste eingeladene Computerspieler, die schon allein ob ihres Alters ein geringeres rhetorisches Talent haben und zusätzlich noch nervös sind, sich einer großen Gruppe von bekannten und deutlich versierteren Personen weitgehend einhelliger Meinung gegenübersehen, von der sie mit Hilfe von rhetorischen Tricks und Kritikerargumenten zerlegt werden (vgl. Schmid 2009c). So sah sich zum Beispiel die kaum gebildete Jeanne d'Arc während ihres aus politischen Gründen angestrengten Inquisitionsprozesses, in welchem sie unter anderem wegen Hexerei und des „Paktes mit dem Teufel“ angeklagt wurde, einem Kollegium von 60 Klerikern und Rechtsgelehrten gegenüber, die zweifelsohne zu den gebildetsten ihrer Zeit gehörten. Sie schlug sich dabei zwar außerordentlich gut, aber schließlich waren auch Gerüchte (vgl. Kritikerargumente) als Beweise zugelassen, hatte es nicht weniger als 67 Anklagepunkte gegeben, zu viele, um diese alle gegen Gerüchte zu entkräften, und schließlich hatte man sich auch perfider Methoden bedient, so daß sie letztlich nicht der von den Engländern und ihren Verbündeten gewünschten Hinrichtung hatte entgehen können (vgl. Wikipedia: Jeanne d'Arc; Wikipedia: Trial of Joan of Arc, abgerufen am 03.06.2009; Barrett 1932). Wenn nun eine junge Frau, die gerade einmal ihren Namen schreiben konnte, sich gegen eine ganze Reihe von rhetorischen Tricks hatte durchsetzen können, und letztlich nur deswegen scheiterte, weil man ihr Männerkleidung zum Anziehen gegeben hatte, hätte womöglich ein Philosoph die Kirche und ihre Gelehrten ganz aushebeln können. Der Philosoph Giovanni Picco della Mirandola hatte sogar von sich aus alle Gelehrten eingeladen, mit ihnen über seine 900 philosophischen und theologischen Thesen zu diskutieren. In diesem Falle war man allerdings das Risiko gar nicht erst eingegangen, dabei schlecht auszusehen, erklärte der Papst erst 13 von diesen Thesen, schließlich das ganze Werk für ketzerisch – mit der Begründung, damit würden „Künste gefördert, die dem katholischen Glauben und der menschlichen Rasse feindlich“ seien oder sie „könnten die Unverschämtheit der Juden anstacheln“ - und ließ Mirandola verfolgen (vgl. Wikipedia: Giovanni Pico della Mirandola, abgerufen am 03.06.2009).
Nun sind Computerspiele im Schnitt zwar keine „Heiligen“ oder Philosophen. Sie sind aber im Durchschnitt auch keine Monstren oder Verbrecher, als die man versucht, sie darzustellen.
(2) Im kleinen ließ sich ja bereits nachweisen, daß die „inhaltlichen Vorschläge“, die die Medienkritiker gemacht hatten, nicht verfangen konnten oder vielmehr als Bemäntelungen für Totalforderungen dienten. Ein anderer Ansatz läßt sich aus. Insbesondere bei konservativen Medienkritikern, die sich einerseits vehement gegen Computerspiele aussprechen und häufig auch ihre Nutzer kriminalisieren wollen, ist eine doch recht doppeldeutige Haltung vorzufinden, daß diese sich etwa deutlich positiv über den Gebrauch realer Schußwaffen (z.B. Beckstein, Stoiber, Schünemann) oder über Krieg (z.B. „Kontraste“) geäußert hatten. Deren Argumentation erscheinen damit auch nicht recht glaubhaft (siehe auch -Fazit/moralinsauer-). Andererseits aber sind sie auch nicht so sehr unterschieden von denen der konservativen „Schützenbrüder“, die gleichzeitig nichts Falsches an realen Waffen finden konnten, indem nämlich beide Gruppen gleichermaßen versuchen, das Leben der Menschen nach ihren Moralvorstellungen zu reglementieren. .
(Eine andere Linie der Kritik verfolgt hier freilich Sabine Schiffer, die in ihrer totalen Ablehnung von Gewaltdarstellungen auch das Soldatische so grundsätzlich ablehnt, daß sie nicht einmal davon ausgeht, eine militärische Karriere könne für irgendeinen Menschen wertvoll sein. Diese Extremposition ist allerdings ebenfalls nicht recht glaubhaft, und verweist auch sie auf ein paralleles Bestreben, den privaten Bereich zu reglementieren.)
Quellen zu diesem Kapitel
Abbott, Geoffrey, „Amazing Stories of Female Executions“, Chichester: Summersdale Publishers Ltd., 2006
Anderson, Craig A.; Bushman, Brad J., "Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Physiological Arousal, and Prosocial Behavior: A Meta-Analytic Review of the Scientific Literature", in: Psychological Science, Vol.12(5), September 2001, S.353-359, URL http://www.sitemaker.umich.edu
Angerer, Jo; Werth, Mathias, "Es begann mit einer Lüge", WDR 2001, URL http://www.wdr.de/online/news/kosovoluege/sendung_text.pdf
Auerbach, Thomas, "Jugend im Blickfeld der Stasi", 2002, in: Dümmel, Karsten; Schmitz, Christian (Hrsg.), "Was war die Stasi? Einblicke in das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS)", Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2002, S.80-86
Baier+Pfeiffer 2007
Baier, Dirk; Rabold, Susann; Kappes, Cathleen; Kudlacek, Dominic, „Sicherheit und Kriminalität in Stade. Ergebnisse einer Schüler- und Erwachsenenbefragung“, Forschungbericht Nr.106, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), Hannover, 2009
Barrett, W.P., „The Trial of Jeanne d'Arc“, with an essay by Pierre Champion; Gotham House, Inc., 1932; URL http://www.fordham.edu/, abgerufen am 03.06.2009
Bauer, Rudolf, "Mögliche Auswirkungen der 'Neuen Medien' auf die Entwicklung von Kindern", in: XXX, 2006, S.50-70
Baum, Steven K., „The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders, and Rescuers“, New York et al.: Cambridge University Press, 2008
BBFC 2007
Becker, Reinhard, "Zahlen und Fakten zum privaten Waffenbesitz in Deutschland. Sinn und Unsinn einer Verschärfung des Waffenrechts", 2001
Berthold, Erika; Holling, Eggert, „Killerspiele in der Diskussion. Die Praxis der USK und die wissenschaftlich fragwürdigen Ergebnisse der KFN-Studien“, 13.08.2007; URL http://www.heise.de/, abgerufen am 26.06.2009
Birkel, Christoph; Thome, Helmut, "Die Entwicklung der Gewaltkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland, England/Wales und Schweden in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts", Der Hallesche Graureiher 2004-1, Universität Halle-Wittenberg, 2004
Bißwanger-Heim, Thomas, "Ballern als Freizeitspaß - Machen Computerspiele gewaltttätig?", Interview mit Klaus Mathiak, in: MMW 1+2/2006
Blaszczynski, Alex, "Commentary: A Response to 'Problems with the Concept of Video Game 'Addiction': Some Case Study Examples", in: International Journal of Mental Health and Addiction, 2007, DOI 10.1007/s11469-007-9132-2
Blumentritt, Martin, "Die Polizeiliche Kriminalstatistik(PKS) als Quelle von Wahn"; URL http://www.martinblumentritt.de, abgerufen am 22.05.2008
BMI.GV.AT (WWW): http://www.bmi.gv.at/oeffentlsicherheit/2005/05_06/IWA_2005.pdf
Bott, Jochen (WWW), "Zeitbombe Schützenvereine", in: "telepolis", 28.04.2002; URL http://www.heise.de/tp/r4/artikel/12/12426/1.html; abgerufen am 07.11.2007
Böcher, Otto, „Apokalyptische Strukturen in der Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit“, in: Helmut Baier (Hrsg.), „Endzeiten – Wendezeiten? Chiliasmus in Kirche und Theologie“, Viertes Symposium der deutschen Territorialkirchengeschichtsvereine, Rothenburg ob der Tauber, 25.-27.Juli 1999 = Zeitschrift für Bayerische Kirchengeschichte 69 = Studien zur Deutschen Landeskirchengeschichte Band 4, Nürnberg 2000, S.1-18
Böcher, Otto, „Christliche Endzeiterwartung und die Frömmigkeit des Vormärz“, Mainz 2002
Bösche, Wolfgang; Geserich, Florian, "Nutzen und Risiken von Gewaltcomputerspielen: Gefährliches Trainingswerkzeug, harmlose Freizeitbeschäftigung oder sozial verträglicher Aggressionsabbau?", in: Polizei&Wissenschaft 1/2007, S.45-66
Brady, Sonya S.; Matthews, Karen A., "Effects of Media Violence on Health-Related Outcomes Among Young Men", in: Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine Vol.160, April 2006, S.341-347
Brand, M.; Markowitsch, H.J., „Lernen und Gedächtnis“, 2004 (Version vom 10.04.2005)
BR-Online, „alpha-forum vom 20.02.2009 – Prof. Dr. Christian Pfeiffer [...] im Gespräch mit Jochen Kölsch“, 2009
Brugger 2001
Brunn, Inka; Dreier, Hardy; Dreyer, Stephan; Hasebrink, Uwe; Held, Thorsten; Lampert, Claudia; Schulz, Wolfgang, "Das deutsche Jugendschutzsystem im Bereich der Video- und Computerspiele", Hamburg:Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, 2007, URL http://www.hans-bredow-institut.de/presse/070628Endbericht.pdf
Buckley, Katherine E.; Anderson, Craig A., „A Theoretical Model of the Effects and Consequences of Playing Video Games“, in: Vorderer, P.; Bryant, J. (eds), „Playing Video Games – Motives, Responses, and Consequences“, Mahwah, NJ: LEA, S.363-378
Bushman, Brad J.; Anderson, Craig J. (2001), "Media Violence and the American Public. Scientific Facts Versus Media Misinformation", in: American Psychologist, June/July 2001, S.477-489, URL http://www.sitemaker.umich.edu
Bushman, Brad J.; Anderson, Craig J. (2002), "Violent Video Games and Hostile Expectations: A Test of the General Aggression Model", in: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol.28(12), December 2002, S.1679-1686; URL http://www.sitemaker.umich.edu
Bushman, Brad J. (2005), „Violence and Sex in Television Programs Do Not Sell Products in Advertisements“, in: Psychological Science, Vol.16(9), 2005, S.702-708
Buss 2006
Bürger, Josef, "Was glauben die, die Gott, den Schöpfer, ablehnen?", 2006; URL http://www.realschule.bayern.de
Chambers, Jemma, "The violence situation: A descriptive model of the offence process of assault for male and female offenders", Dissertation, University of Melbourne, 2006
Cierpka+Diepold 1997
Clark, Neils L., "Addiction and the structural characteristics of massively multiplayer online games", M.A.Thesis, University of Hawai'i, 2006
Cziesche, Dominik; Freiburg, Friederike, "Radikal liberal", in: "Der Spiegel" 34/2002, S.69; URL http://wissen.spiegel.de, abgerufen am 21.06.2008
Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/154, Berlin, Donnerstag, 10.04.2008; URL
Eggen 2006
Farkas, David K. (2005), "Understanding and using PowerPoint", 2005
Farkas, David K. (2006), "Toward a better understanding of PowerPoint deck design", 2006
Feltz, D.L.; Landers, D.M., "The Effects of Mental Practice on Motor Skill Learning and Performance: A Meta-analysis", Journal of Sport Psychology Vol.5, 1983, S.25-57
Ferguson, Christopher J.; Kilburn, John, „The Public Health Risks of Media Violence: A Meta-Analytic Review“, in: The Journal of Pediatrics, Volume 154(5), May 2009, S.759-763; Seitenzahlen nach URL http://www.tamiu.edu
Frank, Dirk, "Vorsicht Bildschirm? Wie man sich gegen populistische Thesen zur Wirkung von Fernsehen und Computer wappnet", in: Schulen ans Netz, Themendienst Nr.3, Bonn Juni 2005; Seitenzahlen nach URL http://www.mediaculture-online.de
Fritz, Jürgen (1999), "Was sind Computerspiele?", in: Fritz, Jürgen; Fehr, Wolfgang (Hrsg.), "Handbuch Medien: Theorie, Forschung, Praxis", Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1999
Fritz, Jürgen (2003), "Warum eigentlich spielt jemand Computerspiele: Macht, Herrschaft und Kontrolle", in: Fritz, Jürgen; Fehr, Wolfgang (Hrsg.), "Computerspiele: Virtuelle Spiel- und Lernwelten", Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2003
Fuchs, Walter, "Zwischen Deskription und Dekonstruktion: Empirische Forschung zur Jugendkriminalität in Österreich von 1968 bis 2005. Eine Literaturstudie", IRKS Working Paper No.5, :Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, 2007
Gagne, Kenneth A., "Moral Panics Over Youth Culture and Video Games", Bachelor's Thesis, Worcester Polytechnic Institute, 2001; URL http://www.gamebits.net, abgerufen am 16.05.2008
GamePolitics 2007
Gehlen, Martin, "Die Problematik der Gewaltdarstellung in Computerspielen am Beispiel des Ego-Shooters 'Gunman Chronicles'", Diplomarbeit, Fachhochschule Köln, 2002
Gier, Albert, "Das Libretto - Theorie und Geschichte", Frankfurt/Main,Leipzig: Insel Verlag 2000
Gieselmann, Hartmut (2000), "Die Gewalt in der Maschine. Überlegungen zu den Wirkungen von aggressiven Computer-Spielen", in: c't 4/2000, S.132-
Gieselmann, Hartmut (2003), "Virtuelle Stahlgewitter - Militarismus und Nationalismus in Computerspielen", in: Regina Pantos, Heinz Dörr, Hans Weber (Hrsg.), "Gewalt in Kinder- und Jugendmedien. Ursprung, Ausprägung, Prävention", Materialien Jugendliteratur und Medien, Heft 46, Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur & Medien in der GEW, Frankfurt:GEW 2003, S.36-40
Giordano, Ralph, "Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Die Pläne der Nazis nach dem Endsieg", Köln: Kiepenheuer&Witsch, 4.Auflage 2004
Grimm 1999
Greim, Liane, "Faszination von Waffen auf Kinder", Staatsarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München, 1994, Version vom 28.Juni 2004, URL http://www.schleibinger.com
Grossman 2001
Gugel, Günter, "Erziehung durch Gewalt. Wie durch ... Spielzeug Gewalt entstehen kann", Waldkirch 1983
Gugel 2007
Haier 2005
Hagmayer, York Christoph, "Denken mit und über Kausalmodelle", Dissertation, Universität Göttingen, 2000
Hahn, A.; Jerusalem, M., „Internetsucht: Validierung eines Instruments und explorative Hinweise auf personale Bedingungen“, in: Theobald, A.; Dreyer, M.; Starsetzkl, T. (Hrsg.), „Handbuch zur Online-Marktforschung. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis“, Wiesbaden: Gabler, 2001, S.213-233
Harakas, Stanley, "The Stand of the Orthodox Church on Controversial Issues", 2005; URL http://www.goarch.org, abgerufen am 15.09.2008
Harwood, Gordon B.; Larkins, Ernest R.; Martinez-Vazquez, Jorge, „Using a Randomized Response Methodology to Collect Data for Tax Compliance Research“, Research Paper No.23, Atlanta, Georgia:Policy Research Center, Georgia State University 1992; URL http://aysps.gsu.edu/
Hausmanninger, Thomas, „Review: Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht? Ein Aufruf gegen Gewalt in Fernsehen, Film und Computerspielen“, in: International Review of Information Ethics, Vol.4(12), 2005, S.61-63
Hänsel, Rudi; Hänsel, Renate, "Unterhaltungsgewalt - Wirkungen und Gegenmassnahmen", in: "Bündner Schulblatt", November 2006, S.5-13; URL http://edudoc.ch
Heinz 2004
Heer, "Gottes erste Liebe"
History Channel (TV-Bericht), "Momente der Geschichte": (Der erste F-117 über dem Irak), ausgestrahlt u.a. am 14.12.2007
Hopf, Werner H. (2002), "Mediengewaltwirkungen - nichts bewiesen?", in: SchulVerwaltungBY, Nr.7/8/2002, S.250-256
Hopf, Werner H. (2004), "Mediengewalt, Lebenswelt und Persönlichkeit - eine Problemgruppenanalyse bei Jugendlichen", Zeitschrift für Medienpsychologie, Vol. 16(3), 2004, S.99-115
Hopf, Werner H.; Huber, Günter L.; Weiß, Rudolf H., "Media Violence and Youth Violence - A 2-Year Longitudinal Study", Journal of Media Psychology: Theories, Methods and Applications, Vol. 20(3), 2008, S.79-96
Höynck, Theresia; Mößle, Thomas; Kleimann, Matthias; Pfeiffer, Christian; Rehbein, Florian, "Alterseinstufung von Computerspielen durch die USK. Zusammenfassung des Forschungsberichtes", Hannover: KFN 2007
Huber, Günter L. (2007), "Die Auswirkungen brutaler Video- und Computerspiele", 2007, URL http://www.aquad.de
Huber, Günter L. (2008a), "The world according to players of 'killer games' - a constructivist approach to player thinking", Conference of the Center for Qualitative Research on "Epistemologies in Qualitative Research", Oulu, Finland, 29.Februar-2.März 2008, URL http://www.aquad.de
Huber, Günter L. (2008b), "Juegos Electronicos y Violencia Infantil y Juvenil. Resultados de un estudio longitudinal", V Jornadas Internacionales Sobre Tratamiento Educativo De La Diversidad, Madrid, 2.+3.Mai 2008, URL http://www.aquad.de
Huber, Günter L. (2008c), „Gamers' World – Reaktionen auf öffentliche Kritik“, Vortrag anläßlich des „Internationalen Kongresses 'Computerspiele und Gewalt' an der Hochschule München“, 20.11.2008, URL http://www.mediengewalt.eu
Human Rights Watch, "Ignorance Only: HIV/AIDS, human rights and federally funded abstinence-only programs in the United States. Texas: A case study", Human Rights Watch Report Vol.14, No.5(G), September 2002; URL http://www.hrw.org
Jackson, Linda A.; von Eye, Alexander; Biocca, Frank A.; Barbatsis, Gretchen; Zhao, Yong; Fitzgerald, Hiram E., "Does Home Internet Use Influence the Academic Performance of Low-Income Children?", in: Developmental Psychology, Vol.42(3), 2006, S.429-435
jugendschutz.net 2003
Katechismus der katholischen Kirche (KKK)
Kellershohn 2003
Kertzer, Dan, "Die Päpste gegen die Juden. Die katholische Kirche und die Wurzeln des modernen Antisemitismus"
Krimonologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), „Jugendgewalt und Jugenddelinquenz in Hannover. Aktuelle Entwicklungen und Befunde seit 1998“, Presseerklärung, Hannover, 22.07.2008
Kimm, Stefan, "Gewalt spielen. Die Bedeutung der Interaktivität für die Wirkung medialer Gewaltdarstellungen auf Angst und Aggression", Dissertation, Universität Dortmund, 2005; URL http://hdl.handle.net/2003/21538
King, Gary; Rosen, Ori; Tanner, Martin; Wagner, Alexander F., "Ordinary Voting Behavior in the Extraordinary Election of Adolf Hitler", 2004
Kleimann, Matthias; Mößle, Thomas; Rehbein, Florian, "Verharmlosung und Beschwichtigung. Rezension des von Jürgen Fritz herausgegebenen Sammelbandes 'Computerspiele(r) verstehen'", Hannover: KFN, 2008; URL http://kfn.de
Knabe, Hubertus, "Die Westarbeit des MfS", in: Dümmel, Karsten; Schmitz, Christian (Hrsg.), "Was war die Stasi? Einblicke in das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS)", Sankt Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2002, S.117-127
Köpke, Anne, "Grundlegende Modelle der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse: Pfadanalyse", Universität Potsdam 2007
Krause, Norbert, "Babymorde in Ostdeutschland als Familienplanung?", URL www.heise.de, abgerufen am 29.02.2008
Krauskopf 2004
Krautz, Jochen, „Wie kommt der Krieg in die Köpfe – und in die Herzen? Kölner Aufruf gegen Computergewalt“, 16.02.2009
Krenzlin, Ida Luise, „Kille, Kille, Killerspiel“, in: „Ästhetische Erziehung – Festivalzeitung zu den 15. Internationalen Schillertagen“, 19.-27.06.2009, S.7
Kreuzer, Arthur, "Knast für Crashkids?", in: "Zeit Online", 16.01.2008, URL http://images.zeit.de, abgerufen am 24.06.2008
Kristen, Astrid, "Aggressive Jungen und gewalthaltige Computerspiele . Eine Längsschnittstudie zu der Frage, wer wen beeinflusst", Dissertation, FU Berlin, 2006; URL http://www.diss.fu-berlin.de/2006/108/
Kuessner, Dietrich, "Nationalsozialismus auf dem Lande - Bückeberg und die ev.Kirche", Vortrag im Braunschweigischen Landesmuseum anläßlich der Ausstellung "Ein Volk dankt seinem (Ver)Führer" am 08.03.2001, URL http://bs.cyty.com/kirche-von-unten/archiv/gesch/Nationalsozialismus_auf_dem_Lande.rtf
Kunczik 2000
Kunczik+Zipfel 2004
Kutchinsky 1992
Ladas 2002
Lang, Simone; Hansen, Sven, „Der gute Nazi von Nanking“, in: „taz Magazin“, 13.12.1997, S.6-7
Langer, Wolfgang, "Einführung in die Grundlagen der explorativen Pfadanalyse", Universität Halle-Wittenberg 2003
Lattarico, Jean-Francois, "Between division and subversion: Stefano Landi's La morte d'Orfeo", Beiheft zu ZZT 070402
Ledingham et al. 1993
Lemaine 2004
Lindemann, Thomas, "Der ungerechte Kreuzzug gegen die Videospiele", URL www.welt.de, abgerufen am 29.02.2008
Lott 2006
Lukesch, Helmut (2002)
Lukesch, Helmut (2006)
Lüke 2005
Maas, Manuela; Neuninger, Daniela, „Streit um Lara Croft. Evolutionspsychologische Überlegungen zum Thema Spielen“, in: „Der Mammutjäger vor der Glotze. Evolutionspsychologische Theorien in der Medienpsychologie“, Universität des Saarlandes 2006, S.20-38
Mark, Rudolf A., "Weißrußlands Kommunisten seit der Unabhängigkeit des Landes 1991", in: Gerhard Hirscher (Hrsg.), "Kommunistische und postkommunistische Parteien in Osteuropa. Ausgewählte Fallstudien", Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen 14, München: Hans-Seidel-Stiftung, 2000, S.139-166
Martig, Charles (WWW), "Kampf der Bilder. Der Irak-Krieg in den Kanälen der Fernsehsender", 24.03.2003; URL http://www.medienheft.ch
Mathiak, Klaus; Weber, René, "Towards Brain Correlates of Natural Behavior: fMRI during Violent Video Games", in: Human Brain Mapping, Vol.27, 2006, S.948-956
McCord+Conway 2005
Mercy, James A.; Butchart, Alexander; Farrington, David; Cerdá, Magdalena, "Youth violence", in: Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B.; Lozano, Rafael (eds.), "World report on violence and health", Geneva: World Health Organization, 2002
Mertens 2004 [nach Schindler 2005, S.58]
Mihr, Lukas, "Gottloses Tätervolk?", 2008; URL http://www.beads.be.ohost.de/taetervolk.pdf
Müller, Andreas, "Artikelreihe Mediengewalt":
-
(2006a): "Teil 1: Killerspiele - was ist das?" vom
24.11.2006; URL http://hpd-online.de/node/578/pdf
-
(2006b): "Teil 2: Fantasie und Realität" vom
02.12.2006; URL http://hpd-online.de/node/625/pdf
-
(2006c): "Teil 3: Gefahren und Vorzüge virtueller
Gewalt"; URL http://hpd-online.de/node/679/pdf
-
(2006d): "Teil 4: Eine Frage des Respekts"; URL
http://hpd-online.de/node/735/pdf
Möller, Ingrid (2006)
Murray, John P., "Video Game Violence", Boston,MA: center for media and child health (cmch), Fassung vom 10.03.2008
Müller, Hans, "Katholische Kirche im Nationalsozialismus. Dokumente 1930-1935", 1963
Nagenborg 2003
Nagy, Ferenc, "Computerspiele: Rezeption und Wirkung", Diplomarbeit, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, 2006
Narvaez+Metton 2006
Nieding, Gerhild; Ohler, Peter, „Henne und Ei – oder etwas Drittes?“, in: tv diskurs Nr.36 (Vol.10, (2)), 2006, S.48-51
N.N., „Leseprobe: Militärexperte vergleicht PC-Spiele mit Armee-Simulatoren. Die Mordhemmung ballernd wegspaßen. Von Dave Grossman“, in: „marcstein. Überregionale Auswahl für Bildung und Kultur“, Ausgabe 2002/03, S.1-4
Nordwig, Hellmuth, "Weniger harmlos als behauptet. Gewaltspiele machen nachweisbar aggressiv", in: "Forschung aktuell", DLF, 21.11.2008; URL http://www.dradio.de, abgerufen am 21.11.2008
O'Brien, Tim, „If I Die in a Combat Zone“, in: Stewart O'Nan, (ed.), „The Vietnam Reader“, New York: Anchor Books, 1998
Olson 2004
Opielka, Jan, "Tödliche Computerspiele?", in: Publik Forum, Januar 2007
Oppl, Caroline, "Lara Crofts Töchter? Eine Längsschnittstudie zu Computerspielen und aggressivem Verhalten von Mädchen", Dissertation, FU Berlin, 2006; URL http://www.diss.fu-berlin.de/2006/107/
Ouweneel, W.J., "Evolution contra Schöpfung? Hat die Evolutionslehre einen wissenschaftlichen Charakter?", in: Creation Research Society Quarterly, September 1971 (Originaltitel: "The Scientific Character of the Evolution Doctrine"), H.L.Heijkoop-Verlag, 1.Auflage 1975, 2.Auflage 1977, URL http://www.soundwords.de, abgerufen am 05.11.2008
o.V. (2004), "Die deutsche Schulreform im 21.Jahrhundert", 14.03.2004
o.V. (2005), "Lorenzer Kommentargottesdienst: Faszination Harry Potter - himmlisches Vergnügen oder magische Verblendung?", 18.09.2005
o.V. (2006), "Garlstorf: Minister Schünemann schoß auf den Keiler", http://www.abendblatt.de/daten/2006/01/23/526104.html, erschienen am 23.01.2006
o.V. (2007a),
o.V. (2008), "Internationaler Kongreß: Computerspiele und Gewalt. Neue Erkenntnisse der Medienwirkungsforschung. Pädagogische und politische Konsequenzen", Einladung für den 20.November 2008, Hochschule München, 2008
Paik, H:; Comstock, G., „The effects of television violence on antisocial behavior: a meta-analysis“, Commun Res Vol. 21, 1994, S.516-539
Papameletiou, Demosthenes; Zenié, Alexandre; Schwela, Dieter; Bäumler, Wolfgang, "Risks and Health Effects from Tattoos, Body Piercing and Related Practices", Ispra (Italy): Institute for Health and Consumer Production (IHCP), 2003
Paulus, Jochen, "Es ist doch nur ein Spiel!", in: "GEO Wissen" Nr.41 "Pubertät", 2008, S.62-71
Pfeiffer, Christian (XXXX), "Jugendkriminalität und Jugendgewalt in europäischen Ländern", KFN-Forschungsberichte Nr.69
Pfeiffer et al. 1999
Pfeiffer, Christian (2004), "Medienverwahrlosung als Ursache von Schulversagen und Jugenddelinquenz?", URL http://www.mediaculture-online.de
Pfeiffer, Christian (2006), "Du sollst nicht töten!", 2006, URL http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/weststadtbs.pdf
Pfeiffer, Christian; Mößle, Thomas; Kleimann, Matthias; Rehbein, Florian, „Die PISA-Verlierer – Opfer ihres Medienkonsums. Eine Analyse auf Basis verschiedener empirischer Untersuchungen“, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), Hannover 2007; Version vom 04.02.2008; URL http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/pisaverlierer.pdf
Pfleger, Helmut, „Schach und Medizin: Im Allgemeinen erlaubt...“, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg.99(13), 29.März 2002, S.838-840
Pias, Claus, „Computer Spiel Welten“, Dissertation, Bauhaus-Universität Weimar, 2000
Possaner, Stefan, "An den Grenzen von Raum und Zeit - Schwarze Löcher", 2000
Pröhl, Tanja, "Gewalt an Schulen im Vergleich Deutschland - USA. Eine Sekundäranalyse", Tübinger Schriften und Materialien zur Kriminologie, Tübingen: Institut für Kriminologie, 2006; zugleich Dissertation, Universität Tübingen, 2005
Pöhlmann 2006
Ranke-Heinemann, Uta, "Eunuchen für das Himmelreich", 22.Auflage, 2000
Rehbein, F.O.; Mößle, T.; Kleimann, M., „Kinderzimmer im Cyberspace - Herausforderungen für Eltern, Schule und Politik“, in: XXX, 2006, S.32-49
Rehbein, Florian; Borchers, Moritz, „Süchtig nach virtuellen Welten? Exzessives Computerspielen und Computerspielabhängigkeit in der Jugend“, in: Kinderärztliche Praxis 80(1), 2009, S.42-49
Reichert, Tim, "Die Killerdebatte", 2007, URL http://www.timreichert.de/Killerdebatte-Dateien/Killerdebatte.pdf
Reichmann, Karl, „Ehrliche Antworten auf indiskrete Fragen – Randomized Response Technik“, 2008; URL http://home.mathematik.uni-freiburg.de/
Renkl, Alexander, "Korrelation und Kausalität", in: Christian Tarnai (Hrsg.), "Beiträge zur empirischen pädagogischen Forschung", Münster u.a.: Waxmann, 1993, S.115-123
Richter, Johanna (2006a), "Können Ethnien gemacht werden? Die Ursachen des Völkermords in Ruanda in der Kolonialpolitik"; URL http://www.perspektive89.com, abgerufen am 12.05.2008
Richter, Johanna (2006b), "Die Bedeutung der Begriffe 'Hutu' und 'Tutsi' im Ruanda vor der Kolonialzeit"; URL http://www.perspektive89.com, abgerufen am 12.05.2008
Rickers, Judith, "Jugenddelinquenz und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben vor dem Hintergrund persönlicher Ressourcen- und Belastungskonstellationen", Dissertation, Universität Osnabrück 2006
Riepe, Manfred, "Das Gespenst der Gewalt. Zur Geschichte der Gewaltdebatte. Ein Rückblick auf juristische und journalistische Praktiken sowie die Medienwirkung fragwürdiger Gewaltwirkungsstudien", Vortrag gehalten am 26.04.2003 auf der Tagung "Bodies that splatter" in der Berliner Akademie der Künste, Berlin 2003; URL http://www.mediaculture-online.de
Rhodes 2001
Roberts, Donald F.; Foehr, Ulla G.; Rideout, Victoria, "Generation M: Media in the Lives of 8-18 Year-olds", 2005
Robertz 2005
Rosch, Annette, "Empirische Überprüfung eines kognitiv orientierten Präventions- und Interventionsprogramms zum Aufbau sozialer Kompetenz und zur Aggressionsverminderung bei Jugendlichen in Schulen", Dissertation, Universität Augsburg, 2006
Roth, Florian, "Gott und das Göttliche - Antworten der Antike und des Mittelalters: Der unbewegte Beweger - der Gott des Aristoteles", Vortrag an der Münchner Volkshochschule, 2006
Röder, Rupert, "Das unbewegt Bewegende - Notizen zur Exklusion des Subjekts aus der Welt", in: Hummel, Diana; Jahn, Thomas (Hrsg.), "Grenzen der Wissenschaft - Kolloqium für Egon Becker", Frankfurt am Main: Institut für sozial-ökologische Forschung, 2001
Rötzer 1998
Sabadello, Markus, "History of electronic games and an interactive installation at the 'Technisches Museum' in Vienna, Austria", Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 2006
Safe School Initiative, "The Final Report and Findings of the Safe School Initiative: Implications for the prevention of school attacks in the United States, Washington DC: United States Secret Service and United States Department of Education, 2002, URL http://www.ustreas.gov
Saleth, Stephanie, "Jugendkriminalität im Spiegel der Lokalpresse. Eine Gegenüberstellung der Berichterstattung des Schwäbischen Tagblatts und der Statistik der Jugendgerichtshilfe Tübingen im Zeitraum 1975-2000", Tübinger Schriften und Materialien zur Kriminologie Band 8, Tübingen: Institut für Kriminologie; zugleich Dissertation, Universität Tübingen, 2004
Schaefer, Jim, „GAME MASTER: Army game to draft virtual soldiers“, Detroit Free Press, 24.Mai 2002
Scharer, Matthias, "Spiritualität als Schulkultur", in: Matthias Scharer (Hrsg.), "Theologisch Praktische Quartalschrift", 148, 2000, S.169-175, URL http://www.uibk.ac.at
Schedel 2000
Scheler, Gabriela, "Neurophysiologische Korrelate beim mentalen Training motorischer Bewegungen: Ein Vergleich zwischen professionellen Musikern und Amateuren", Dissertation, Universität Tübingen, 2004
Schermelleh-Engel, Karin, "Partialkorrelation, Partialregression und Pfadanalyse", Universität Frankfurt, 2004
Scherz, Harald, "Feindbilder im Hollywoodfilm nach dem Ende des Kalten Krieges", mnemopol Texte #459, 2003; zugleich Diplomarbeit, Universität Wien 2003; URL
Schiffer, Sabine (2007), „Medienmythen – Mobilmachung in den Kinderzimmern“, in: „Zukunft“, April 2007, S.56-59
Schiffer, Sabine (2008), „Bildung – Computer & Co. halten ihre Versprechen nicht. Von der Verharmlosung bis zur aggressiven Werbung -Wissen, was wirklich gespielt wird!“, in: „Zukunft“, Juni 2008, S.66-71
Schiffer, Sabine (2009), „Für Krieg gibt es keine Rechtfertigung!“, Redemanuskript zur Kundgebung anläßlich des Ostermarsches, Bremen, 11.04.2009, 12.00 Uhr; Institut für Medienverantwortung, Erlangen, 2009
Schindler 2005
Schlag, Myriam; Pietschmann, Melanie, "Prädiktoren und Auswirkungen des Konsums gewalthaltiger Videospiele- Analyse einer unveröffentlichen Online-Studie [Krahé, B.& Möller, I. (2006)]", Seminar "Kausale Modellbildung", FSU Jena, 2007
Schleich 2006
Schleifer, Rebecca; Csete, Joanne; Fellner, Jamie; PoKempner, Dinah; Ross, James; Gorvin, Ian; Minges, Patrick; Hepkins, Fitzroy; Yeh, Tommy, "Ignorance Only: HIV/AIDS, Human Rights and Federally Funded Abstinence-Only Programs in the United States. Texas: A Case Study", Human Rights Watch, Vol. 14 No.5 (G), September 2002; URL http://hrw.org/reports/2002/usa0902/USA0902.pdf
Schmich, Monica, "Studie: Killerspiele machen aggressiv, brutal und dumm", in: Augsburger Allgemeine, 15.05.2008; URL http://www.augsburger-allgemeine.de, abgerufen am 21.05.2008
Schmid, Hans, Artikelreihe „Bericht über eine Reise
nach Absurdistan“, abgerufen am 02.06.2009:
- (2009a)
„Teil 1: Wie ich einmal versuchte, einen indizierten Film zu
kaufen“, URL
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30145/1.html
-
(2009b) „Teil 2: Einmal gefährdungsgeneigt, immer
gefährdungsgeneigt“, URL
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30160/1.html
-
(2009c) „Teil 3: Amokläufer unter sich“, URL
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30161/1.html
Schmidt, Christian, "Killertext"; URL http://www.klopfers-web.de, abgerufen am 29.08.2007
Schmidt-Salomon, Michael, „Leitkultur Humanismus und Aufklärung – Wie christlich sind unsere Werte?“, Referat bei der Tagung „Säkularer Staat und religiöse Werte“ der Humanistischen Union e.V., gehalten am 29.11.2008, Textfassung vom 28.01.2009; URL http://www.humanistische-union.de
Schmies, Beate; Baltes, Gisbert, „Eine kurze Geschichte... von Walter und Dieter Mennekes, ein Stecker und zwei Brüder aus dem Sauerland“, WDR5, 23.05.2009; URL http://www.wdr5.de
Schudeja, Christa, "Jugendhilfe zwischen Märchenmühle und Wahnhausen", Initiative Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e.V. 2007; URL http://www.antimanifest.de/ararshed.htm
Seeßlen, Georg; Rost, Christian, „PacMac & Co. Die Welt der Computerspiele“, Reinbek 1984
Siepmann 1990
Sofsky, Werner, "Traktat über die Gewalt", Frankfurt am Main:Fischer, 1996
Spitzer, Manfred, "Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft", Stuttgart:Klett, 2005
Steinmetz, Linda, „Gutachterliche Stellungnahme zur Gewaltaffinität der Mitglieder/innen der (deutschen) Paintball-/Gotcha-Szene“, Stuttgart, 2000
Sternheimer, Karen, "do video games kill?", in: contexts, Winter 2007, S.13-17
Strohmeier, Gerhard, "Politik bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg", in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 41/2005, Bundeszentrale für politische Bildung, 2005
Stöcker, Christian, „So leicht werden Menschen zu Folterknechten“, 19.12.2008; URL http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,597501,00.html, abgerufen am 01.04.2009
Teuthorn, Christina, "Spiegelneurone - Wie kleinste Teilchen die menschliche Kommunikation steuern", Bayern2 radioWissen, 17.04.2008, URL http://www.br-online.de/content/cms/Universalseite/2008/02/27/cumulus/BR-online-Publikation--102658-20080320105217.pdf
Tomlinson, Gary, "Clamor vincit omnia", in: Herbert von Karajan-Institut (Hrsg.), "Amor vincit Omnia. Karajan, Monteverdi und die Entwicklung der Neuen Medien", Wien:Csolnay, 2000
Quandt, Thorsten, "Der Gamer - das unbekannte Wesen? Ergebnisse empirischer Nutzungsstudien", Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, FU Berlin 2007
Virginia Tech Review Panel, "Mass Shootings at Virginia Tech - April 16,2007", Report of the Review Panel Presented To Timothy M. Kaine, Governor Kaine, Commonwealth of Virginia, August 2007
Vitouch, Peter, „Fernsehen und Angstbewältung. Zur Typologie des Zuschauerverhaltens“, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 3.Auflage 2007
von Hilgers, Philipp, „Eine Anleitung zur Anleitung: Das taktische Kriegsspiel 1812-1824“, in: Board Game Studies 3, 2000, S.59-77
Vorauer-Mischer, Karin, "Fortgeschrittene Methoden der statistischen Regionalanalyse - Pfadanalyse", 2004
Wagner, Georg, "Mythos Härte. Weder milde noch strenge Urteile beeinflussen die Zahl der Straftaten", in: Süddeutsche Zeitung, xx.xx.2003; nach URL http://www.havovwo.nl
Weber, René; Ritterfeld, U.; Mathiak, Klaus, "Does playing violent games induce aggression? Empirical evidence of a functional magnetic resonance imaging study", in: Media Psychology, Vol.8, 2006, S.39-60
Weiß, Rudolf, „Schaffen die Medien Helden? - Verstärkung der Realität durch die Berichterstattung und fiktionale Filmwelten“, 2002; URL http://www.sichtwechsel.de
Weiß, Rudolf H., „Weitere Informationen zur Pressemitteilung des Vereins 'Mediengewalt – Internationale Forschung und Beratung e.V.' zum Massaker von Winnenden am 11.3.2009“, Version vom 13.03.2009; URL http://www.mediengewalt.eu
Welge+Holtbrügge 2003
Wolff, Philip, "Die Rettung der Seele", in: SZ Wissen 11/2006; URL "Die Rettung der Seele", abgerufen am 16.06.2008
Wurm, Maria, "Musik in der Migration. Beobachtungen zur kulturellen Artikulation türkischer Jugendlicher in Deutschland", 2006, zugleich Dissertation, Universität Frankfurt am Main, 2005
Zimbardo, Philip G.; Maslach, Christina; Haney, Craig, "Reflection on the Stanford Prison Experiment: Genesis, Transformations, Consequences", 2001; URL http://www.prisonexp.org/pdf/blass.pdf
Zwick, Michael M., "Was läßt Risiken akzeptabel erscheinen? Ein empirischer Vergleich von fünf theoretischen Ansätzen", in: Michael M. Zwick; Ortwin Renn (Hrsg.), "Wahrnehmung und Bewertung von Risiken. Ergebnisse des Risikosurvey Baden-Württemberg 2001", Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg und Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie, 2002
Letzte Aktualisierung: 21.08.2009